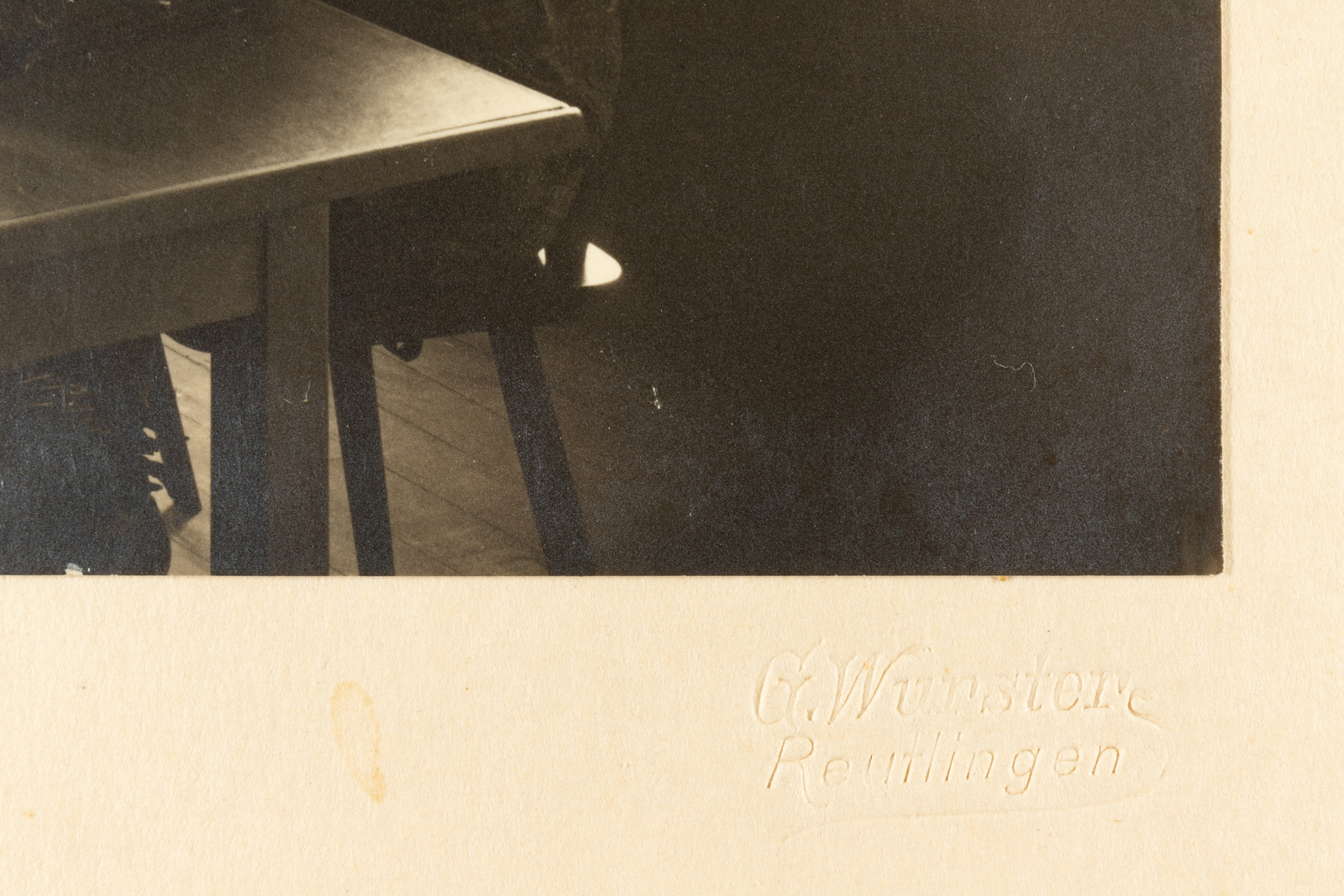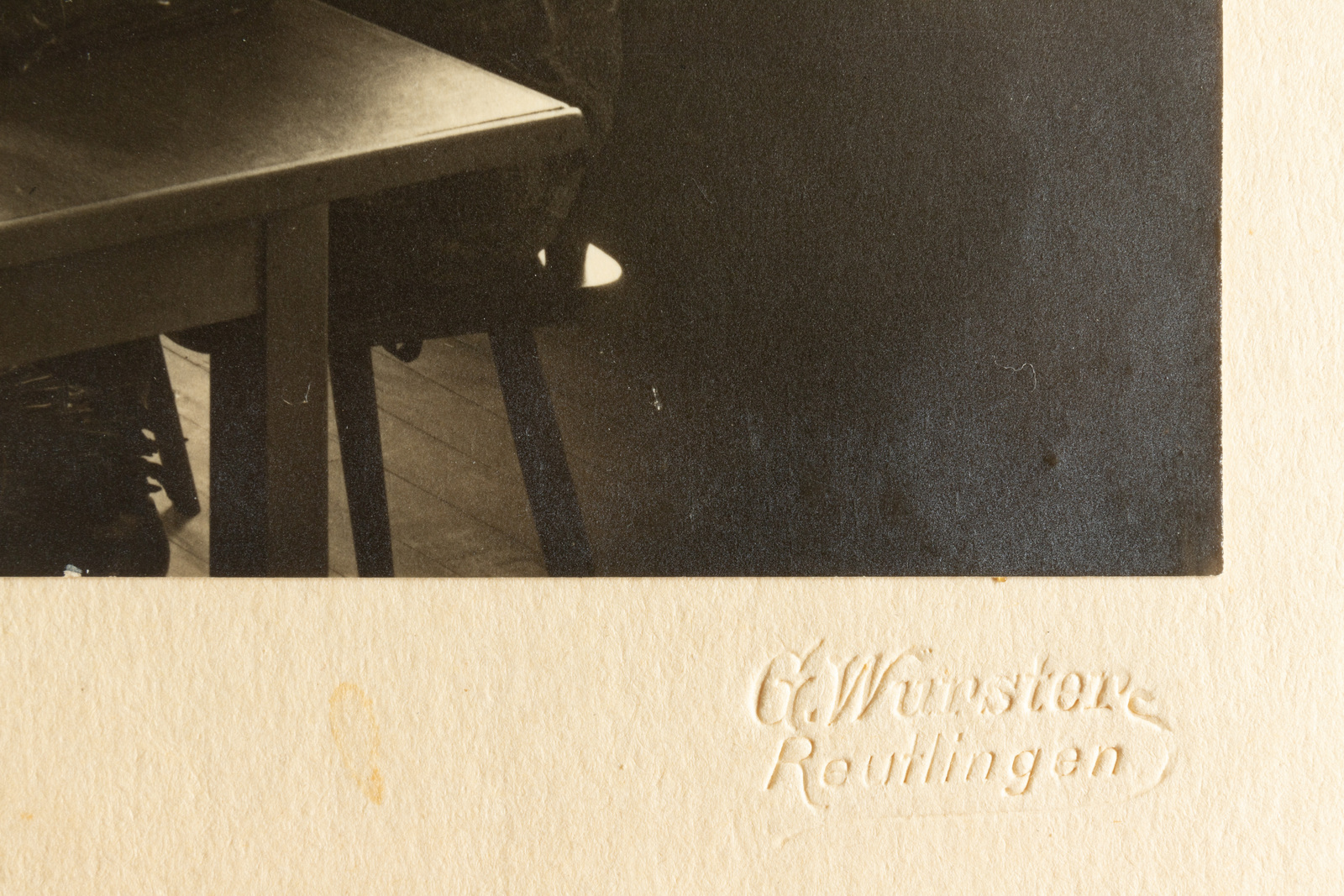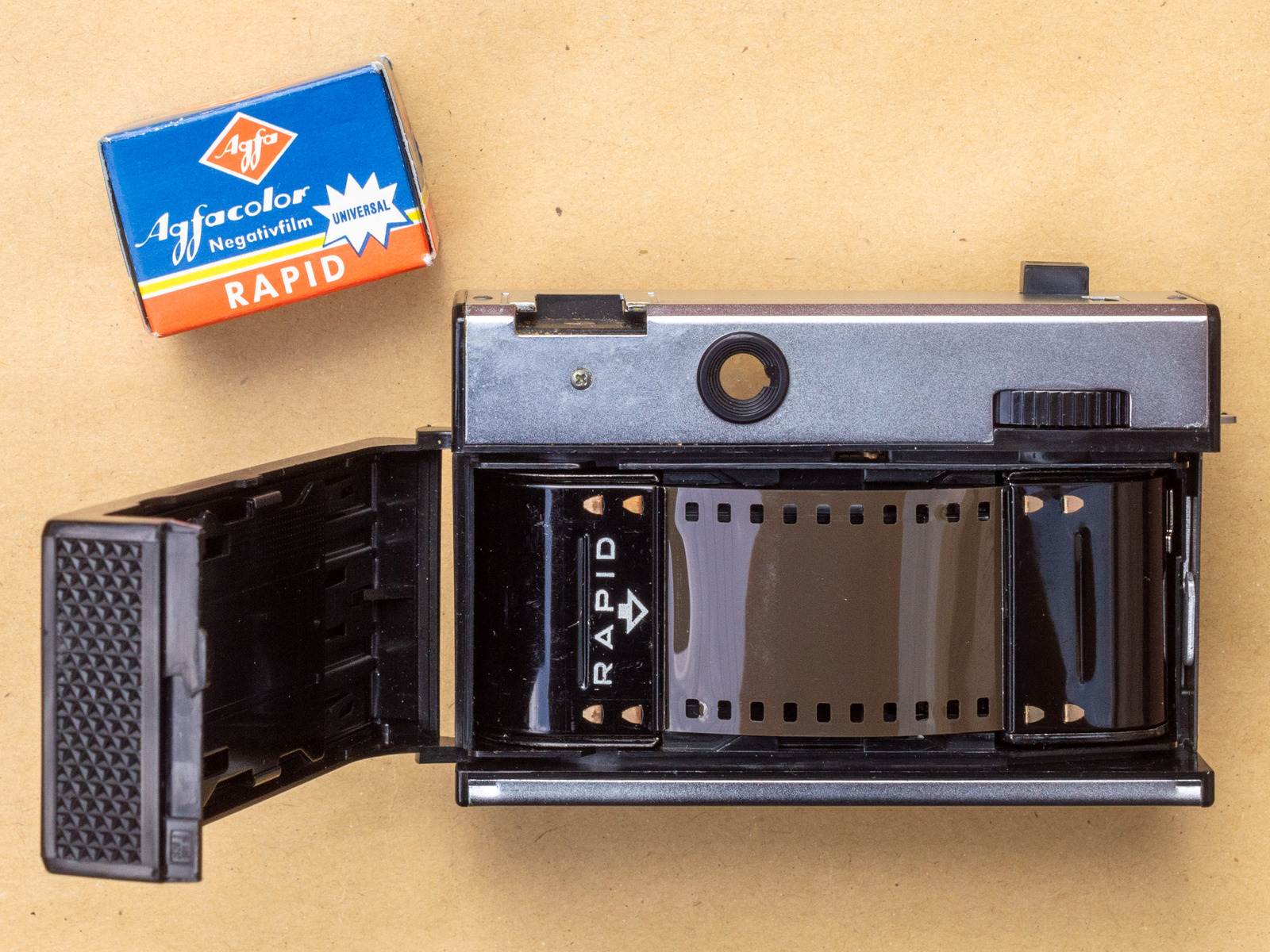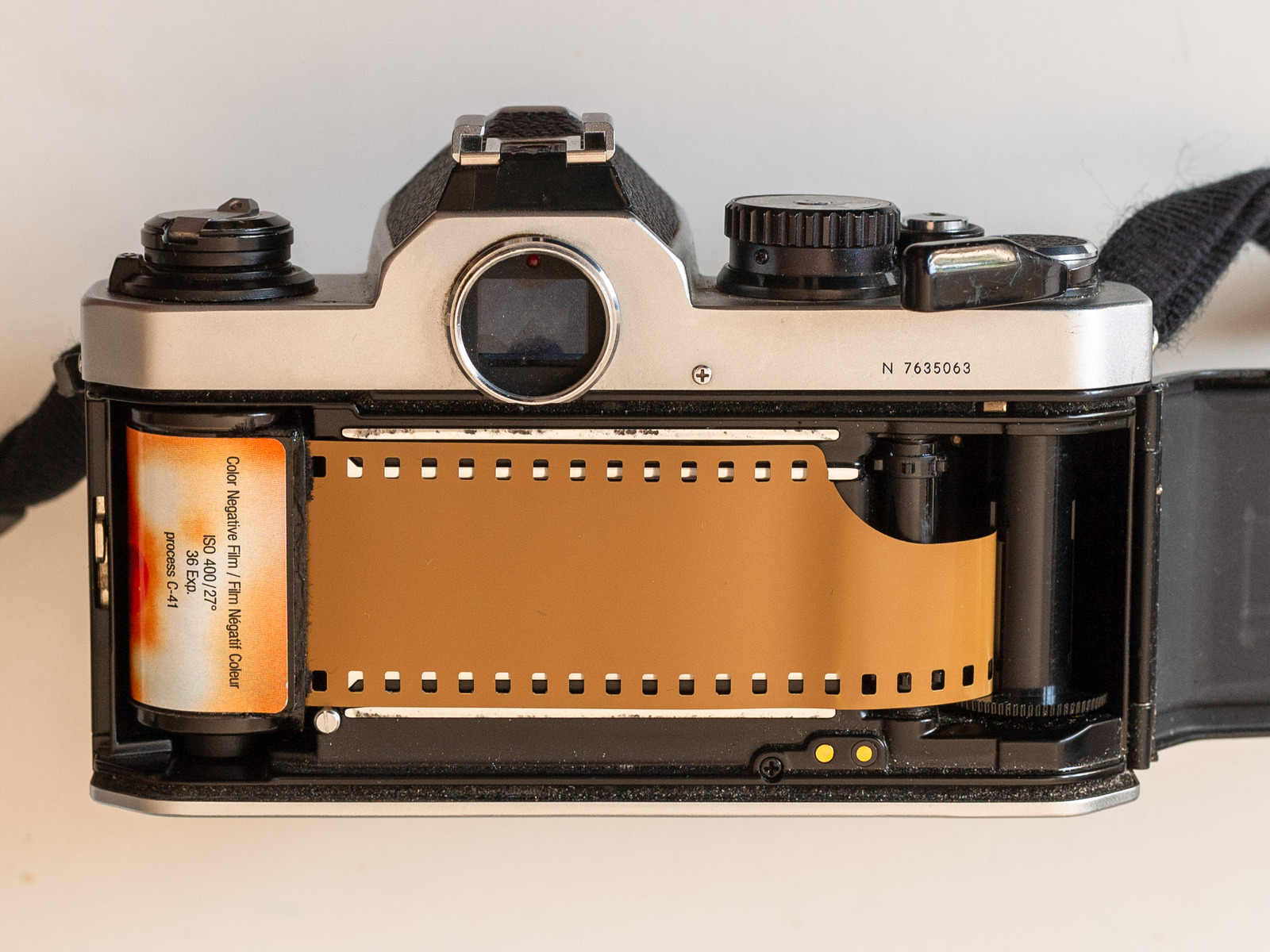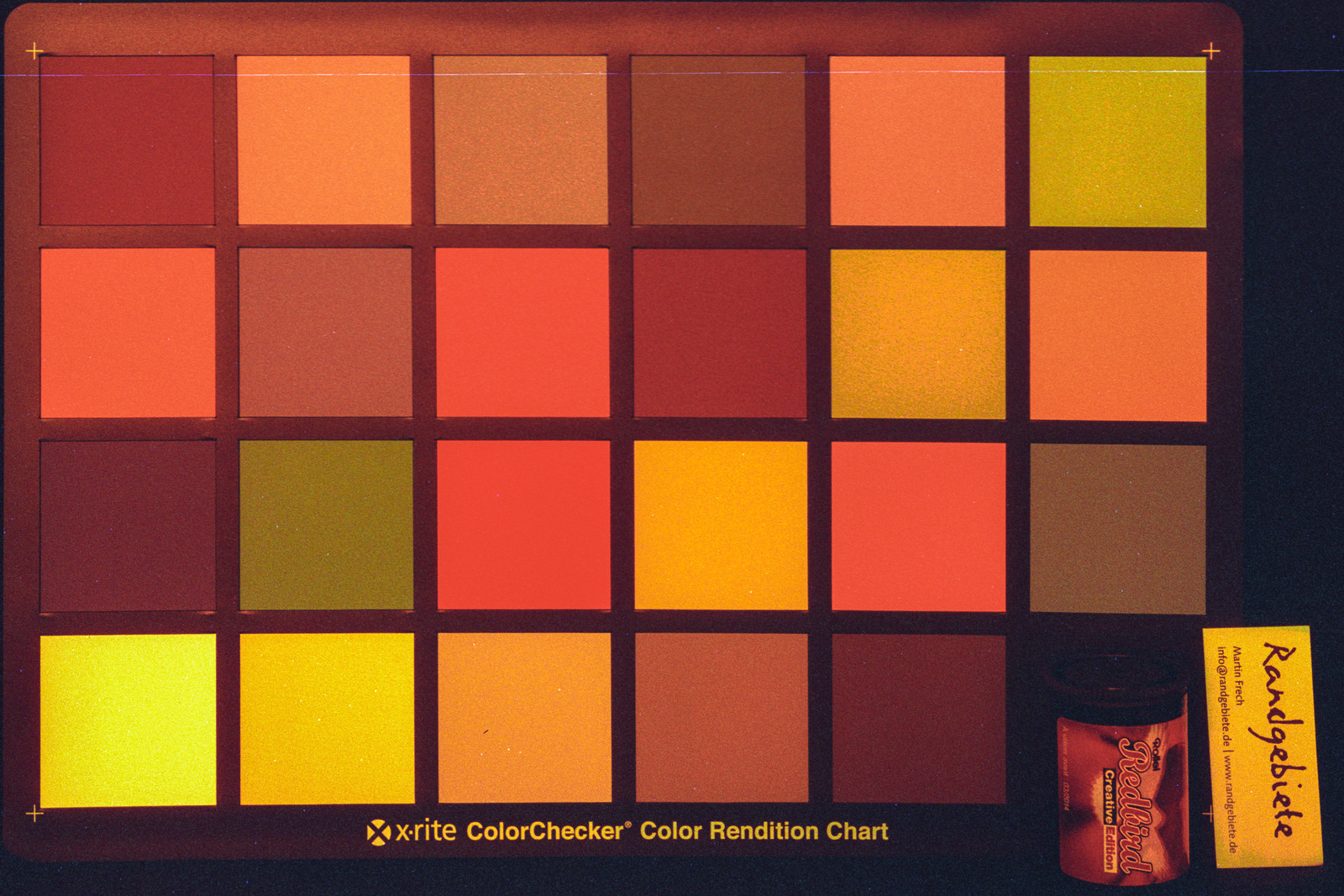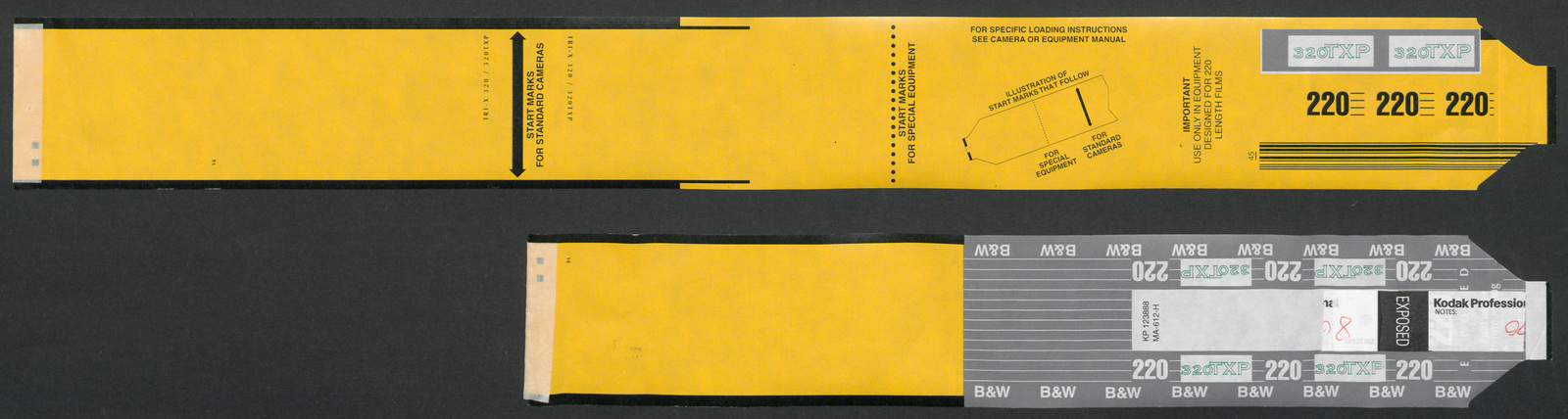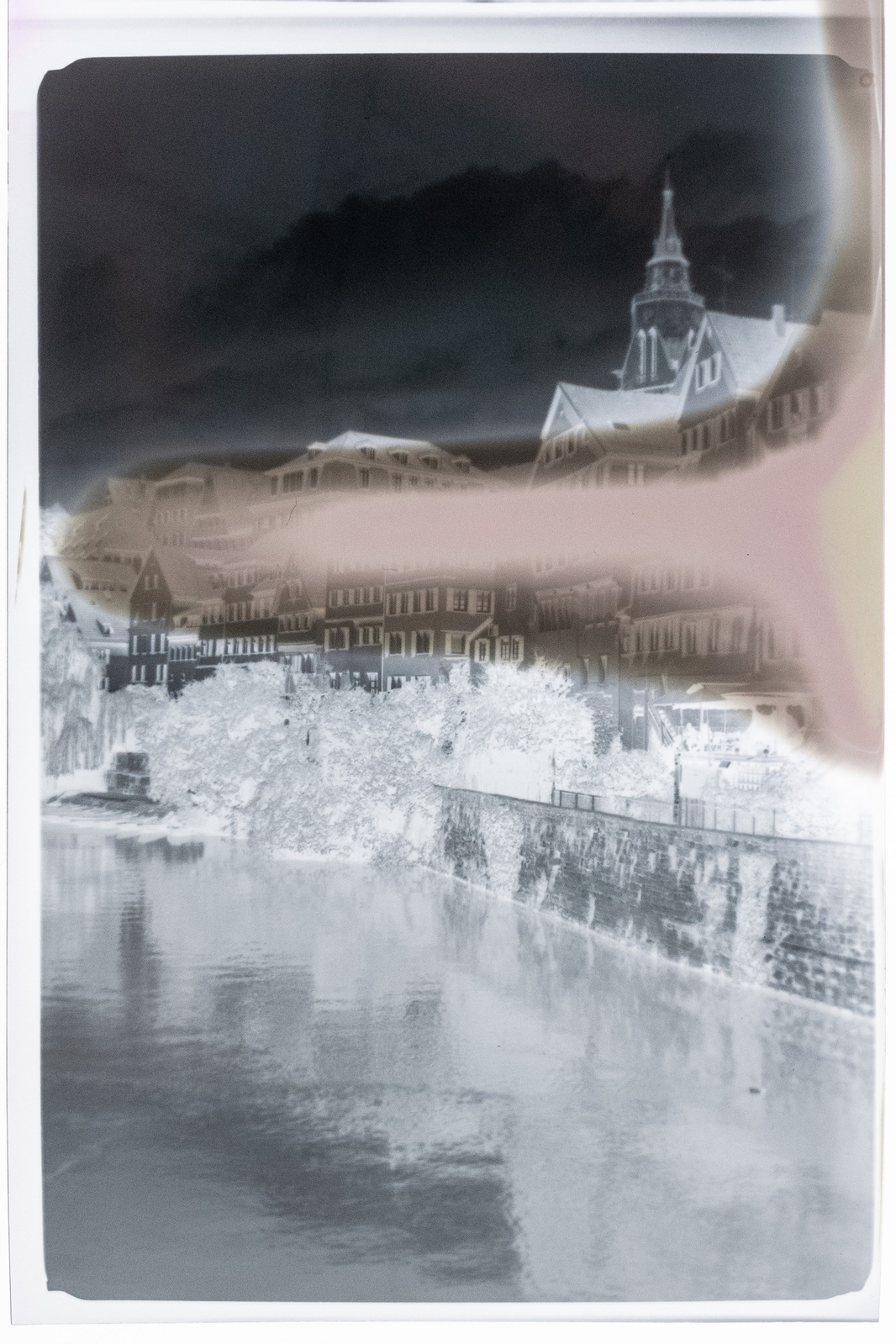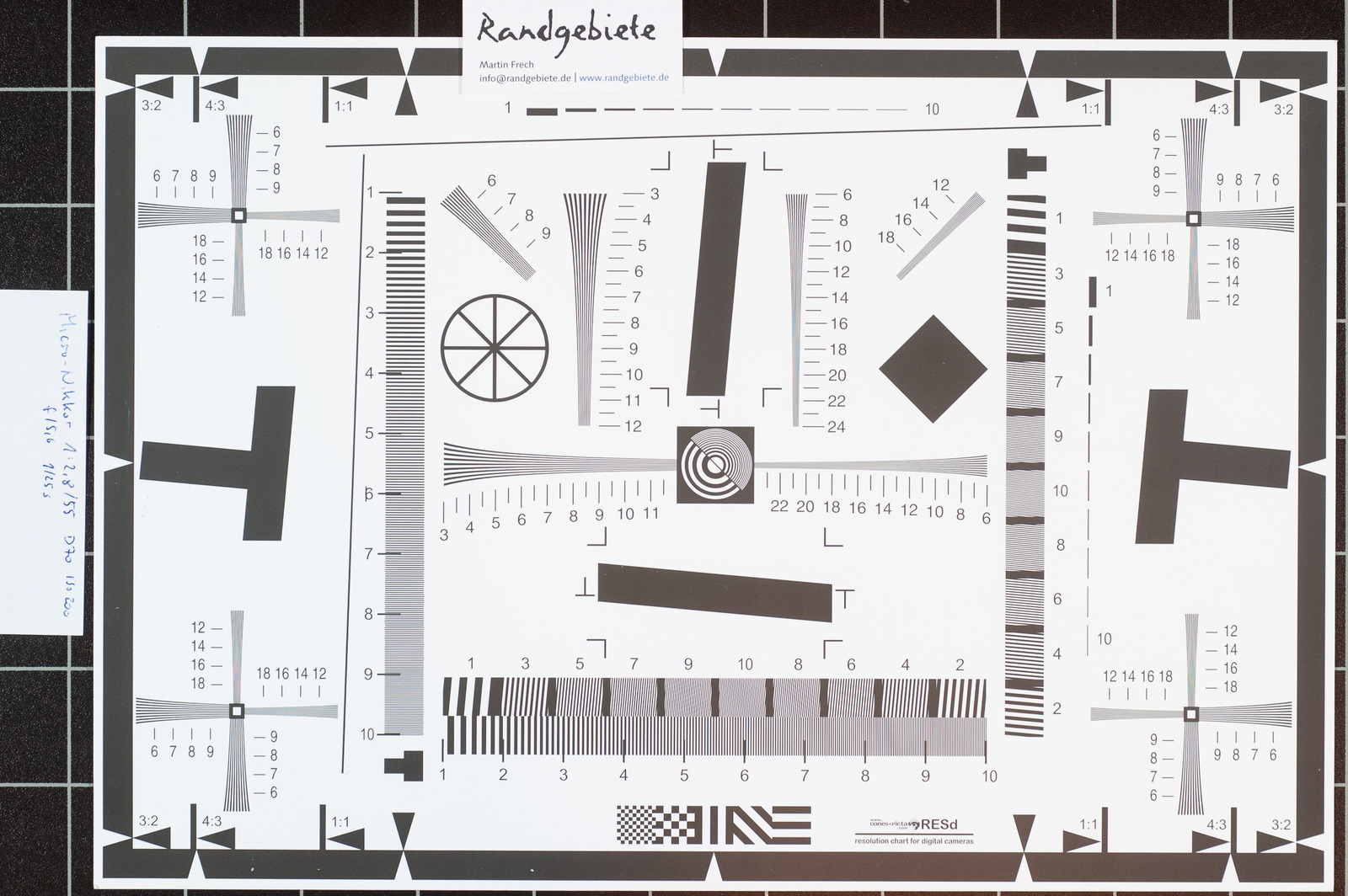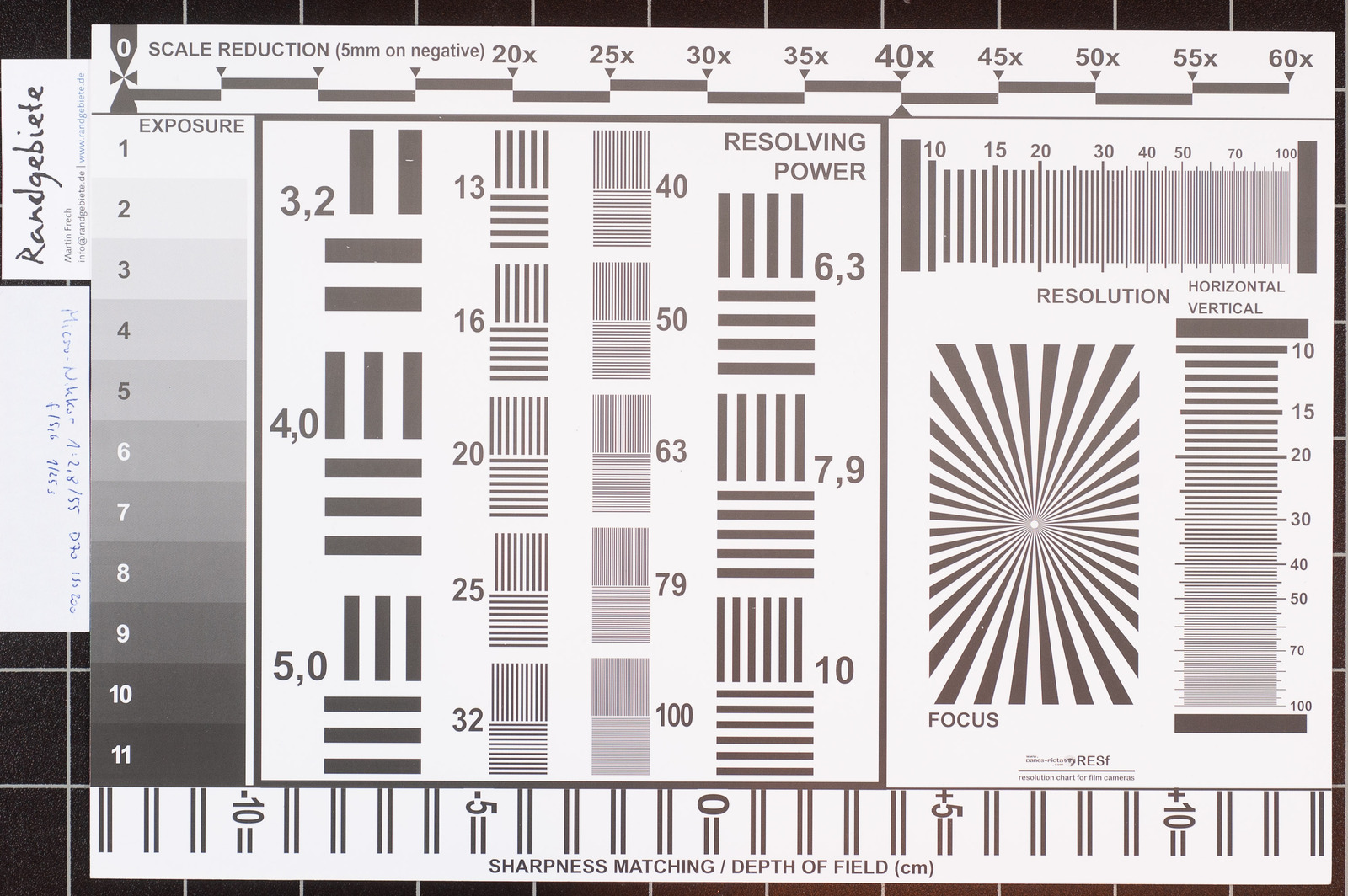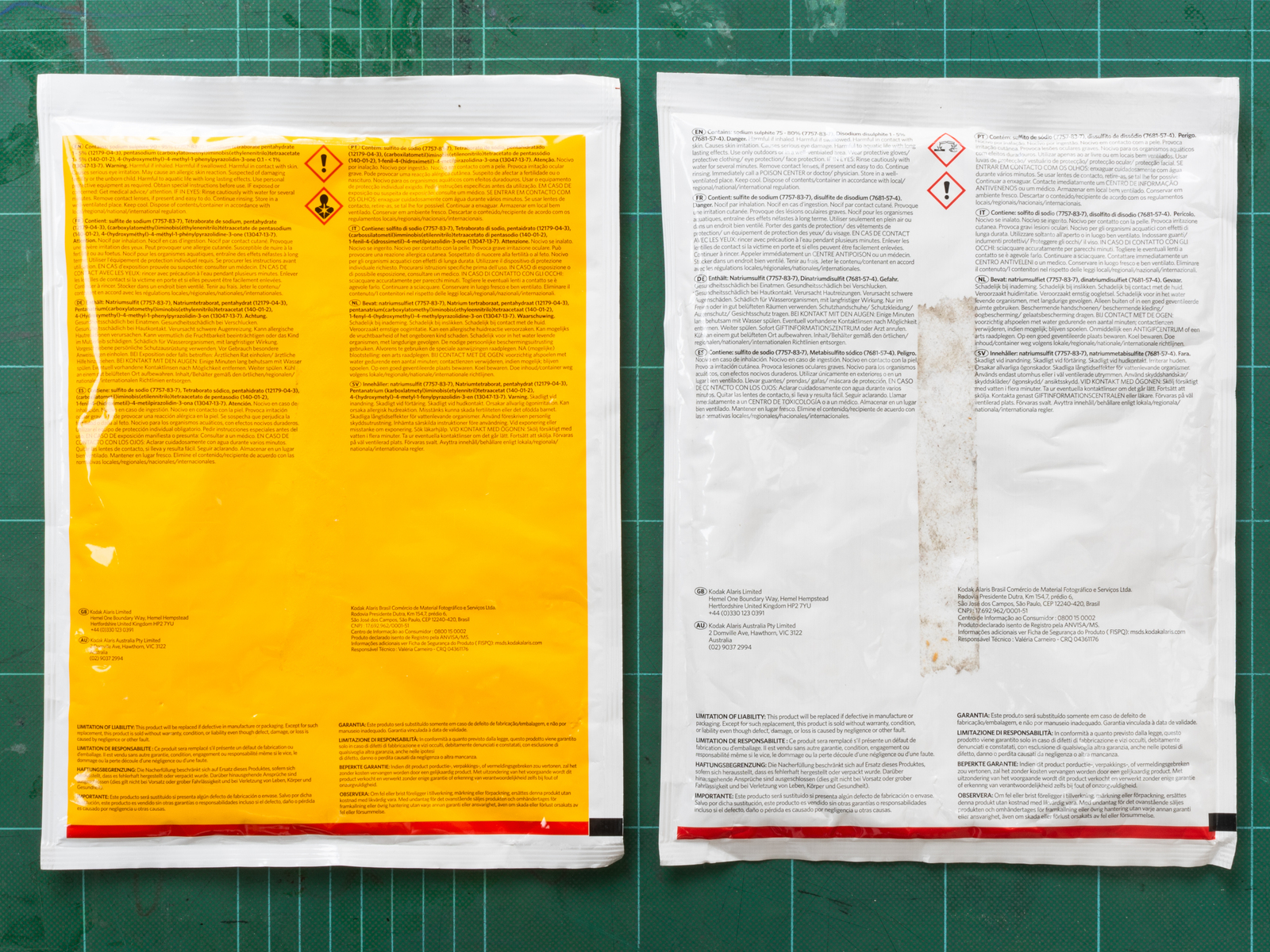Kompendium emulsionsbasierte Fotografie
#
8 mm-Film (teilw. hist.)
Kinefilmformat in div. Ausprägungen (Super 8, Single 8, Doppel-8-/
Normal-8 und Doppel Super 8/ DS 8); in der Szene am weitesten verbreitet ist das 1965 eingeführte Super 8; Aufnahmeformat: 5,46 × 4,01 mm (q); konfektioniert in 15 m-Kassetten Stand 2025 am Markt:
Kodak: (↱ Webseite d. Herstellers [2025-08-23]):
- Kodak Tri-X 7266: Schwarzweiß-Umkehrfilm (vgl. ⭬ Tri-X)
↱ Beispielfilm Tri-X [2025-12-05] - Kodak Ektachrome 100 D 5294/7294: Farbumkehrfilm
↱ Beispielfilm 100 D [2025-12-05] - Kodak Vision 3 (50 D, 200 T und 500 T): Farbnegativfilme
↱ Beispielfilm 50 D [2025-12-05]
↱ Beispielfilm 200 T [2025-12-05]
↱ Beispielfilm 500 T [2025-12-05]
Wittner: (↱ Webseite d. Anbieters [2025-08-23]):
- Original Wolfen UN 54 (= Wittnerpan 100): Schwarzweiß-Umkehr-/
Negativfilm
↱ Beispielfilm Wittnerpan 100 (⭬ umkehrentwickelt) [2025-12-05] - Original Wolfen Color 200/
400 (D): Farb-Negativfilm (ohne ⭬ Rem-Jet)
↱ Beispielfilm Wolfen Color 200 in ⭬ ECN-2 [2025-12-05]
D: ⭬ Tageslichtfilm (kann mit ⭬ Farbkonversionsfilter auch bei Kunstlicht belichtet werden); T: ⭬ Kunstlichtfilm
Warum man sich das gönnt: Even if you recorded a pile of shit with super 8 it would still look amazingly beautiful.
↱ Super 8 Film Stock Demos bei Pro8mm [2024-07-27]
Auch für das 1932 eingeführte Doppel-8-/
Normal-8-Format bekommt man noch konfektioniertes Material (↱ Wittner [2025-08-23], ↱ Foma [2025-08-23]) und eingeschränkt sogar für Doppel Super 8 (DS 8). Filmlänge in m Laufzeit in min. (Super 8) 18 B/s 24 B/s 1 0:13 0:09 15 3:36 2:27 60 13:07 9:50 120 26:14 19:41 Um die Bildfrequenz der Filme auf die von Video anzugleichen, wird mit 18 B/s aufgenommener Film gerne mit 16 ⅔ B/s abgetastet und mit 24 B/s aufgenommener Film mit 25 B/s.
- Super8 Reversal Lab: ↱ super8.nl/en/homepage/ [2025-08-23]
- Andec (Berlin): ↱ andecfilm.de [2025-08-23]
- LaborBerlin: ↱ laborberlin-film.org [2024-08-03]
Lit.:
Tuncsik, Georg: Schmalfilm selbst entwickelt. 2. Aufl. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1979. Online: ↱ filmkorn.org/archiv/buecher/buch-schmalfilm-selbst-entwickeln/ [2024-05-25]
- Kodak Tri-X 7266: Schwarzweiß-Umkehrfilm (vgl. ⭬ Tri-X)
16 mm-Film
Kinefilmformat mit Aufnahmeformaten von
10,26 × 7,49 mm (q)
Normal 16, R16; Seitenverh. 1,37:1 (›Academy‹; in der Projektion jedoch meist 4:3); ein- oder beidseitig perforiert; seit 1923 (Kodak)12,52 × 7,41 mm (q)
Super 16, S16; Seitenverh. 15:9 (›Paramount‹; 5:3, 1,66:1); einseitig perforiert; seit 1969 (Rune Ericson (1924–2015)); selten als Vorführformat
s. a. ⭬ Hi 1611,66 × 6,15 mm (q)
Ultra 16, U16; Seitenverh. 1,89:1; ein- oder beidseitig perforiert; seit 1996 (Frankie DeMarco als hack)U16 entsteht, wenn man das Bildfenster einer R16-Kamera symmetrisch links und rechts um je 0,7 mm erweitert und die Filmfläche zwischen den Perforationslöchern nutzt. Die Modifikation ist simpel, da man das Objektiv nicht neu zentrieren muss. Der Bildkreis der Optik muss das breitere Format jedoch auch ausleuchten können (daher sieht man gelegentlich vignettierte U16-Aufnahmen).
Bei einseitig perforiertem Normal 16 ist eine Licht- oder Magnettonspur möglich.
122 m (400 ft) laufen ca. 11 Minuten (24 Bilder/s)
16 mm-Farb- und Schwarzweiß-Negativfilmmaterial wird von Kodak (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]) und ORWO/
FilmoTec (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]) hergestellt; von Foma gibt es den Schwarzweiß-Umkehrfilm Fomapan R 100 (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]). 16 mm-Film war das klassische Format für Dokumentarfilme, da die Kameras im Vergleich zum 35 mm-Format noch recht handlich sind.
16 mm-Film ist gut geeignet zum Vergrößern (›aufblasen‹) auf 35 mm-Film, optisch oder in einem hybriden Prozess; vgl. ⭬ Hi 16.
16 mm-Film wird auch in ⭬ Kleinstbild-Kameras (z. B. »Rollei 16«; nicht aber ⭬ Minox!) verwendet (das ⭬ Kleinstbild-Aufnahmeformat ist herstellerabhängig).
- LaborBerlin: ↱ laborberlin-film.org [2024-08-03]
- Andec (Berlin): ↱ andecfilm.de [2025-08-23]
Lit.:
The Essential Reference Guide for Filmmakers. Firmenschrift Kodak H-845. 2007. Online: ↱ kodak.com/content/products-brochures/Film/kodak-essential-reference-guide-for-filmmakers.pdf [2023-08-06]
Tuncsik, Georg: Schmalfilm selbst entwickelt. 2. Aufl. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1979. Online: ↱ filmkorn.org/archiv/buecher/buch-schmalfilm-selbst-entwickeln/ [2024-05-25]
35 mm-Film
beidseitig perforierter Filmstreifen dieser Breite, ursprünglich als Kinefilm entwickelt, später auch als ⭬ Kleinbildfilm genutzt (Oskar Barnack (1879–1936)). In der Kinefilm-Kamera liegt die Perforation seitlich, im Fotoapparat oben und unten; entsprechend verschieden sind die Aufnahmeformate (z. B. ⭬ Kleinbild-Aufnahmeformate).
Lit.:
- Frech, Martin: »100 Jahre Leica | 100 Jahre Kleinbildfotografie«. In: Notizen zur Fotografie, 2025-08-17. Online: ↱ medienfrech.de/foto/NzF/2025-08-17_Martin-Frech_100-Jahre-Leica_100-Jahre-Kleinbildfotografie.html [2025-08-21]
65/70 mm-Film (auch: Breitfilm)
Filmstreifen dieser Breite; perforiert und unperforiert
Im Kine-Bereich gelegentlich noch als Vorführformat genutzt (i. d. R. umkopiert vom 65 mm-Negativ mit Platz für Tonspuren); Perforation: doppelt perforiert, Type I.
Für die Fotografie gab es konfektionierten 70 mm-Film in Patronen (5 m) für spezielle ⭬ Mittelformat-Kameras/-Rückteile (Linhof, Hasselblad); Perforation: doppelt perforiert, Type II (auf Kodak-Spule S-84). In der Kamera wurde der Film von einer Patrone in die andere transportiert, man konnte daher einfach teilbelichtete Filme entwickeln. Dieses Format hatte in der Fotografie leider nur eine Nischenbedeutung für Anwendungen, wo in kurzer Zeit viele Aufnahmen in besserer als ⭬ Kleinbild-Qualität benötigt wurden (Apollo-Programm, Schulportraits, Hochzeitsfotografie) oder wo die Länge des Filmstreifens wichtig war (⭬ Rotations-Panoramakameras). Frisches 70 mm-Material zum selbst konfektionieren bekommt man noch von Ilford (HP5, 50 ft-Rolle; doppelt perforiert: CAT 1174821, ohne Perf.: CAT 1174810).
Lit.:
zur hist. Bedeutung von 70 mm-Film und dessen heutiger Nutzung:
Rogers, Brett: »Photographing On 70 mm Film in 2020«. In: Tasmania Film Photography. 26. Sep. 2020. Online: ↱ tasmanianfilmphotography.wordpress.com/2020/09/26/photographing-on-70mm-film-in-2020. [2022-05-05]
A
abgelaufener Film
Adotol Konstant (Adox)
proprietärer ⭬ Entwickler für ⭬ Silbergelatine-Fotopapier; ursprünglich ORWO N113
enthält ⭬ Hydrochinon ⚠
↱ Webseite d. Herstellers [2022-07-23]
Aerochrome (Kodak; hist.)
Ag, Argentum
Elementsymbol für ⭬ Silber
Albumin
Eiweiß
s. a. ⭬ Fotopapier | Albuminpapier
engl.: albumen
analoge Fotografie
Anaglyphenbild
⭬ Stereo-Bildpaar, dessen Teilbilder (Anaglyphen) komplementär zueinander eingefärbt und übereinander angeordnet sind. Als Farben für die Teilbilder werden üblicherweise Rot für das rechte Teilbild und Blau oder Blaugrün (Cyan) für das linke Teilbild verwendet.
Der Raumeindruck entsteht bei Betrachtung des A. durch ein ⭬ Stereoskop mit zwei Lichtfiltern in den Farben der Teilbilder, die bewirken, dass die beiden Bilder von den Augen getrennt gesehen werden: Sind die A. rot und blaugrün gefärbt, ist durch den roten Filter das blaugrüne linke Bild zu sehen und durch den blaugrünen Filter das rote rechte Bild.
engl.: anaglyph images
Anamorphot
Spezielles Objektiv, das das Bild bei der Aufnahme in der Breite deutlich staucht (meist um den Faktor 2). So kann auf Standardmaterial (günstig) ein Bild mit panoramatischem Seitenverhältnis aufgenommen werden. Wird diese Aufnahme durch den Anamorphoten betrachtet, sieht man es wieder entzerrt. Mit dem Nachteil, dass z. B. bei Nachtaufnahmen unscharfe Lichtpunkte elliptisch werden.
Anamorphotische Verfahren werden v. a. für Kinoproduktionen genutzt (»Cinemascope«, »Panavision« u. a.), entsprechende Objektive waren aber auch für kleinere Formate verfügbar (dann mit kleinerem Stauchungsfaktor).
Ansichtsfilter, Betrachtungsfilter
Dunkelbrauner optischer Filter zum Durchschauen; man sieht näherungsweise die Helligkeitswerte des Motivs, wie sie ein ⭬ panchromatischer Schwarzweißfilm aufnimmt (ein bisschen, als ob man es unter dem Licht einer Natriumdampflampe betrachtet, nur dunkler).
ähnlich dem Kodak Wratten-Filter # 90
engl.: viewing filter
Anthotypie (griech. τὸ ̓άνθος: Blume, Blüte)
Naturdruckverfahren: ⭬ Kontaktkopie oder ⭬ Fotogramm auf einem mit Pflanzenfarbstoff beschichtetem Papier unter Sonnenlicht. Das Bild entsteht, da die Lichtenergie mit der Zeit den Farbstoff bleicht oder abdunkelt; als Farbstoffe (Anthocyane) geeignet sind daher alle, die nicht lichtecht sind. Die Belichtungszeit kann – abhängig vom Farbstoff – mehrere Wochen betragen.
A. könen nicht ⭬ fixiert werden, das Bild bleicht unter Lichteinfluss aus (dunkel aufbewahren).
Lit.:
Fabbri, Malin: Anthotypes ; Explore the darkroom in your garden and make photographs using plants. Stockholm: alternative
photography.com, 2012. ISBN 978-1-4662-6100-6
engl.: anthotype
APEX, Additive System of Photographic Exposure (hist.)
Von der ASA in den 1960er-Jahren vorgeschlagenes System zur Darstellung der Belichtungsparameter ⭬ Blende, Verschlusszeit, ⭬ Filmempfindlichkeit in ganzen Zahlen; vergleichbar mit dem von der Firma Friedrich Deckel (damals bedeutender Hersteller von ⭬ Kameraverschlüssen) in der 1950er-Jahren konzipierten ⭬ Lichtwert-Methode.
Lit.:
Kerr, Douglas A.: APEX – The Additive System of Photographic Exposure. 8. Okt. 2007. Online: ↱ dougkerr.net/Pumpkin/articles/APEX.pdf [2024-05-24]
APS (hist.)
Abk. f. Advanced Photo System; von Canon, Fujifilm, Kodak, Minolta und Nikon 1996 gemeinsam eingeführt zur Ablösung des Kleinbild-Films im Amateurbereich; Kodak ⭬ Film-Typ 240 mit entsprechend speziellen Kameras und Geräten für die Foto-Finisher; letztes Aufbäumen der analogen Fotoindustrie im Amateurmarkt, kam aber zu spät
Die Idee war, das Fotografieren für die Hobby-Anwender einfacher und weniger fehleranfällig zu machen, aber dennoch und trotz des mit 24 mm vergleichsweise schmalen Films eine hohe Qualität zu bieten.
- Filmpatronen waren konfektioniert für 15, 25 oder 40 Aufnahmen; zusätzlich zum Bild wurden Metadaten optisch und bei den teureren Kameras auch magnetisch auf dem Film gespeichert, um die Verarbeitung im Labor zu automatisieren.
- Es waren nur Farbnegativ-, chromogene Schwarzweiß- sowie Farbdiafilme am Markt; es gab keine klassischen Schwarzweißfilme.
- Der Filmanfang muss beim Einlegen der Patrone in die Kamera nicht eingefädelt werden – die Kamera zieht den Film automatisch bis zum ersten unbelichteten Bild aus der Patrone (das Wechseln teilbelichteter Filme ist möglich). Komplett belichtete Filme werden automatisch zurückgespult.
Vor jeder Aufnahme kann das Seitenverhältnis an der APS-Kamera neu gewählt werden:
- APS-C (Classic): 25,1 × 16,7 mm (3:2)
- APS-H: 30,2 × 16,7 mm (16:9, komplettes Negativ)
- APS-P (Panorama): 30,2 × 9,5 mm (3:1)
Die Wahl wird als Metadatum optisch/
magnetisch auf dem Film gespeichert für die Ausbelichtung im Labor; aufgenommen wird allerdings immer das volle Format (H), das auch der Index-Print zeigt. - Der Film bleibt auch nach der Entwicklung in seiner Patrone, das vereinfacht – in Verbindung mit dem obligatorischen Index-Print – den Umgang mit den Nachbestellungen und das Archivieren; allerdings nur solange der Index-Print nicht verloren geht.
archivfest
Merkmal von Materialien, die zur Präsentation oder Aufbewahrung von Fotos, Negativen usw. verwendet werden.
Säuren in Papieren, Holz und anderen Materialien führen mit der Zeit zu einer Verschlechterung des fotogr. Materials. Archivkartons und -papiere sind daher säurefrei und können eine Puffersubstanz gegen das Eindringen von Säure enthalten.
Sollen Fotos und Negative langzeitstabil sein, müssen sie entsprechend verarbeitet werden: Chemikalien aus dem ⭬ Entwicklungsprozess, die zu einer Verschlechterung des Trägers oder des Bildes führen können, müssen so gut wie möglich entfernt und die bildformenden Substanzen so stabilisiert sein, dass sie Umwelteinflüssen standhalten. Das wird im Schwarzweißprozess durch ausreichendes ⭬ Fixieren und ⭬ Schlusswässern sowie eine silberbildstabilisierende Nachbehandlung erreicht.
Materialien der nassen Farbprozesse sind i. d. R. nicht langzeitstabil; hier haben Tintenstrahldrucke mit pigmentierten Tinten auf entsprechenden Papieren einen deutlichen Vorteil (⭬ hybrider Workflow).
wichtige Informationsquelle: Wilhelm Imaging Research, ↱ wilhelm-research.com [2024-03-17]
Lit.:
Levédrine, Betrand: A guide to the preventive conservation of photograph collections. Los Angeles, CA/
USA: J. Paul Getty Trust, 2003. ISBN 0-89236-701-6. Online verfügbar: ↱ getty.edu/publications/resources/virtuallibrary/9780892367016.pdf [2025-01-25] - Protecting and Displaying Black-and-White Prints. Firmenschrift Kodak F-35. Februar 2003.
ASA-Wert
Ausfleckretusche
weiße Stellen
Beim optischen ⭬ Vergrößern von Negativen werden auch die Staubteilchen auf dem Negativ mit vergrößert und erzeugen helle Stellen auf der Vergrößerung. Diese werden auf dem getrockneten Bild mit ruhiger Hand, einem sehr feinen Rundpinsel (Marderhaar, Größe 000) und ⭬ Eiweißlasurfarbe ausgebessert: Die Farbe wird mit Wasser verdünnt, bis der erforderliche Farbton erreicht ist und mit dem Pinsel geduldig Punkt für Punkt auf die helle Stelle getupft. Soll der Farbton dunkler werden, tupft man einen helleren Farbton mehrfach übereinander, bis die gewünschte Farbdichte erreicht ist.
schwarze Stellen
Wenn die Schicht des Negativs transparente Fehlstellen hat, erscheinen diese Bereiche in der Vergrößerung schwarz; Ursachen sind Staub in der Kamera, Nachlässigkeit beim Entwicklungsprozess/
Trocknen oder Fabrikationsfehler des Materials. Es gibt drei Möglichkeiten, diese zu retuschieren:
Negativ auf der Trägerseite mit einem schwarzen oder roten Filzstift retuschieren und nochmal vergrößern, die nun zu helle Stelle ausflecken (s. o.)
Dunkle Stelle chemisch ⭬ bleichen: die feuchte Papieroberfläche mit verdünntem ⭬ Farmerschem Abschwächer und einem dünnen Nylonpinsel wegtupfen, diese nun evtl. zu helle Stelle mit Wasser nachtupfen und später auf dem trockenen Papier ausflecken (s. o.). Bei kleinen Stellen ist so wenig ⭬ Fixierer im Spiel, dass nicht der ganze Print nochmals gewässert werden muss.
Eine Alternative zum Farmerschen Abschwächer:
Abschwächer R-23 (Kodak-Rezeptur) Menge Substanz 30 g
Kaliumjodid (KI) und
10 g
Jod (resublimiert)
in 200 ml Wasser lösen
Zur Entfernung von dunklen Flecken trägt man die Lösung unverdünnt mit einem Pinsel auf den feuchten Papierabzug auf und fixiert anschließend in:
200 g
Natriumthiosulfat, kristallin (Na₂S₂O₃)
in 1 l Wasser lösenabschließend gut Wässern
Dunkle Stelle mit einer sehr scharfen Klinge vorsichtig wegkratzen; die nun zu helle Stelle ausflecken (s. o.)
s. a. ⭬ Kolorieren
Lit.:
- Retouching Color Negatives – The Latest Information about Retouching. Firmenschrift Kodak E-71. November 1998.
engl.: spot retouching
Auskopierverfahren
Negativ-Positivprozess ohne Entwicklung, das Bild erscheint bei der Belichtung; üblicherweise ausgeführt als ⭬ Kontaktkopie unter Sonnen-/
UV-Licht Diazotypie (Ozalidkopie)
engl.: printing-out process
Auswässerungshilfe für ⭬ Fotopapiere (und Filme)
Alkalische Lösung, die die fotogr. ⭬ Schicht etwas aufquellen lässt. Dadurch erhöht sich die Diffusionsgeschwindigkeit und die Zeit der ⭬ Schlusswässerung kann um ca. 30 % verkürzt werden.
Eine A. wird v. a. zur Behandlung von ⭬ Schwarzweiß-Baryt-Papieren eingesetzt.
Soda-Zwischenbad (Agfa-Rezeptur 320) Menge Substanz 10 g Natriumcarbonat (Na₂CO₃, wasserfrei)
in 1 l Wasser lösenDie Bilder nach dem ⭬ Fixieren kurz mit Wasser abspülen, dann 1 min. ins Sodabad, dann ⭬ Schlusswässerung
Eine weniger alkalische Alternative ist eine Sulfitlösung, z. B. Kodaks proprietäres Hypo Clearing Agent (HCA).
zu HCA analoge Rezeptur nach ⭬ Anchell (2016, 340) Menge Substanz 200 g Natriumsulfit (Na₂SO₃, wasserfrei)
in 750 ml Wasser (> 50 °C) lösen; mit Wasser auf 1 l auffüllen1 + 9 ⭬ verdünnen; die Bilder nach dem ⭬ Fixieren kurz mit Wasser abspülen, dann 3 min. HCA, dann ⭬ Schlusswässerung
Konfektionierte Produkte: beispielsweise Adox Thio Clear (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]); Ilford Washaid (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]); Kodak HCA; Moersch HCA (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]); Tetenal Lavaquick (hist.)
engl.: washing aid
Autochrome-Verfahren (hist.)
Direkt-Positiv-Farbprozess
Erstes weit verbreitetes Verfahren der Farbfotografie. Mit dem A. war es im frühen 20. Jahrhundert erstmals möglich, ein Farbfoto mit nur einer Aufnahme anzufertigen. Die Brüder Auguste und Louis Lumière erfanden das Verfahren – sie bekamen 1903 ein entsprechendes Patent. Vermarktet wurde es ab 1907. Bis Mitte der 1930-Jahre war das A. die übliche Technik zur Aufnahme von Farbbildern.
Zur Funktions- und Gebrauchsweise siehe Frech (2013); zum Problem der Projektion siehe Fuchs (2013).
engl.: autochrome process
Lit.:
Frech, Martin: »Das Autochrome-Verfahren für die Farbfotografie«. In: Notizen zur Fotografie. 28. Okt 2013. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2013-10-28/Das-Autochrome-Verfahren-fuer-die-Farbfotografie.html [2022-11-01]
Fuchs, Caroline: »Anticipation and Reality ; A Re-Evaluation of Autochrome Projection«. In: Photo
Researcher . Nr. 19. 2013. S. 33– 42. Online: ↱ eshph.org/wp-content/uploads/2015/12/pr_no_19.pdf [2023-01-08]
s. a. ⭬ Diapositiv; ⭬ Projektion
Autographic film (Kodak; hist.)
Kodak Autographic film wurde von 1915 bis 1932 für verschiedene Rollfilm-Typen angeboten und ermöglichte mit entsprechenden Kameras, handschriftlich Anmerkungen indirekt auf das Filmnegativ zu notieren. Kodak hat das entsprechende Patent 1914 für 300.000 $ von Henry J. Gaisman erworben, sich also schon früh Gedanken darüber gemacht, wie man Negative bereits bei der Aufnahme mit Metadaten anreichern kann.
Dazu öffnete man an der Rückwand entsprechend ausgestatteter Kameras eine Klappe/
einen Schieber und ›beschrieb‹ mit einem Metallstift die Rückseite des Rollfilms. Zwischen dem rückseitigen Schutzpapier, das bei A. nicht vollständig lichtdicht war, und dem Film befand sich eine lichtdichte Zwischenlage aus dünnem Kohlepapier, das durch den Druck des Stiftes partiell durchscheinend wurde. Anschließend hielt man das Fenster für einige Sekunden ans Licht (kein direktes Sonnenlicht), wodurch die handschriftliche Anmerkung auf den Filmsteg zwischen den Bildern belichtet wurde (im Negativ opak); transportierte man den Film nicht ›korrekt‹, schrieb man in den Bildbereich. Reproduktion eines Autographic-film-Negativs mit Anmerkungen:
Geoff Harrisson: Kodak Autographic Film; 127 size negative. flickr, 10. Jan. 2013. Online: ↱ flickr.com/photos/90900361@N08/8366847648/ [2024-05-30]Lit.:
Picture Taking with the Vest Pocket Autographic Kodak. Firmenschrift Kodak. Rochester, N. Y.: Eastman Kodak Co., April 1919. S. 24–27
Gustavson (2009, S. 175 ff.) [⭬ Literatur]
B
Balgen
Flexible Konstruktion aus lichtdichtem Material, die in B.-kameras und ⭬ B.-geräten den Raum zwischen Objektiv und lichtempfindlichem Material und in ⭬ Vergrößerungsgeräten den Raum zwischen Lichtquelle und Objektiv bildet.
In Vergrößerungsgeräten und B.-geräten ermöglicht der B. die stufenlose Verschiebung des Objektivs zur Fokusierung, in ⭬ Fachkameras zusätzlich dessen horizontale und vertikale Verschiebung zur Korrektur der Perspektive; die Verwendung eines B. in Faltbalgenkameras (meist ⭬ Mittelformatkameras, ›Falter‹) ermöglicht Konstruktionen, die man nach Gebrauch kompakt zusammenklappen oder -schieben kann.
Der B. ist meist gefaltet, Weitwinkelb. sind aber auch beutelartig ausgeführt.
engl.: bellows

Aufnahmebereit aufgeklappte Fujica GS645 Prof.: Zwischen Gehäuse und Objektiv ist der Faltbalgen zu erkennen.

Weitwinkelbalgen an einer ⭬ Fachkamera
Balgengerät
Zubehör für die Makrofotografie: Das B. stellt mittels eines ⭬ Balgens eine lichtdichte flexible Verbindung zwischen Objektiv und Objektivanschluss am Kameragehäuse her und ermöglicht die stufenlosen Veränderung der Bildweite (Auszug zwischen Filmebene und Objektiv) und damit des Abbildungsmaßstabs. Das B. erweitert den Einsatzbereich eines Makroobjektivs für Abbildungsmaßstäbe kleiner als 1 : 1.
s. a. ⭬ Nahlinse; ⭬ Zwischenring
engl.: macrophotography bellows
Barytabzug
Der Goldstandard: ⭬ nass ausgearbeitete analoge ⭬ Vergrößerung auf ⭬ Silbergelatine-Baryt-Fotopapier
Baryt-Fotopapier
Negativ-Positiv-Prozess
engl.: fiber-based paper
Belichtungsmesser
Gerät zur Bestimmung von Blende/
Belichtungszeit. In die Kamera integriert oder als separates Gerät. Zwei Methoden: Objekt- oder Lichtmessung. Bei der Objektmessung misst man die Beleuchtungsstärke des vom Motiv in Richtung Kamera reflektierten Lichts (alle in Kameras eingebaute B. messen so); bei der Lichtmessung wird die Stärke des Lichts gemessen, das das Motiv beleuchtet.
Spezielle B. sind Spot-Belichtungsmesser, die ein sehr kleines Messfeld haben, Blitzbelichtungsmesser, die die Beleuchtungsstärke während des Blitzens messen und ⭬ Densitometer zur Dichtemessung von Auf- und Durchlichtvorlagen.
Ein bewährtes Hilfsmittel zur Belichtungsmessung ist die ⭬ Graukarte.
Hat man keinen B. zur Hand sollte man die Belichtungsparameter qualifiziert schätzen (⭬ Sunny-16-Regel, ⭬ ULC).
engl.: light meter, exposure meter
Lit.:
Accurate Exposure with Your Meter. Firmenschrift Kodak AF-9. Okt. 1998.
Belichtungsmessung. o. D. Online: ↱ photobibliothek.ch/seite007v.html [2024-07-27]
Bircher, Adrian: Belichtungsmessung ; Korrekt messen, richtig belichten. Gilching: Verlag Photographie, 2002. ISBN 3-933131-59-6
Kompendium der Belichtungsmessung. Firmenschrift Gossen. Feb. 2017. Online: ↱ gossen-photo.de/wp-content/uploads/DL/FOTO/Kompendium_der_Belichtungsmessung.pdf [2023-01-03]
Belichtungsreihe
Mehrere Belichtungen desselben Motivs, bei denen nur die Belichtungseinstellung geändert wird. Ist üblich bei der Reprofotografie sowie bei Motiven mit hohem Kontrast, damit man bei der Ausarbeitung mehr Spielraum hat. Eine B. ist generell sinnvoll bei ⭬ Nachtaufnahmen und immer, wenn man sich unsicher ist über die korrekte Belichtung eines Motivs.
Beim Belichten von ⭬ Diafilm sind kleine Schritte empfehlenswert (± ½ oder sogar ⅓ Blendenstufen), bei Negativfilm eher größere Schritte. ⚠: Das Ändern der Blende beeinflusst die ⭬ Schärfentiefe, also besser die Belichtungszeit entsprechend verstellen.
Eine B. im Fotolabor ist der ⭬ Probestreifen.
engl.: (exposure) bracketing
s. a. ⭬ Belichtungsmesser
Bezugsquellen
Fototechnik Suvatlar, Hamburg
Tel. 0 40 / 39 57 09Labchem Röttinger, Dinslaken
↱ labchem.de/ [2024-08-04]Köhler GmbH, Andernach
↱ shop.koehlerchemie.de/privatkunden [2024-08-04]Kremer Pigmente GmbH & Co. KG, Aichstetten
↱ kremer-pigmente.com/de/shop/loesemittel-chemikalien-hilfsmittel/ [2024-08-04]
Bildspurzeit
Die Zeit, die vergeht, bis auf dem ⭬ Fotopapier im ⭬ Entwickler erste Bildspuren der mittleren Dichten zu sehen sind.
Faustregel zur Prozesskontrolle: Gesamt-Entwicklungszeit = 6fache Bildspurzeit (eines korrekt belichteten Papiers)
Bildstand
Bei der Kinefilm-Aufnahme und ⭬ -Projektion ist es wichtig, dass Ränder der aufeinanderfolgenden Bilder deckungsgleich vom Bildfenster in der Kamera/
im Projektor gerahmt werden. Aufgrund von Fertigungstoleranzen des Filmmaterials sowie des Spiels der Mechaniken in Kamera, Kopierwerk und Projektor wird das nie hundertprozentig gelingen. Der B. beschreibt, wie ruhig das projizierte Bild wirkt, ist also ein Maß für die Abbildungsqualität. Der B. einer Kamera wird getestet, indem man eine Gitterstruktur für mind. 30 s abfilmt, den Film zurückspult und das Gitter leicht verschoben nochmal aufnimmt (Kamera stabil montieren!); die Linien sollten sich in der Projektion nicht gegeneinander verschieben; wenn die Linien parallel bleiben, das Bild aber ›tanzt‹, muss der Projektor justiert werden. Das sollte man für jede Geschwindigkeit und jedes Filmmagazin separat testen. Testet man ⭬ Super-8, benötigt man einen Filmrückwickler und nutzt Material aus der Mitte der Kassette (ab ca. 3 m).
engl.: image steadiness
Blaupause
Bleichbadüberbrückung
Farbnegativfilmentwicklung (⭬ ECN-2- oder ⭬ C-41-Prozess) ohne Bleichbad – das Silber bleibt im Negativ, damit überlagert das Schwarzweißbild das Farbbild; resultiert in höherem Kontrast, geringerer Farbsättigung und deutlicherem Korn der kopierten Bilder; wenn das Ergebnis nicht gefällt, kann das Bleichen nachgeholt werden
Weiß man schon beim Fotografieren, dass man B. nutzen wird, sollte man zur Vermeidung ausgefressener Lichter die Aufnahmen etwa 1,5 Blenden unterbelichten (testen!).
Die B. wurde ›erfunden‹ von Kazuo Miyagawa (1908–1999) für den Film Otōto (Her Brother; 1960) des Regisseurs Kon Ichikawa (1915–2008) (↱ Quelle).
Lit.:
How Roger Deakins Conjured the Dystopian Darkness of 1984. criterioncollection via YouTube. 16. Jan. 2020. Online: ↱ youtube.com/watch?v=biSuar8ATAg [2024-07-27]
engl.: bleach bypass; skip bleach process; silver retention
Bleichen
Umkehrung der Entwicklung: Das dort durch Reduktion entstandene elementare Silber wird im Bleichbad wieder in eine Silberverbindung überführt.
Abhängig vom Grund des Bleichens lässt man lösliche oder unlösliche Verbindungen entstehen: Ist sie löslich diffundiert das Silber aus der fotogr. ⭬ Schicht, wird also entfernt (z. B. bei der Farb- und der Umkehrentwicklung). Enthält das Bleichbad ein Halogenid (z. B. Bromid), kann das Bild umentwickelt werden (Rehalogenisierung).
⚠: Beim B. immer Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und einen Laborkittel nutzen
Anwendung beim:
Abschwächen
s. a. ⭬ Farmerscher AbschwächerFarbschichten-Entwickeln
⭬ C-41-Prozess, ⭬ E-6-Prozess, ⭬ ECN-2-Prozess, ⭬ RA-4-ProzessTonen (⭬ Tonung):
Die Silbersalze reagieren im anschließenden Tonerbad zu farbigen Silberverbindungen.Umkehrentwickeln (⭬ Umkehrentwicklung):
Entfernen des Bildes aus der Erstentwicklung⭬ Verstärken von Negativen
engl.: bleaching; reducing
Blende, f-Zahl (Blendenzahl)
Die Blende ist ein Bestandteil des Objektivs zur Steuerung der Lichtmenge, meist in Form einer mechanischen Irisblende.
Die f-Zahl ist eine dimensionslose Verhältniszahl, die die Öffnung der Blende beschreibt:
f-Zahl = [Brennweite des Objektivs in mm] ÷ [Durchmesser der Blendenöffnung in mm]
Die Brennweite wird von der optischen Mitte des Objektivs (dort, wo sich die Lichtstrahlen kreuzen) aus gemessen. Dieser Punkt bewegt sich allerdings, wenn das Objektiv fokussiert wird; daher kann die durchfallende Lichtmenge bei gleicher Blendenzahl aber verschiedenen Entfernungseinstellungen etwas differieren.
Der Ring zur Einstellung der Blendenöffnung ist meist am Objektiv angebracht und mit den f-Zahlen beschriftet: je größer die f-Zahl, desto kleiner ist die Blendenöffnung.
Blendenreihe (f-Zahlen) in Drittelstufen:
…, 0.7, 0.8., 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 29, 32, 36, 40, 45, 51, 57, 64, 72, 80, 90, …Das ist (gerundet) eine geometrische Folge: Die f-Zahlen der ganzen Blendenstufen ergeben sich jeweils durch die Multiplikation mit dem Faktor √2.
Wird die Blende um eine ganze Stufe geschlossen bzw. geöffnet, halbiert bzw. verdoppelt sich die durchfallende Lichtmenge.
Neben der Steuerung der Lichtmenge hat die Blende auch eine wichtige gestalterische Funktion beim Fotografieren: sie bestimmt die Schärfentiefe, also die Ausdehnung des Bereichs vor und hinter der Schärfe-Ebene, der noch als ›scharf‹ wahrgenommen wird. Je offener die Blende (kleine f-Zahlen), desto mehr Licht fällt durchs Objektiv und desto geringer ist die Schärfentiefe.
engl.: f-stop; f-number
s. a. ⭬ T-Zahl
Bliss, Grüne Idylle
Bliss war das Standard-Hintergrundbild von Microsoft Windows XP (2001–2014) und gilt als die vielleicht meist gesehene Fotografie jemals.
Fotograf Charles O'Rear (* 1941) hat das Bild ca. 1996 im Napa Valley (nördl. San Francisco) mit einer Mamiya RZ67 auf Fujifilm aufgenommen.
Lit.:
Cain, Abigail: »The Story Behind the World’s Most Famous Desktop Background«. In: Artsy, 3. Juli 2017. Online: ↱ artsy.net/article/artsy-editorial-story-worlds-famous-desktop-background [2023-11-18]
Blitzbirnchen (hist.)
Blitzsynchronanschluss
Zweipolige Buchse an Kameras zum Anschluss des Synchronkabels von externen Blitzgeräten; übertragen wird nur das Zündsignal; standardisiert in ISO-Norm 519
Bei älteren Kameras häufig mit einem Schalter zur Auswahl der Blitzsynchronisation: X (Xenon; zündet nach Öffnen des Verschlusses) oder M (für Blitzbirnchen; zündet, bevor der Verschluss offen ist).
Es gibt auch Kameras mit nicht genormten Blitzsynchronanschlüssen.
Lit.:
ISO 519:1992, Photography – Hand-held cameras – Flash-connector dimensions (Ed. 2, 1992). Online: ↱ iso.org/standard/4582.html [2024-05-26]
s. a. ⭬ Blitzbirnchen; ⭬ Blitzwürfel; ⭬ Verschluss
engl.: PC [Prontor-Compur] connector
Blitzwürfel, Blitzbirnchen (hist.)
engl.: flashcube
Bokeh, ボケ味
engl.: Bokeh
Box (Kamera, Agfa; hist.)
Serie billiger ⭬ Boxkameras, die Agfa ab 1930 auf den Markt brachte (Agfa Camerawerk, München). Die Agfa-Boxen sind den damals äußerst erfolgreichen ⭬ Brownie-Kameras von Kodak frappierend ähnlich, v. a. der No. 2 Brownie (die erste für 120er-Rollfilm), die bis 1935 millionenfach hergestellt wurde.
»Immer aufnahmebereit – ohne lange Vorbereitungen und ohne das viele Drum und Dran von Rädchen und Skalen – das ist die Box. Man sieht in den Sucher, drückt auf den Auslösehebel, und dann ist eines der lebendigen Photos entstanden, das den Zauber eines Momentes festhält. Photographieren mit Agfa-Box ist kinderleicht, und es ist wirklich schwer, irgend etwas falsch zu machen.«
aus: Wir zeigen Ihnen … Firmenschrift Agfa D589/0533. o. D. [1933], S. 4
Lit.:
Götz, Hans-Dieter: Box-Cameras ; Made in Germany ; Wie die Deutschen fotografieren lernten. Gilching: vfv, 2002
engl.: box camera
s. a. ⭬ Brownie (Kodak); ⭬ Holga; ⭬ Toy camera
Boxkamera, Rollfilm-Kastenkamera, Schülerkamera (hist.)
B. ist der Oberbegriff für einfachst ausgestattete quaderförmige ⭬ Rollfilmkameras; eine Kameragattung, die bis in die 1950er-Jahre von verschiedenen Firmen gebaut wurde. Der Sucher ist ein kleiner ⭬ Brillantsucher, als Objektiv dient meist nur eine nicht fokusierbare ⭬ Meniskuslinse in hyperfokaler Montierung (scharf ab etwa 3 m; für manche B. gab es aufsteckbare ›Portraitlinsen‹) und die ⭬ Blende (ca. f/11) war üblicherweise ebenso fix wie die Verschlusszeit (ca. ¹⁄₃₀ s); allerdings meist mit der Möglichkeit, auf Langzeitbelichtung (B) umzuschalten.
Es gibt auch ein paar besser ausgestattete Modelle.

Bundespräsident Theodor Heuss auf der Photokina 1952. Vertreter der Fotoindustrie zeigen Werbematerial zu der Werbekampagne »Hast Du keine? – Box – Leih' Dir eine!«
(Foto: Dohm/StadtA Rt. S 105/5 Nr. 2123/30) 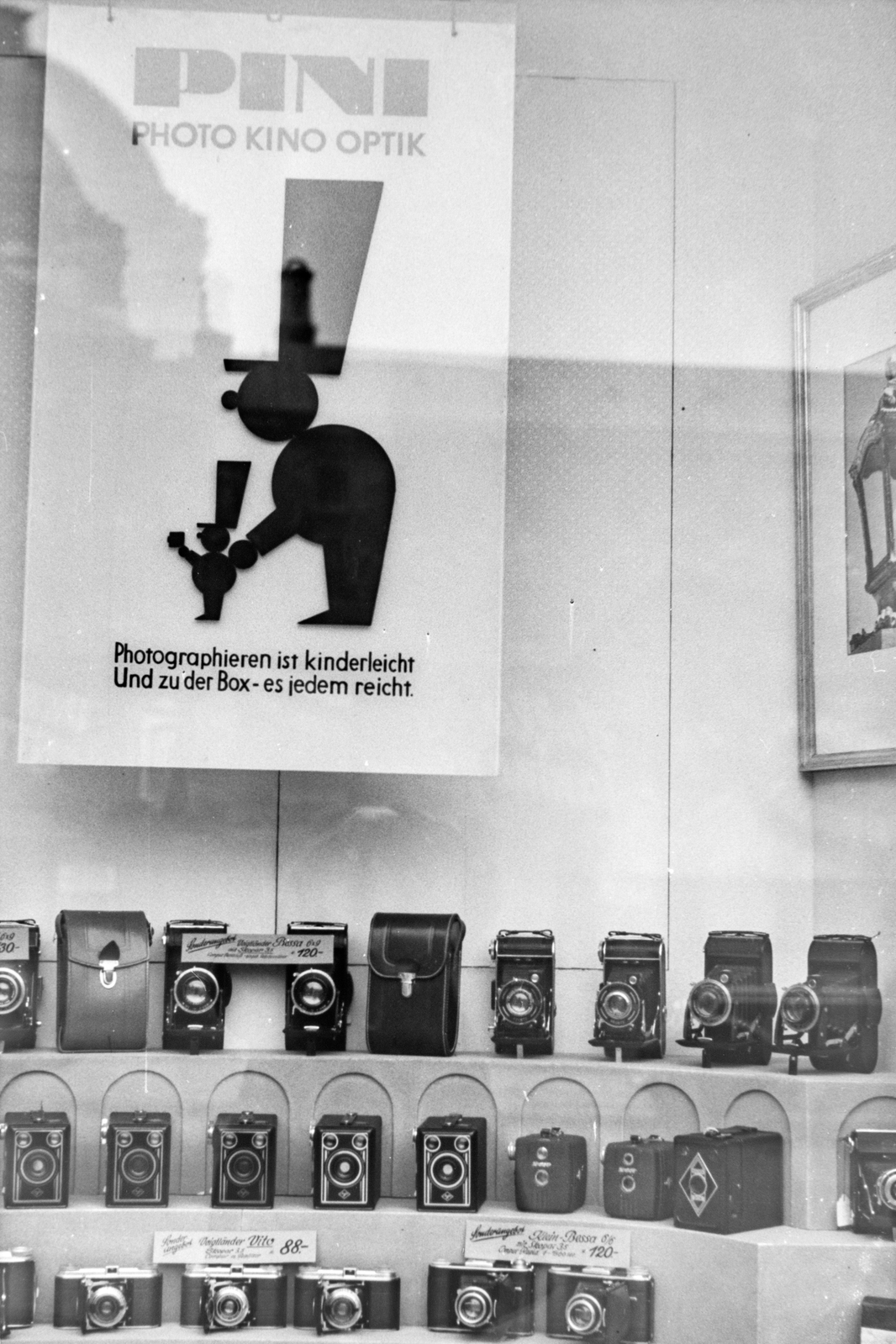
Werbeplakat für Boxkameras im Schaufenster eines Fotogeschäfts, 1950
(Foto: Dohm/StadtA Rt. S 105/5 Nr. 1403/11) 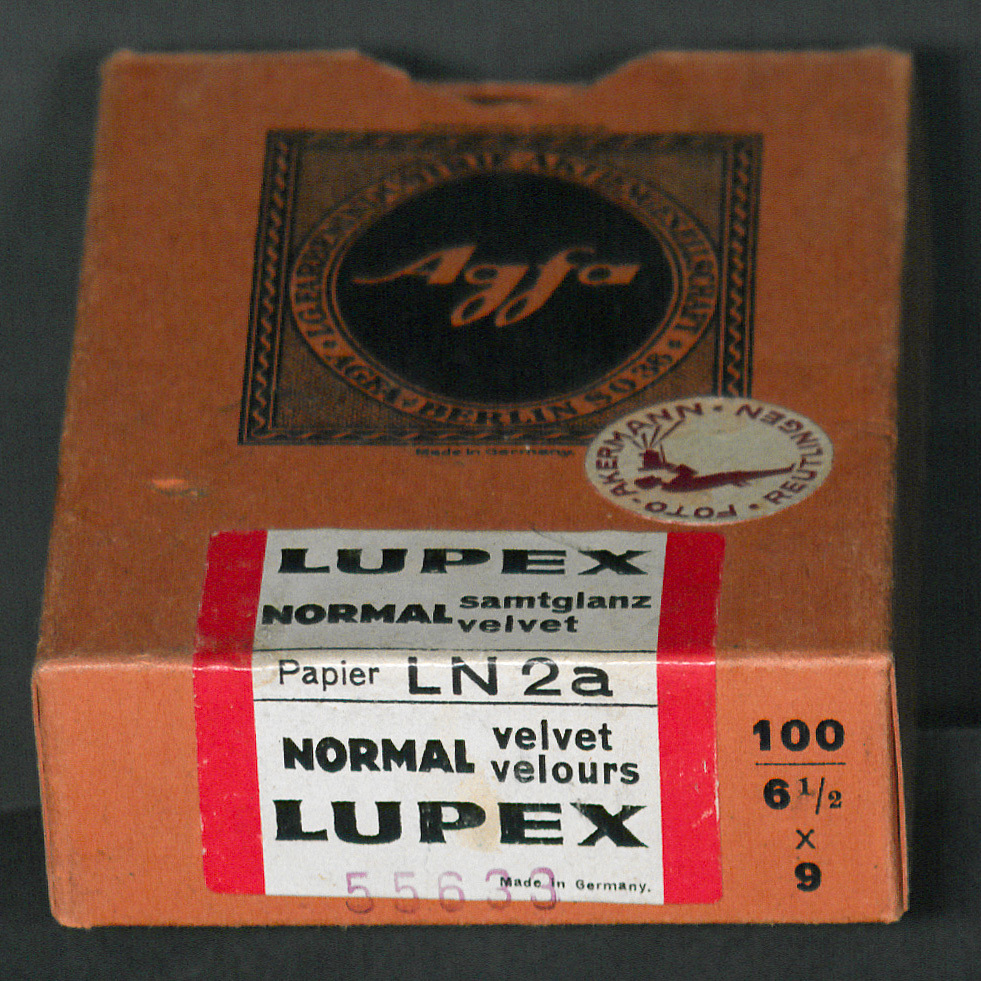
Die Rollfilm-Negative der Boxkameras wurden üblicherweise als ⭬ Kontaktkopien ausgearbeitet – eine mangelhafte technische Bildqualität trat dadurch etwas in den Hintergrund.
Hersteller von Boxkameras (Auswahl):
Agfa (Camera-Werk, München): viele Modelle, z. B. ⭬ Box
Balda (Max Baldeweg, Dresden): viele Modelle, z. B. Frontbox
Bilora (Kürbi & Niggeloh, Radevormwald): viele Modelle, z. B. Boy
EHO (Emil Hofert, Dresden): viele Modelle, auch eine Stereo-Box
Kodak: ⭬ Brownie, viele Modelle
Zeiss Ikon (Dresden, Berlin, Stuttgart): viele Modelle, z. B. Box Tengor
Lit.:
Götz, Hans-Dieter: Box-Cameras ; Made in Germany ; Wie die Deutschen fotografieren lernten. Gilching: vfv, 2002
engl.: box camera
s. a. ⭬ Holga; ⭬ Toy camera
box speed
Brillantsucher
Aufsichtssucher, meist bei einfachen Kameras
Die Kamera wird in Bauchhöhe gehalten, damit man von oben in den B. schauen kann. Das Sucherbild wird von einer einfachen Linse über einen Spiegel statt auf eine Mattscheibe in eine weitere Linse projiziert; das Sucherbild ist seitenverkehrt.
engl.: brilliant finder
Bromöldruck
Der Bromöldruck ist eines der kunstfotografischen ⭬ Edeldruckverfahren; er kombiniert – handwerklich gesehen – die Fotografie und die Malerei.
ausführlich beschrieben in Frech (2009)Lit.:
Frech, Martin: »Bromöldruck, ein fotografisches Edeldruckverfahren«. In: Notizen zur Fotografie. 3. Nov. 2009. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2009-11-03/Bromoeldruck.html [2022-06-10]
Brownie (Kamera, Kodak; hist.)
Serie billiger ⭬ Boxkameras, die Kodak ab 1900 ursprünglich für Schüler auf den Markt brachte; die Zielgruppe hat sich jedoch schnell ausgeweitet: Mit dieser Kamera-Serie hat Kodak den Massenmarkt für Fotoamateure geschaffen – daher ist die erste Brownie vielleicht die wichtigste Kamera aller Zeiten. Die letzte Kamera dieses Namens wurde in den 1980er-Jahren produziert; bis dahin gab es nahezu 100 Brownie-Modelle.
⚠: Nicht alle Brownies verwenden den ⭬ 120er-Rollfilm.
Schöne Übersicht von Chuck Baker:
↱ The Brownie Camera Page [2024-05-23]Lit.:
Gustavson, Todd: »The Brownie Legacy«. In: Gustavson (2009, S. 146 ff.) [⭬ Literatur]
s. a. ⭬ Box (Agfa); ⭬ Holga; ⭬ Toy camera
C
C-41-Prozess
Von Kodak definierter Prozess zur Entwicklung von Farbnegativ-Filmen; Nachfolger des C-22; Fuji nennt ihren zu C-41 kompatiblen Prozess CN-16, der von Agfa hieß AP-70 und der von ORWO ›Vorschrift 5860‹.
Prozessablauf:
- Entwicklung
- Stoppbad
- Bleichbad
s. a. ⭬ Bleichbadüberbrückung - Zwischenwässerung
- Fixierbad
- Schlusswässerung
- Stabilisierungsbad
Prozesstemperatur ist 37,8 °C (≙ 100 °F), kann aber bei Anpassung der Zeiten meist auf 30 °C reduziert werden. Auf das ⭬ Unterbrecherbad kann zu Lasten des ⭬ Fixierers verzichtet werden. Es gibt Chemie, bei der Bleich- und Fixierbad zu einem Bleichfix-Bad (blix) kombiniert sind.
Lit.:
- Agfacolor Process 70 Technische Daten A 26. Firmenschrift Agfa-Gevaert. o. D.
- Using Kodak Flexicolor Chemicals. Firmenschrift Kodak Z-131. o. D. [2017]. Online: ↱ imaging.kodakalaris.com/sites/default/files/wysiwyg/pro/chemistry/z131.pdf [2022-06-02]
- tl;dr:
Using Kodak Flexicolor Chemicals in a Small Tank. Firmenschrift Kodak CIS-211. Aug. 2010. Online: ↱ 125px.com/docs/techpubs/kodak/cis211-2010_08.pdf [2022-06-02]
C-Print (Typ-C-Print)
Negativ-Positiv-Farbprozess
⭬ nass ausgearbeitete analoge ⭬ Vergrößerung oder ⭬ Kontaktkopie auf ⭬ Color-Fotopapier
Der Begriff geht zurück auf Kodaks erstes chromogenes ⭬ Fotopapier »Type C«, das spätere Ektacolor-Papier (⭬ Chromogene Entwicklung).
Lit.:
Durniak, John: »Is the Color Revolution underway?« In: Popular Photography, Nr. 10, 1957. S. 100 ff. Online: ↱ archive.org/details/popular-photography-1957-10/page/100/mode/2up [2024-06-17]
Caffenol
Experimenteller ⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm zum Selbstansatz.
Lit.:
The Caffenol Cookbook & Bible. 2012. Online: ↱ caffenol.org/wp-content/uploads/2012/11/The-Caffenol-Cookbook-Bible-Recipes-and-Tutorials.pdf [2023-12-22]
Frech, Martin: »Filmentwicklung in Kaffee«. In: Notizen zur Fotografie. 30. Sept 2007. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2007-09-30/Filmentwicklung-in-Kaffee.html [2023-12-15]
Callier-Effekt
engl.: Callier effect
Camera Crackerstenopeica oder: Puttin’ On The Ritz
Der ital. Künstler Paolo Gioli (1942–2022) versah seine ⭬ Lochkameras gerne mit natürlich auftretenden Löchern, bspw. mit denen von Crackern.
Zeitgenössische Adepten nennen ihre davon inspirierten Kameras Cracker Cam, Cámara Galletita …
Camera obscura (dunkler Raum)
Völlig verdunkelter Raum mit einer kleinen Öffnung, die mit einer Linse versehen sein kann. Die Größe des Raums ist prinzipiell beliebig; hat er die Größe einer Pappschachtel und keine Linse, bezeichnet man die Konstruktion als ⭬ Lochkamera. Durch die Öffnung fällt das Licht von außen ein und wird auf die gegenüberliegende Wand/
Seite projiziert. s. a. ⭬ Lochkamera
Carbrodruck (Carbon-Bromid)
Negativ-Positiv-Verfahren (⭬ Pigmentdruckverfahren); Weiterentwicklung des ⭬ Kohledrucks zu einem subtraktiven Mehrfarben-Druckverfahren (Thomas Manly, 1905)
s. a. ⭬ Dye Transfer
Carte de Visite, CdV
Albuminabzug auf stabilem Karton, Format des Fotos meist 92 × 54 mm (hoch), Format des Kartons meist 105 × 65 mm (hoch); wurde ab Ende der 1850er-Jahre bis vor dem ersten Weltkrieg genutzt.
CdVs wurden sowohl von privaten Portraits in kleiner Auflage angefertigt, als auch verlegerisch als Sammelkarten vertrieben (z. B.Portraits von Prominenten), es gab entsprechende Einsteckalben
engl.: carte de visite
Carte cabinet, Cab
Albuminabzug auf stabilem Karton, Format des Kartons meist Postkartengröße (ca. 10 × 15 cm); wurde ab den 1860er-Jahre bis vor dem ersten Weltkrieg genutzt.
engl.: cabinet card
Celluloseacetat, CA
Cellulosenitrat ⚠, Nitrocellulose, Schießbaumwolle
Centerfilter
Spezieller konzentrischer ⭬ Grauverlaufsfilter, der den Lichtabfall eines Weitwinkelobjektivs zum Bildrand hin ausgleicht.
C. besitzen eine vom Zentrum zum Rand hin stetig abfallende Dichte und erreichen die volle Transparenz erst am Rand. Die meisten C. verzichten allerdings auf einen vollständigen Ausgleich des Helligkeitsabfalls, damit der Verlängerungsfaktor handhabbar bleibt.
Charakteristische Kurve
Chemigramm
Bild, das bei ›normalem‹ Licht mit Fotochemikalien direkt auf ⭬ Fotopapier ›gemalt‹ wird.
engl.: chemigram
Chemogramm (nach Josef H. Neumann, 1974)
engl.: chemogram
Chromogene Entwicklung
s. a. ⭬ C-41-Prozess (Stehbild-Negativ-Entwicklung); ⭬ E-6-Prozess (Umkehr-Entwicklung zum ⭬ Diapositiv); ⭬ ECN-2-Prozess (Kinefilm-Negativ-Entwicklung); ⭬ RA-4-Prozess (Positiv-Papier-Entwicklung)
Chromogener Schwarzweißfilm
Chromolytische Entwicklung
s. a. ⭬ Cibachrome
Chromoskedasic sabattier, Chromo
Verfahren zur Herstellung von farbigen Bildern auf Schwarzweiß-Fotopapier durch die Bearbeitung des Papiers mit fotochemischen Substanzen – ohne Farbpigmente oder farbige Tinten. Der Prozess wurde in den frühen 1980er-Jahren von Dominic Man-Kit Lam ausgearbeitet; die Benennung stammt von Bryant Rossiter und ist dem Griechischen entlehnt: τὸ χρῶμα (Gen. χρῶματος, Farbe) und ἡ σκέδασις (Zerstreuung).
Die Entstehung von Farben lässt sich durch die Mie-Streuung und die Lorenz-Mie-Theorie erklären.
↱ Beispielbilder bei Wolfgang Moersch [2024-07-26]
Lit.:
Man-Kit Lam, Dominic und Baran, Alexandra J.: »The Amateur Scientist ; Painting in Color without Pigments«. In: Scientific American, Bd. 265, Nr. 5, Nov. 1991. S. 136–138. Online via: ↱ jstor.org/stable/24938811 [2024-08-10]
Man-Kit Lam, Dominic und Rossiter, Bryant W.: »Chromoskedasic Painting«. In: Scientific American, Bd. 265, Nr. 5, Nov. 1991. S. 80–85. Online via: ↱ jstor.org/stable/24938800 [2024-08-10]
Crawford, Megan: Chromoskedasic Sabattier: a step-by-step guide. 2. Jan. 2018. Online: ↱ alternative
photography.com/chromo [2024-07-26]skedasic-sabattier-a-step-by-step-guide/
Cibachrome, Ilfochrome (Ilford; hist.)
Positiv-zu-Positiv-Farb-Prozess zur Herstellung von Papierbildern von ⭬ Diapositiven. Der C.-Prozess nutzt die ⭬ chromolytische Entwicklung; ⭬ Fotopapier auf Polyester-Basis mit eingelagerten Azofarbstoffen; C.-Prints sind langzeit-farbstabil. Seit 1963 am Markt, 1992 umbenannt in Ilfochrome, 2012 wurde die Produktion der C.-Materialien eingestellt.
CineStill Film
US-amerik. Firma, die Kodak-Kinefilm für die fotografische Nutzung und die ⭬ Crossentwicklung im ⭬ C-41-Prozess bearbeitet und umkonfektioniert. Die einzelnen Bilder sind daher nicht numeriert (⭬ Keykode, ⭬ Randnummern) und den Farbnegativfilmen fehlt die ⭬ Lichthofschutzschicht.
Website: ↱ cinestillfilm.com [2024-07-27]
Lit.:
Frech, Martin: »Kinefilm im Fotoapparat (z. B. via Cinestill): EASTMAN KEYKODE Numbers statt Bildnummern«. In: Notizen zur Fotografie. 7. Sep. 2017. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2017-09-07/Kinefilm-im-Fotoapparat.html [2022-06-04]
CMYK
Cyan | Magenta | Gelb (yellow) | Schwarz (key)
Prozessfarben in der Drucktechnik
s. a. ⭬ Farbauszug
Color-Fotopapier (lat. color: Farbe)
Negativ-Positiv-Farbprozess
⭬ PE-Fotopapier für Farbvergrößerungen (⭬ C-Prints); nur noch für die Entwicklung im ⭬ RA-4-Prozess verfügbar
Lit.:
Frech, Martin: »Kodak Endura vs. Fujifilm Crystal Archive.« In: Notizen zur Fotografie. 23. Mai 2017. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2017-05-23/Kodak-Endura_vs_Fujifilm-Crystal-Archive.html [2022-04-08]
Cromalin (DuPont; hist.)
Negativ-Positiv-Verfahren
⭬ Pigmentdruckverfahren zur Herstellung lichtechter farbiger Papierbilder aus ⭬ gerasterten ⭬ CMYK-⭬ Farbauszügen: Diese werden passgenau (⭬ Pinregistrierung) in der Reihenfolge Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz nacheinander via UV-Licht auf je eine klebrige Fotopolymerschicht belichtet, die dadurch partiell ihre Klebrigkeit verliert. Nach jeder Belichtung wird der klebrig gebliebene Teil der Schicht (die opaken Rasterpunkte verhinderten die Belichtung) mit der entsprechenden Farbe gefärbt und darüber eine neue Schicht aufgebracht.
Das Cromalin-Verfahren diente vor allem zur Herstellung von Prüfdrucken (Proof) in Reproanstalten und war der entsprechende Industriestandard im analogen Zeitalter.
s. a. ⭬ Farbauszug
Crossentwicklung
Entwicklung eines Farbfilms in einem nicht dafür vorgesehenen ⭬ Entwickler; i. e. S. die Entwicklung eines ⭬ Diafilms im ⭬ C-41-Prozess.
Die Resultate (meist höhere Kontraste und Farbverschiebungen) sind jedoch schwer vorhersehbar und unterscheiden sich von Film zu Film. Die für den Film angegebene ⭬ Empfindlichkeit gilt nicht für eine C.; daher sollte man Belichtungsreihen zur Ermittlung des ⭬ E I durchführen.
Ein Sonderfall der C. ist die Entwicklung von Kinefilm im ⭬ C-41-Prozess statt im ⭬ ECN-2-Prozess (z. B. ⭬ CineStill Film).
Lit.:
- “Cross-Processing” Color Negative Films in Process E-6. Firmenschrift Kodak CIS-184. Juli 1999.
engl.: cross processing
Cyanotypie, Eisenblaudruck, Blaupause
Negativ-Positiv-Prozess
simpler fotogr. Prozess ohne Silber: Ein Träger (Papier, Textil; kann für eine feinere Oberfläche mit Eiweiß oder Stärke grundiert sein) wird beschichtet mit der Mischung aus Eisenammoniumcitrat (= Ammoniumeisen(III)-citrat; ammonium ferric citrate; C₆H₈O₇ · nFe · nH₃N) – die grüne Variante gibt bessere Ergebnisse als die braune – und Rotem Blutlaugensalz (= Kaliumhexacyanidoferrat(III); potassium ferricyanide; C₆FeK₃N₆). Diese Schicht ist für UV-Licht empfindlich.
Chemisch findet folgende Redoxreaktion statt:
Die Citrat-Anionen werden durch die Eisen(III)-Ionen oxidiert, welche dabei zu Eisen(II) reduziert werden. Die Eisen(II)-Ionen reagieren dann mit dem Blutlaugensalz, wodurch das Berliner Blau entsteht, nach dem das Verfahren benannt ist.
Erstaunlicherweise gibt es über hundert Rezepturen, die beiden Chemikalien zu mischen. Die klassische Mischung besteht aus zwei Lösungen, die erst vor der Verwendung zu gleichen Teilen gemischt werden:
Lösung A:
20 g Eisenammoniumcitrat in 100 ml dest. Wasser
Die Lösung kann schimmeln; die Zugabe von Franzbranntwein oder Thymol verhindert das.Lösung B:
10 g Rotes Blutlaugensalz in 100 ml dest. Wasser
Seit 1994 gibt es eine neue Rezeptur, in dem das Eisenammoniumcitrat durch Ammoniumtrioxalatoferrat(III) ersetzt wird. Da sich dabei das schwerlösliche Salz Kaliumtrioxalatoferrat(III) bildet, ist der Ansatz etwas aufwendiger.
Cyanotypien werden als ⭬ Kontaktkopien hergestellt; belichtet wird unter Sonnenlicht oder einer UV-Lampe. Danach muss nur noch gewässert werden, um die unbelichtete Chemie zu entfernen; ein abschließendes Bad in verdünnter Salzsäure (vielleicht besser: Essigsäure) stabilisiert das Bildweiß. Übrig bleibt das stabile (negative) Bild aus dem wasserunlöslichen Berliner Blau.
Durch ⭬ Bleichen mit stark verd. Salpetersäure und Natriumcarbonat sowie ⭬ Rückentwickeln mit Gerbsäure (Gallussäure) wird aus dem blauen ein schwarzes Bild.
Die C. wurde 1842 von Sir John Herschel (1792–1871) entwickelt und kurz darauf von Anna Atkins (1799–1871) genutzt, die damit die ⭬ Fotogramme ihres Buchs Photographs of British Algæ. Cyanotype Impressions ›druckte‹ (⭬ Print) und en passant das erste Fotobuch vorlegte.
Zeitgenössische künstlerische Positionen, die den Cyanotypie-Prozess nutzen:
↱ Kasia Kalua Kryńska: Blue Moon Garden [2024-06-30]
↱ Katja Liebmann: Berlin Ride [2024-06-30]
↱ Melanie Schöniger: vivid [2024-06-30]
↱ Brett Day Windham: Cyanotypes (koloriert) [2025-05-25]
Nette Demonstration der C. von Thomas Bachler: »Fotografieren mit Licht? Die Cyanotypie macht es möglich!« via riesa efau/
YouTube. 3. Mai 2020. Online: ↱ youtube.com/watch?v=5za8ZK3zHUk [2024-08-04] Lit.:
Atkins, Anna: Photographs of British Algae. Cyanotype Impressions 1843 – 1853. Online: ↱ hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.651907 [2022-12-30]
wenn der ›offizielle‹ Link nicht funktioniert, dann via: ↱ rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-F-2016-133 [2022-12-30]Porkkala, Jalo: Tests in blue – papers for cyanotypes. [Übersicht geeigneter Papiere]. 4. März 2021. Online: ↱ alternative
photography.com/tests-in-blue-papers-for-cyanotypes/ [2022-12-30]
engl.: cyanotype, blueprint process
D
D-19 (Kodak-Rezeptur)
⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm auf Basis Metol und ⭬ Hydrochinon ⚠; ursprünglich für Röntgenfilme und technische Anwendungen; erzeugt hohe Kontraste und dichte Negative; gut für Negative, die für ⭬ alternative Prozesse kopiert werden sollen. Unproblematisch im Selbstansatz.
Vergleichbares konfektioniertes Produkt (allerdings ⭬ Hydrochinon ⚠/
Phenidon): Foma Fomadon LQR (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]) D-23 (Kodak-Rezeptur)
⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm; simple Alternative zu ⭬ D-76; enthält nur Metol (⭬ Entwicklersubstanz) und Natriumsulfit (Schutzsubstanz und Beschleuniger); unproblematisch im Selbstansatz:
- Erwärme 500 ml Wasser auf ca. 50 °C.
- Löse separat 7,5 g Metol in etwas Wasser auf; vorher ein wenig Natriumsulfit zugeben, damit das Metol nicht vorzeitig oxydiert.
- Füge die Metol-Lösung dem halben Liter Wasser zu.
- Löse separat 100 g Natriumsulfit in etwas Wasser auf.
- Füge die Natriumsulfit-Lösung der Metol-Lösung zu.
- Fülle mit Wasser auf 1 l auf.
Als Anhaltspunkt für die Entwicklungszeit taugt die entsprechende Zeit für ⭬ D-76.
Unverdünnt kann D-23 für ungefähr 100 KB-Filme pro ca. 4 Liter wiederverwendet werden ohne die Entwicklungszeit anzupassen, wenn die Lösung mit 22 ml DK-25R pro KB-Film regeneriert wird.
Werden 60 g Natriumbisulfit zu obiger Rezeptur hinzugefügt erhält man den Feinkornentwickler D-25.
D-23 eignet sich auch als ⭬ Zweibadentwickler (DD-23, Divided D-23).
Lit.:
Troop/
Anchell (2020), S. 53 f. [⭬ Literatur]
D-72 (Kodak)
D-76 (Kodak)
proprietärer ⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm auf Basis Metol und ⭬ Hydrochinon ⚠
D-76 ist der wohl wichtigste Negativentwickler überhaupt und wird noch immer viel genutzt.
↱ Datenblatt [2022-07-23]
D-76 eignet sich auch als ⭬ Zweibadentwickler (DD-76, Divided D-76).
D-76 H ist ein wirkungsgleiche Rezeptur ohne ⭬ Hydrochinon ⚠ und damit umweltfreundlicher (nur Metol, Natriumsulfit und Borax). Das H steht für Dr. Grant Haist (1922–2015, einflussreicher Chemiker bei Kodak sowie Fotograf).
Die Variante D-76 h (kleines h) gilt als Feinkornentwickler, enthält allerdings wieder ⭬ Hydrochinon ⚠.
D-76 E ist ebenfalls ein wirkungsgleiches umweltfreundliche Rezeptur von Chris Patton ohne ⭬ Hydrochinon ⚠.
Rezeptur für 1 l D-76 E:- 0,2 g Phenidon
- 100 g Natriumsulfit
- 8 g Vitamin C
- 12 g Borax
- F19 war die ORWO-Variante.
vergleichbare aktuelle Produkte sind Adox D-76 Classic (↱ Webseite d. Herstellers), Adox D-76 Eco (↱ Webseite d. Herstellers), Foma Fomadon P (↱ Webseite d. Herstellers [2022-07-27]) und Ilford ID-11 (↱ Datenblatt [2022-07-27]).
Lit.:
»Elon-Hydroquinone-Borax-Developer ; For Greatest Shadow Detail on Panatomic Films [Formula D-76]«. In: Eastman Professional Films. Kodak-Firmenschrift. 1936. S. 13
Troop/
Anchell (2020), S. 51 ff. [⭬ Literatur]
D-96 (Kodak)
Schwarzweiß-Negativentwickler, ähnlich wie ⭬ D-76; wird hauptsächlich für die Entwicklung von Kinefilm verwendet.
D-Print; evtl. ⭬ vegan
Sammelbezeichnung für Bilder aus digitalen Daten; kann eine Ausbelichtung auf ⭬ Fotopapier sein, ein Tintenstrahl-Druck, …
Daguerreotypie
Dektol (Kodak)
proprietärer ⭬ Entwickler für ⭬ Silbergelatine-Fotopapier; entspricht D-72
enthält ⭬ Hydrochinon ⚠
Delta-Kristall-Film, Core-Shell-Film (Ilford)
Ilfords Typ-Bezeichnung für deren ⭬ Flachkristallfilme (Delta 100, Delta 400, Delta 3200).
Densitometer
Dia-AV, Tonbildschau (hist.)
↱ Steven Michelsen zeigt auf YouTube Videos historischer Dia-AV-Schauen: ↱ youtube.com/@AV_archaeology/videos.
engl.: multi-image slide show
Diabetrachter, Gucki
Gerät zum vergrößerten Anschauen gerahmter ⭬ Diapositive
engl.: slide viewer
s. a. ⭬ View-Master
Diafilm
Direkt-Positiv-Prozess
Liefert nach dem Entwickeln ein schwarzweißes oder farbiges ⭬ Diapositiv
Jeder Schwarzweißnegativfilm kann zum Dia ⭬ umkehrentwickelt werden (vorzugsweise solche mit klarem Träger, vgl. z. B. ⭬ Scala); als Farbdiafilme gibt es Stand 2024 von Kodak den ⭬ Ektachrome E100 (↱ Webseite d. Herstellers [2022-07-27]; ↱ Datenblatt [2022-07-27]) sowie von Fuji FUJICHROME Velvia 50, Velvia 100 und PROVIA 100F (↱ Webseite d. Herstellers [2022-07-27]); alle zur Entwicklung im ⭬ E-6-Prozess.
engl.: slide film, reversal film, transparency film
s. a. ⭬ Scala, ⭬ Diapositiv, ⭬ Kodachrome, ⭬ Umkehrentwicklung
Diafine
Echter aber proprietärer ⭬ Zweibadentwickler für Negative aus kontrastreichen Aufnahmesituationen, der in Pulverform zum Ansatz von zwei separaten Bädern geliefert wird: Bad A enthält die ⭬ Entwicklersubstanzen ⭬ Hydrochinon ⚠/
Phenidon und Bad B das Alkali (Natriumsulfit); die angesetzten Lösungen halten sehr lange, die Empfindlichkeitsausnutzung ist gut. Auf ⭬ Vorwässern sollte man verzichten, damit sich die fotogr. ⭬ Schicht in Bad A so richtig ›vollsaugen‹ kann. Die meisten Filme werden nacheinander für jeweils 3 Minuten in den beiden Bädern entwickelt (auf keinen Fall Zwischenwässern, dann ginge ja der Entwickler verloren, bevor der Beschleuniger wirkt). Die Badtemperatur darf zwischen 20 °C und 30 °C liegen, ohne dass dies das Bildergebnis nennenswert verändert – sehr praktisch; auch eine Verlängerung der Entwicklungszeiten wirkt sich kaum aus.
enthält ⭬ Hydrochinon ⚠
Diapositiv, Dia (griech. δία: durch)
Transparentes Steh- oder Bewegtbild (»Film«); muss zum Betrachten durchleuchtet werden (⭬ Projektion, Leuchtkasten)
s. a. ⭬ Autochrome-Verfahren; ⭬ Diafilm; ⭬ Diaprojektor
engl.: slide (wenn gerahmt), transparency
Diaprojektor, Diaskop, Bildwerfer
Gerät zur ⭬ Projektion gerahmter ⭬ Diapositive
engl.: slide projector
Dichroitischer Schleier
Bildfehler auf Film oder Fotopapier: Feine Silberschicht, die sich während des ⭬ Entwicklungsprozesses auf der Oberfläche des Films abgelegt hat; erscheint bräunlich im Durchlicht und grün-/
gelblich im Auflicht. Der Dichroitische Schleier entsteht entweder durch die Entwicklung in einem stark gebrauchten, mit ⭬ Fixierer verunreinigten ⭬ Entwickler, evtl. in Verbindung mit einem schon alkalischen ⭬ Unterbrecherbad, oder in einem erschöpften Fixierbad.
Wenn man ihn rechtzeitig auf dem noch nassen Film bemerkt, kann der Silberbelag durch Abreiben leicht vom Negativ entfernt werden.
Ist der Film bereits getrocknet, kann der Belag auch nach erneutem Wässern nicht mehr mechanisch entfernt werden; dann hilft nur noch abschwächen oder ⭬ bleichen/
⭬ rückentwickeln. Dichroitischer Schleier auf Fotopapier kann nicht entfernt werden.
Lit.:
Fritsche, Kurt: Fotofehlerbuch. 9., verb. Aufl. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1976
Matthias, Robert: Verarbeitungsfehler im Schwarzweiß-Negativprozeß. 2. Aufl. Leverkusen: Firmenschrift der Agfa-Gevaert, 1974
Matthias, Robert: Verarbeitungsfehler im Schwarzweiß-Positivprozeß. 2. Aufl. Leverkusen: Firmenschrift der Agfa-Gevaert, 1974
engl.: dichroic fog
Dichte
engl.: density
Diffusionsfilter, Nebelfilter
Optische Filter, die Lichthöfe und Überstrahlungen ergeben, sowie den Kontrast und die Auflösung reduzieren.
Anwendungen z. B. in der Portrait-Fotografie oder bei Nachtaufnahmen; aber auch, um zu perfekten Objektiven einen Look zu entlocken.
Diagramm dazu von Tiffen: ↱ Triangle of Diffusion [2023-01-03]
↱ Bildbeispiele bei Schneider (runterscrollen) [2023-01-03]
s. a. ⭬ Orton-Effekt
engl.: diffusion filter
DIN-Wert
Diptychon
Disc-Film (Kodak; hist.)
⭬ Kleinstbildfilmformat von Kodak; 1982 eingeführt als Nachfolger für das Pocket-System (Kodak ⭬ Film-Typ 110); 15 Negative (Aufnahmeformat 8 × 10,5 mm) auf einer Scheibe (⌀ 65 mm) in einer 7 mm flachen Kassette
Filme wurden produziert von 1982 bis 1998, Kameras bis 1990
Gute Zusammenfassung: Our Own Devices: SHORT: Kodak Disc Cameras (2024-04-03). Video, YouTube: ↱ youtube.com/watch?v=0rjUDVZVoFc [2024-04-04]
Lit.
Hèrm, Hofmeyer: Fresh New Kodak Disc Film. [DIY-Anleitung] 24. Aug. 2020. Online: ↱ sites.google.com/view/fresh-kodak-disc-film/home [2022-04-28]
Dokumentenfilm, Hochauflösungsfilm
Film für Mikrofotografie; steile ⭬ Gradation (sehr kontrastreich), feinkörnig, hochauflösend, geringempfindlich, erreicht hohe Dichte
Typgerecht entwickelt haben D. einen geringen Tonwertumfang; kann durch angepasste Entwicklung, evtl. mit Spezialentwicklern (z. B. Tetenal Neofin doku), ›weicher‹ entwickelt und für die bildmäßige Fotografie genutzt werden.
z. B. Adox CMS 20 (⭬ orthopanchromatisch; ↱ Datenblatt [2024-07-27]); Rollei Ortho 25 (⭬ orthochromatisch; ↱ Datenblatt [2024-07-27]) und Kodak Ektagrafic Slide HC (hist.); Kodalith Ortho (hist.); Kodak Technical Pan (hist.); Maco Orth 25 (hist.)
![© Martin Frech: Kodak Technical Pan, Meterware Eine ungeöffnete Originalverpackung Kodak Techical Pan (Meterware, 35 mm, 150 ft); zu entwickeln bis 08/[19]98. Foto: © Martin Frech](https://dpfs.api.medienfrech.de/3ca7983755894c0a.best.jpg)
Kodak Technical Pan, ⭬ Meterware
s. a. ⭬ Strichfilm
Drahtauslöser
Mechanischer Fernauslöser für ⭬ Kameraverschlüsse; wird meist in den Auslöser eingeschraubt; bei elektronisch gesteuerten Kameras kann die Befestigung auch an einer anderen Stelle sein. Wird üblicherweise verwendet, wenn die Kamera auf einem Stativ befestigt ist, um Vibrationen beim Auslösen zu minimieren; steigert die technische Bildqualität.
Kameraseitig gibt es (mind.) zwei Anschlüsse: Innen- oder Außengewinde.
engl.: cable release
Dreifarbenfotografie, Trichromie
Das Prinzip aller praktischen Farbfotografie: Herstellung eines Farbbilds durch die Mischung der Grundfarben Rot, Grün und Blau (additive Verfahren) oder Cyan/
Blaugrün, Magenta/ Purpur und Gelb (subtraktive Verfahren). I. e. S.: Drei separate Schwarzweißaufnahmen (die sog. ⭬ Farbauszüge) werden durch rote, grüne und blaue ⭬ Farbfilter angefertigt; zum Betrachten werden diese zur farbigen Darstellung passgenau übereinander projiziert (additive Dreifarbenprojektion); oder im Bildbearbeitungsprogramm kombiniert.
engl.: three-color process, trichromy
Lit.:
Crofts, Jack: Trichromes – Colour Photos with Ilford HP5. 15. Juli 2021. Online: ↱ https://www.ilfordphoto.com/trichromes-colour-photos-with-ilford-hp5/ [2023-03-16]
s. a. ⭬ Farbauszug
Dunkelkammer
Rotlichtbezirk für die Praktiker der ⭬ emulsionsbasierten Fotografie, Teil eines ⭬ Fotolabors; siehe dort
Meggan Gould: darkrooms (seit 2023). Online: ↱ meggangould.net/darkrooms/ [2024-08-04]
engl.: darkroom
Dunkelkammerlampe
s. a. ⭬ Schleiertest
engl.: darkroom lamp
Dunkelkammerleuchte
s. a. ⭬ Schleiertest
engl.: safelight
Dunkelsack, Wechselsack
engl.: changing bag
Duplikatfilm
Umkehrfilm mit feinem Korn, reduziertem Kontrast und geringer ⭬ Empfindlichkeit zur Herstellung von ⭬ Diapositiv-Kopien – z. B. Agfachrome CRD (↱ Datenblatt [2024-07-27]); Fujichrome CDU (CDU II wurde bis 2009 produziert; ↱ Datenblatt [2024-07-27]); Kodak Ektachrome Slide Duplicating Film (EDUPE; wurde bis März 2010 produziert als Nachfolger der Filme SO-366 (Tageslicht) und 5071 (3200 K); ↱ Datenblatt [2024-07-27]).
Zum Duplizieren von Schwarzweißnegativen gab es Direktpositiv-Schwarzweißfilme, z. B. von Agfa den Dia Direct (auch ⭬ Agfa Scala eignet sich) oder von Kodak den Professional B/W Duplicating Film SO-132 (↱ Datenblatt).
Zum Duplizieren gab es spezielle Geräte (slide copier) mit einer filterbaren Beleuchtungseinrichtung (Blitz- oder Dauerlicht) und einer Vorrichtung zur Kontrastminderung (falls man regulären Film zum Duplizieren verwendet); z. B. den Illumitran slide copier von Bowens.
D. wurde wegen des geringen Kontrasts gelegentlich auch für Portraitfotografie verwendet.
s. a. ⭬ Zwischennegativ
engl.: duplicating film
DX-Codierung (digital index)
Von Kodak definierte maschinenlesbare Codierung von ⭬ Filmempfindlichkeit, Filmlänge und Belichtungsspielraum der Schicht auf Filmpatronen: Ein Schachbrettmuster im CAS-Code für Kameras (Camera Auto Sensing Code) und ein Barcode für Entwicklungsmaschinen.
Kann die Kamera keinen DX-Code lesen, wird üblicherweise ISO 100/21° angenommen; es gibt allerdings Kameras (z. B. Nikon F65), die das Einlegen des Films verweigern, wenn der DX-Code auf der Filmpatrone fehlt.
Lit.:
Frech, Martin: »DX-Code ändern«. In: Notizen zur Fotografie. 10. Dez. 2007. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2007-12-10/DX-Code-aendern.html [2024-05-30]
Dye Transfer (Kodak; hist.)
Negativ-Positiv-CMY-Farb-Umdruck-Verfahren von Gelatine-Reliefs; eine Weiterentwicklung des ⭬ Carbrodruckverfahrens; Details erklärt ein Meister in Ctein [o. D.]
Lit.:
Ctein: What is Dye Transfer?. o. D. Online: ↱ ctein.com/dyetrans.htm [2024-08-01]
Doubley, David: Dye Transfer Archives. Online: ↱ daviddoubley.com/DyeTransfer.htm [2024-08-01]
Kodak Dye Transfer Process. Firmenschrift Kodak E-80. o. D.
E
E-6-Prozess
Von Kodak definierter ⭬ chromogener Prozess zur Entwicklung von ⭬ Ektachrome-Farbdiafilmen und kompatiblen (⭬ Diafilm); Fuji nennt ihren zu E-6 kompatiblen Prozess CR-56, der von Agfa hieß AP-44.
Lit.:
- Agfacolor Process 44 Technische Daten A 36. Firmenschrift Agfa-Gevaert. o. D.
ECN-2-Prozess (Eastman Color Negative)
Von Kodak definierter ⭬ chromogener Prozess zur Entwicklung von Farbnegativ-Kinefilmen; als Nachfolger für ECN 1974 eingeführt mit dem Filmmaterial Eastman Color II Negative, Typ 5247/
7247 .Lit.:
Flueckiger, Barbara: Timeline of Historical Film Colors. 2012 ff. Online: ↱ filmcolors.org/timeline-entry/1406/ [2024-06-09]
Processing Kodak Motion Picture Films, Module 7 ; Process ECN-2 Specifications. Firmenschrift Kodak H-24.07. 2020. Online: ↱ kodak.com/content/products-brochures/Film/Processing-KODAK-Motion-Picture-Films-Module-7.pdf [2020-06-04]
ECO 4812 (Moersch)
proprietärer ⭬ Entwickler für ⭬ Silbergelatine-Fotopapier
ohne ⭬ Hydrochinon ⚠
↱ Webseite d. Herstellers mit Beispielbildern
Edeldruckverfahren, kunstfotografische
Sammelbegriff für verschiedene Negativ-Positiv-Verfahren aus dem späten 19. Jh. zur Herstellung von Bildern mit ›künstlerischer‹ Anmutung von einem fotografischen Negativ (zur Bewegung der Kunstfotografen siehe Frech [2014]).
⭬ Gummidruck (zur Herstellung von Einzelblättern; kein Druckverfahren)
Lichtdruck
⭬ Platindruck (zur Herstellung von Einzelblättern; kein Druckverfahren)
Lit.:
Frech, Martin: »Die Phase des Pictorialismus in der Geschichte der Fotografie«. In: Notizen zur Fotografie, 17. Mai 2014. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2014-05-17/Pictorialismus-in-der-Geschichte-der-Fotografie.html [2024-07-27]
Heidtmann, Frank: Kunstphotographische Edeldruckverfahren heute. Berlin: Berlin-Verlag, 1978. ISBN 3-87061-183-9
E I, exposure index
Eine von der ⭬ Nennempfindlichkeit des gegebenen Films abweichende Empfindlichkeitseinstellung am ⭬ Belichtungsmesser
Wenn z. B. ein ISO 400/27°-Film wie ein ISO 200/24°-Film belichtet wird (1 Blende Überbelichtung), wird dieser mit einem E I von 200 belichtet.
s. a. ⭬ Filmempfindlichkeit
Lit.:
ISO vs EI Speed Ratings for Kodak Films. Firmenschrift Kodak CIS-185. Nov. 1996. Online: ↱ 125px.com/docs/techpubs/kodak/cis185-1996_11.pdf [2022-09-09]
engl.: exposure index, speed setting
Einbad Fixierentwickler, Einbadentwickler, Monobad
Wie der Name schon sagt: ⭬ Entwickler, der den ⭬ Fixierer enthält; nach dem Monobad muss nur noch gewässert werden; das geht schnell, da das Monobad eine alkalische Lösung ist.
Einbad Fixierentwickler sind Voraussetzung für die ⭬ Sofortbild-Fotografie und nützlich, wenn man ein paar Minuten Fixierzeit einsparen möchte, die Bildqualität aber eine untergeordnete Rolle spielt; z. B. früher bei der Zielfotografie im Sport.
Die Rezeptur ist so abgestimmt, dass der Entwickler fertig ist, bevor der Fixierer übernimmt. Soll das perfekt funktionieren, müsste für jede fotogr. ⭬ Schicht ein spezielles Monobad zusammengestellt werden. Für die Chemie-Paste in den Sofortbild-Filmen wird das so gemacht.
Die üblichen Monobad-Rezepturen sind jedoch ein Kompromiss: Alle Filme bekommen dieselbe Entwicklungszeit, egal, wie lange man den Film darin badet (da nach wenigen Minuten nur noch der Fixierer wirkt). Daher funktionieren die üblichen Monobäder eher mit gering- bis mittelempfindlichen Filmen. Die Temperatur spielt eine Rolle; damit kann man experimentieren.
Will man unbedingt ein Monobad verwenden – z. B. auf Reisen – ist es sinnvoll, verschiedene Filme damit zu testen (jeweils mit Belichtungsreihen, um den optimalen ⭬ EI zu finden) und den zu verwenden, der am besten zum gewählten Monobad passt.
proprietäre Produkte:
- FPP Super MonoBath BW Developer (Pulver oder flüssig)
enthält ⭬ Hydrochinon ⚠
↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27] - Df 96 (⭬ CineStill Film)
nicht verwechseln mit ⭬ D-96!
enthält ⭬ Hydrochinon ⚠
↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27] - Monotenal, Monophen (Tetenal; hist.)
Rezeptur nach Donald Qualls (2004-09-10 auf rec.photo.darkroom; via ↱ covington
innovations.com/hc110 [2024-07-27]):- 32 ml ⭬ HC-110 (enthält ⭬ Hydrochinon ⚠)
- 100 ml Ammoniak
- 20 ml Ilford Rapid Fixer
- auf 500 ml auffüllen mit Wasser
- sofort verwenden
Rezeptur nach Geoffrey Crawley (FX 6a, danke ↱ John Finch [2025-08-22]; wird auch kommerziell als Fertigprodukt vertrieben.)
- 700 ml Wasser (~40 °C)
- 50 g Natriumsulfat (wasserfrei, Na₂SO₄)
- 12 g ⭬ Hydrochinon ⚠ (⭬ Entwickler)
- 1 g Phenidon (⭬ Entwickler)
- 10 g Natriumhydroxid (NaOH); ⚠ vorsichtig sein: Handschuhe und Schutzbrille verwenden
- 70 g (mehr Kontrast) bis 120 g (weniger Kontrast) Natriumthiosulfat (Na₂S₂O₃, Fixiersalz)
- auf 1 l mit Wasser auffüllen
- abkühlen lassen auf 20 °C und sofort verwenden (gut für etwa zehn Filme)
- kein Vorwässern; Prozesszeit: ~ 6 min; bewährter Kipprhythmus: die ersten 30 s kontinuierlich, dann alle 30 s 10 s kippen.
- Sind die Negative zu dünn, Badtemperatur erhöhen, damit der Entwickler kräftiger wirkt.
- Die ⭬ Filmempfindlichkeit wird nicht ausgenutzt: reichlich belichten
engl.: monobath
Lit.:
Anchell (2016), S. 56 ff. [⭬ Literatur]
Haist, Grant: Monobath Manual. Hastings-On-Hudson N. Y.: Morgan & Morgan, 1966
- FPP Super MonoBath BW Developer (Pulver oder flüssig)
Einwegkamera
Eisenblaudruck
Eiweißlasurfarbe
Eine nicht deckende pigmentierte Farbe zum ⭬ Ausflecken und Retuschieren auf ⭬ Fotopapier und ⭬ Dias.
Website d. Herstellers: ↱ rohrer-klingner.de/de/diaphoto-dye-lasurfarbe/ [2024-07-27]
Ektachrome
Palette an ⭬ Diafilmen von Kodak zur Verarbeitung im ⭬ E-6-Prozess; 2012 eingestellt, 2018 als Ektachrome E 100 wiederbelebt (↱ Datenblatt: Kodak-Publ. E-4000) [2024-07-04]
In guten Zeiten gab es eine breite Palette an Ektachrome-Filmen; Stand 1998:
Name Kürzel Eigenschaften Ektachrome E 100 S
E 100 S
⭬ Tageslichtfilm; gesättigte Farben, natürlich wirkende Hauttöne
Datenblatt: Kodak-Publ. E-163 und E-164Ektachrome E 100 SW
E 100 SW
⭬ Tageslichtfilm; gesättigte Farben, leichter ⭬ Warmton (quasi eingebauter ⭬ Wärmefilter)
Datenblatt: Kodak-Publ. E-163 und E-164Ektachrome E 100 VS
E 100 VS
⭬ Tageslichtfilm; stark gesättigte Farben
Datenblatt: Kodak-Publ. E-163Ektachrome E 200
E 200
⭬ Tageslichtfilm; gut zum ⭬ Pushen
Datenblatt: Kodak-Publ. E-28Ektachrome 100
EPN
⭬ Tageslichtfilm; gute Farbwiedergabe, für Studio- und Katalogfotografie
Datenblatt: Kodak-Publ. E-27Ektachrome 100 Plus
EPP
⭬ Tageslichtfilm; gesättigte Farben, für Studio- und Katalogfotografie
Datenblatt: Kodak-Publ. E-113Ektachrome 64
EPR
⭬ Tageslichtfilm; gute Farbwiedergabe, sehr feinkörnig
Datenblatt: Kodak-Publ. E-8Ektachrome 160 T
EPT
⭬ Kunstlichtfilm
Datenblatt: Kodak-Publ. E-144Ektachrome 320 T
EPJ
⭬ Kunstlichtfilm
Datenblatt: Kodak-Publ. E-145Ektachrome 64 T
EPY
⭬ Kunstlichtfilm; gut für Holztöne
Datenblatt: Kodak-Publ. E-130Ektachrome 400 X
EPL
⭬ Tageslichtfilm; leichter ⭬ Warmton
Datenblatt: Kodak-Publ. E-161Ektachrome P 1600x
EPH
⭬ Tageslichtfilm; sehr hochempfindlich
Datenblatt: Kodak-Publ. E-147
EPH ist für ⭬ Push-Entwicklung vorgesehen.
Ektachrome E 200
EPD
⭬ Tageslichtfilm; gut für ⭬ Crossentwicklung; ältere Version des E 200; nur als 120er-Rollfilm
Ektachrome Infrared
EIR
⭬ Falschfarbenfilm; nur als ⭬ Kleinbildfilm
Datenblatt: Kodak-Publ. TI-2323Lit.:
E. Firmenschrift Kodak PPI-691. 1998.
Kodak Professional Color Transparency Films. Firmenschrift Kodak E103RF. 2012.
Ektachrome R-3 (hist.)
Kodak-Prozeß für Ektachrome-22-Farbumkehrpapiere; eingeführt 1983
Elon (Kodak)
Kodak-Name für Metol als Bestandteil in ⭬ Entwicklern
ELVIS (hist.)
Electronic Video Interactive System; Steuerprogramm für Interaktives Kino von Martin Frech (1990/91).
Lit.:- Frech, Martin: Interaktives Kino [Diplomarbeit, Fachhochschule für Druck Stuttgart], 1991. 🗎 ausgew. Seiten
- Frech, Martin: »Privat-Programm: Kommt das Interaktive Kino?« In: Video Professional. Schiele & Schön. 2 (1992) 3, S. 6 ff.
Emulsion
Lichtempfindliche ⭬ Schicht des fotografischen Aufnahmematerials; chemisch ist das allerdings keine Emulsion, sondern eine erstarrte Suspension (Silberhalogenidkristalle in Gelatine).
Details siehe ⭬ Schicht
emulsionsbasierte Fotografie
Sammelbezeichnung für traditionelle, nicht-digitale Verfahren der fotogr. Bilderzeugung; »analoge Fotografie«
siehe auch mein → ManifestEntrastern
engl.: descreening
Entwickler, Hervorrufer
Das Entwickeln ist ein Schritt im ⭬ Entwicklungsprozess konventioneller fotogr. ⭬ Schichten.
Der E. ist eine Flüssigkeit, die in der belichteten fotogr. Schicht negative oder positive Bilder hervorruft.
E. gibt es als Pulver (zum Lösen in Wasser) oder als Flüssigkonzentrate als proprietäre Produkte zu kaufen – man kann sie jedoch auch nach veröffentlichten Rezepten aus den Rohchemikalien selbst zusammenstellen.
Wichtigste Bestandteile eines E. sind die ⭬ Entwicklersubstanz sowie eine Schutzsubstanz (verhindert die vorzeitige Oxydation der Entwicklersubstanz; meist Nariumsulfit). Die meisten E. enthalten zusätzlich Alkalien (zur Beschleunigung der Entwicklung) und Verzögerer (zum Schutz der unbelichteten Silberhalogenide).
ausgewählte Schwarzweiß-Negativentwickler:
- ⭬ Caffenol (Selbstansatz nach Dr. Scott Williams/
RIT) - ⭬ D-19 (Kodak-Rezeptur; Selbstansatz)
- ⭬ D-23 (Kodak-Rezeptur; Selbstansatz)
- ⭬ D-76 (Kodak)
- ⭬ ID-11 (Ilford)
- ⭬ HC-110 (Kodak)
- ⭬ PC-TEA (Selbstansatz)
- ⭬ Rodinal (urspr. Agfa; dort auch PaRodinal)
- ⭬ XTOL (Kodak)
ausgewählte Schwarzweiß-Papierentwickler:
- ⭬ Adotol Konstant (Adox; urspr. ORWO N113)
- ⭬ Dektol (D-72, Kodak)
- ⭬ ECO 4812 (Moersch)
- ⭬ Eukobrom (Tetenal)
- ⭬ Fomatol PW (Foma)
- ⭬ Muligrade Developer (Ilford)
- ⭬ Neutol (Adox; urspr. Agfa)
- ⭬ Variobrom WA (Tetenal)
Die ergiebigsten zeitgenössischen Monografien zu diesem Thema: Anchell (2016) und Troop/
Anchell (2020) [⭬ Literatur] engl.: developer; soup (slang)
- ⭬ Caffenol (Selbstansatz nach Dr. Scott Williams/
Entwicklersubstanz
Die E. reduziert die Silberionen der belichteten Silberalogenide (das latente Bild) schneller zu Silberatomen als die unbelichteten (die Latentbildkeime wirken katalytisch) – und wird dabei selbst oxydiert.
Wichtige Entwicklersubstanzen sind
- Derivate der Ascorbinsäure, ascorbic acid, Vitamin C
↱ CAS-Stoffdatenbank
z. B. als Natriumisoascorbat in ⭬ XTOL - Brenzcatechin, Catechol
↱ CAS-Stoffdatenbank
⭬ Stain bildend; z. B. in ⭬ Tanol (Moersch) - Glycin
↱ CAS-Stoffdatenbank - ⭬ Hydrochinon ⚠ (= Kodak Quinol)
↱ CAS-Stoffdatenbank - Metol (= Kodak Elon)
↱ CAS-Stoffdatenbank - p-Aminophenol
↱ CAS-Stoffdatenbank
z. B. in ⭬ Rodinal - Phenidon
↱ CAS-Stoffdatenbank
z. B. in ⭬ HC-110 - Pyrogallol
↱ CAS-Stoffdatenbank
⭬ Stain bildend; z. B. in PMK (Gordon Hutchings)
Erik Prestmon erklärt, wie er einen Entwickler selbst entwirft, ansetzt und testet:
- Prestmon, Erik: Designing a developer. Part one. 11. April 2012. Online: ↱ ascorbate-developers.blogspot.com/2012/04/designing-developer-part-one.html [2022-07-23]
- Prestmon, Erik: Designing a developer part 2. Alkali and restrainer. 13. April 2012. Online: ↱ ascorbate-developers.blogspot.com/2012/04/designing-developer-part-2-alkali-and.html [2022-07-23]
- Prestmon, Erik: Designing a developer part 3. Getting chemicals and mixing the developer. 17. April 2012. Online: ↱ ascorbate-developers.blogspot.com/2012/04/designing-developer-part-3-geting.html [2022-07-23]
- Prestmon, Erik: Designing a developer part 4. Testing and evaluation. 22. April 2012. Online: ↱ ascorbate-developers.blogspot.com/2012/04/testing-developer.html [2022-07-23]
engl.: developing agent
- Derivate der Ascorbinsäure, ascorbic acid, Vitamin C
Entwicklungsprozess für fotogr. ⭬ Schichten
- evtl. ⭬ vorwässern
- evtl. vorhärten (⭬ Härtebad)
- entwickeln
- evtl. entfernen der ⭬ Rem-jet-Schicht (s. dort)
- ⭬ Umkehrentwicklung
- ⭬ Farbentwicklung
- ⭬ Schwarzweißentwicklung
- ⭬ Entwickler
- Kinetik:
Kippentwicklung/Rotationsentwicklung
evtl. ⭬ bleichen
fixieren (⭬ Fixierer)
- ⭬ zwischenwässern
evtl. tonen (⭬ Tonung)
- ⭬ zwischenwässern
evtl. härten (⭬ Härtebad)
evtl. ⭬ Auswässerungshilfe
- ⭬ schlusswässern
evtl. ⭬ Netzmittel- bzw. Bildsilberstabilisierungsbad
Epidiaskop
engl.: epidiascope
s. a. ⭬ Overheadprojektor
Essigsäure-Syndrom
Von Harold Brown geprägter Begriff für die Hydrolyse des Acetatträgers von ⭬ Sicherheitsfilm, Magnetbändern u. ä.: Die Celluloseester werden unter dem Einfluss von Feuchtigkeit gespalten, es entsteht u. a. Essigsäure, die stark riecht, woran man das Problem schnell erkennt; das Monitoring erfolgt mit Hilfe von pH-Indikatoren (Acid-Detection-Strips).
Das E. setzt prinzipiell bei der Produktion des Materials ein und ist irreversibel; durch geeignete Lagerbedingungen (trocken und kalt, ggf. zusätzlich Säureextraktoren) kann es deutlich verzögert werden: Haltbarkeit bei 80 % r. F./
35 °C 4 Jahre; bei 60 % r. F./ 24 °C 20 Jahre; bei 40 % r. F./ 7 °C 300 Jahre; bei 20 % r. F./ 2 °C >1000 Jahre. Wird das E. im Archiv bemerkt, muss das betroffene Material sofort separiert werden, da die Essigsäure den restl. Bestand ›infiziert‹.
Lit.:
Amidon, Audrey: »Film Preservation 101: Why does this film smell like vinegar?«. In: The Unwritten Record. 19. Juni 2020. Online: ↱ unwritten-record.blogs.archives.gov/2020/06/19/film-preservation-101-why-does-this-film-smell-like-vinegar/ [2024-06-30]
Herbst, Helmut: »Zerfall unseres filmischen Erbes ; Wer hat Angst vorm Vinegar-Syndrome?«. In: Film & TV Kamera. 11. Nov. 2013. Online: ↱ filmundtvkamera.de/branche/wer-hat-angst-vorm-vinegar-syndrome/ [2024-06-19]
Jeavons, Clyde: »Obituary Harold Brown«. In: The Guardian. 12. Dez. 2008. Online: ↱ theguardian.com/film/2008/dec/12/harold-brown-obituary [2024-06-30]
Müller, Anna-Maija und Zürcher, Regula: »Zelluloseazetat-Filme – vorprogrammiertes „Essig-Syndrom“ (vinegar syndrome)«. In: Der Archivar. 60 (2007) 4, S. 346–349.
engl.: vinegar syndrome
ESTAR (Kodak)
Markenname für Kodaks Polyester-Filmträger (⭬ Schicht)
↱ Datenblatt [2024-07-25]Eukobrom (Tetenal; hist.)
proprietärer ⭬ Entwickler für ⭬ Silbergelatine-Fotopapier
enthält ⭬ Hydrochinon ⚠
umweltfreundliche Variante ohne ⭬ Hydrochinon ⚠: Eukobrom AC (hist.)
EV (exposure value; Eᵥ)
F
f-stop-printing
f-Zahl, Blendenzahl
engl.: f-stop; f-number
Fachkamera
Sammelbezeichnung für Kameras, die zu speziellen Zwecken konstruiert sind, häufig modular; bieten meist umfangreiche Verstellmöglichkeiten (z. B. zur Schärfedehnung); werden üblicherweise stativgebunden und meist mit ⭬ Planfilmen genutzt, seltener mit ⭬ Rollfilmen.
engl.: view camera
Lit.:
Grepstad, Jon: Building a Large Format Camera. Plans and Instructions for Building a 4 × 5 Monorail Camera. 2nd, rev. ed. Oslo: 2000. Online: ↱ jongrepstad.com/building-a-large-format-camera/ [2022-12-04]
FAQ rund um den Selbstbau einer Fachkamera (inkl. Literaturliste):
Grepstad, Jon: View Camera Construction FAQ. Online: ↱ jongrepstad.com/building-a-large-format-camera/view-camera-construction-faq-2/ [2022-12-04]
Fachlabor
s. a. ⭬ Großlabor
Falschfarbenfilm
Beim ›normalen‹ Farbfilm sind den rot-, grün- und blauempfindlichen ⭬ Schichten die jeweils komplementären Farben Cyan, Magenta und Gelb zugeordnet. Bei Falschfarbenfilmen sind entweder die Schichten anders sensibilisiert (⭬ Sensibilisierung), den jeweiligen Schichten sind andere Farben zugeordnet oder beides.
Populäre F. waren die nicht mehr produzierten ⭬ Diafilme EIR (↱ Datenblatt [2024-07-27]) und Aerochrome (↱ Datenblatt [2024-07-27]) von Kodak. Deren drei Schichten sind für Grün, Rot und Infrarot sensibilisiert (⭬ Infrarotfotografie). Der grünen Schicht ist Gelb, der roten Magenta und der infraroten Cyan zugeordnet. Hauptanwendungsgebiet für die Filme war die Luftbildfotografie. Auf Grund der speziellen Farbdarstellung wurden sie jedoch auch für die bildmäßige Fotografie verwendet (siehe z. B. Richard Mosses mehrfach ausgezeichnetes Kongo-Projekt »Infra«).
Der ›Blue-Insensitive Color Film‹ von GAF/
USA war ein für Blau unempfindlicher aber mit ASA 1000 hochempfindlicher Diafilm für Unterwasser- und Luftbildfotografie. ⭬ Lomographys Farbnegativfilm LomoChrome Purple ist zwar ein Falschfarbenfilm (Rot bleibt Rot, Grün wird Lila, Blau wird Grün und Gelb wird Pink), jedoch nicht infrarotempfindlich und damit höchstens eine Annäherung an EIR/
Aerochrome, aber keine korrekte Simulation – und schon gar kein Ersatz. Eine gute (⭬ hybride) Simulation ist, das Motiv dreimal auf Schwarzweiß-⭬ Infrarotfilm zu belichten – analog zur ⭬ Dreifarbenfotografie – jeweils durch einen 720 nm-Infrarot-, einen Grün- und einen Rotfilter; letztere jeweils kombiniert mit einem IR-Sperrfilter. Die Digitalisate werden zum Farbbild kombiniert (autoalign hilft): Das rotgefilterte Schwarzweißbild wird der Grünauszug, das grüngefiltete wird der Blauauszug und das infrarot gefilterte wird der Rotauszug.
s. a. ↱ teaandtechtime.com/an-analog-aerochrome-film-replacement/ [2024-07-27]Die Simulation der EIR/
Aerochrome-Farben ist auch mit einer für Infrarotempfindlichkeit modifizierten Digitalkamera und einem entsprechenden Filter möglich (z. B. Kolari Vision IR Chrome: ↱ kolarivision.com/product/kolari-vision-ir-chrome-lens-filter [2024-07-27]). ↱ Jason Kummerfeldt hat ein weiteres Verfahren vorgestellt [2024-07-27], basierend auf einem ↱ Schema von JW Wong [2024-07-27].
Lit.:
[IHAVE2PILLOWS]: »LomoChrome Purple XR: How to Get that Purple«. In: Lomography Magazin. 7. März 2014. Online: ↱ lomography.de/magazine/270862-lomochrome-purple-xr-how-to-get-that-purple. [2022-06-16].
Pepper, Jens: »Schönheit und Ästhetik als Waffe ; Werkschau von Richard Mosse in Bremen«. In: Photonews. Juni 2022, S. 20.
engl.: false-colour film
fanzine, fan magazine
Farbauszug, Farbseparation, Farbsatz
Die üblichen Druckverfahren arbeiten mit einer Palette definierter subtraktiver Grundfarben (beispielsweise ⭬ CMYK), die jeweils ausschließlich im Vollton gedruckt werden (Mehrfarbendruck). Jedes farbige Druckbild entsteht dabei durch das exakte Übereinanderdrucken von Anteilen dieser Grundfarben am entsprechenden Motiv – sollen Abstufungen der Vollfarben simuliert werden, müssen diese ⭬ aufgerastert sein.
Daher muss das zu druckende Farbbild zuerst in die Grundfarben des Druckverfahrens zerlegt werden, das ist die Farbseparation; dabei entstehen die Farbauszüge, die zusammen den Farbsatz bilden.
Analoge Farbseparation für den CMYK-Druck:
Fotografische Reproduktion der Vorlage: Drei Schwarzweißaufnahmen auf panchromatischen Film durch Farbfilter der Komplementärfarben ergeben je ein Farbauszug-Negativ für den roten, den grünen und den blauen Bildanteil.
Da die praktisch vorhandenen Farben nicht rein genug sind, damit deren Zusammendruck neutrale Grau/
Schwarz-Töne ergibt (sog. reiner Buntaufbau), muss ein zusätzlicher Schwarzauszug hergestellt werden, meistens durch den Unbuntaufbau (GCR; ›langes Schwarz‹), manchmal auch durch die Unterfarbenreduktion (UCR; ›kurzes Schwarz‹) oder den Unbuntaufbau mit Buntfarbenaddition (UCA). Dabei werden – je nach Verfahren – alle oder Teile der Bildbereiche, die gleiche C-M-Y-Dichten aufweisen, durch Schwarz ersetzt. Rastern des Farbsatzes mit unterschiedlichen Winkeln je Farbauszug.
Belichten der Druckplatten
s. a. ⭬ Dreifarbenfotografie
engl.: colour/
color separation Farbdiapositiv
Farbentwicklung
-
- ⭬ C-41-Prozess (Stehbild-Negativ-Entwicklung)
- ⭬ E-6-Prozess (Umkehr-Entwicklung zum ⭬ Diapositiv)
- ⭬ ECN-2-Prozess (Kinefilm-Negativ-Entwicklung)
- ⭬ RA-4-Prozess (Positiv-Papier-Entwicklung)
-
Farbfilter
hier:
- Farbkonversionsfilter und Farbkorrekturfilter
- Farbausgleichsfilter
- Kontrastfilter für die Schwarzweißfotografie
- Farbauszugsfilter für die ⭬ Dreifarbenfotografie
- Infrarot-Filter
- Literatur
Farbkonversionsfilter und Farbkorrekturfilter
Wenn die ⭬ Farbtemperatur des Aufnahmelichts nicht zur spektralen ⭬ Sensibilisierung der fotogr. ⭬ Schicht passt, wird das Motiv nicht farbrichtig abgebildet. Will man diesen Farbstich ausgleichen, verwendet man einen Farbfilter: für drastische Änderungen einen Farbkonversionsfilter, für deutliche Änderungen einen Farbkorrekturfilter und für subtile Anpassungen einen Farbausgleichsfilter.
Die Wirkung eines Filters wird in ⭬ mireds angegeben: rötliche Filter haben positive mireds-Werte, bläuliche negative – damit lässt sich rechnen (Vorzeichen beachten): [korrigierte Farbtemperatur] = [mireds-Wert d. Filters] plus [Farbtemperatur d. Aufnahmelichts]
↱ Mireds-Rechner des Filter-Herstellers Tiffen
Werden Filter verwendet, muss die Belichtung korrigiert werden. Den konkreten Korrekturwert (meist angegeben in Blendenstufen) entnimmt man den Technischen Informationen des Filmherstellers oder ersatzweise denen des Filterherstellers.
Auswahl gebräuchlicher Filter
Wird ⭬ Tageslichtfilm mit ⭬ Kunstlicht belichtet, bekommen die Aufnahmen einen gelblich-orangen Farbstich; dieser wird mit einem bläulichen Filter korrigiert (Rotanteile im Aufnahmelicht werden gesperrt).
engl.: CTB filter (convert to blue; colour temperature blue); LB filter (light balancing filter blue)
Farbtemperatur
vorh. Licht → FilmFilter
Kodak-Wratten
≙3000 K → 3200 K
3200 K → 3400 K
5000 K → 5500 K82 A
↱ TransmissionsdiagrammKB 2 2800 K → 3200 K
4700 K → 5500 K82 B
↱ TransmissionsdiagrammKB 3 2800 K → 3200 K
2950 K → 3400 K
4400 K → 5500 K82 C
↱ TransmissionsdiagrammKB 6 3800 K → 5500 K
2700 K → 3400 K
2600 K → 3200 K80 C*
↱ TransmissionsdiagrammKB 9 3400 K → 5500 K
2500 K → 3400 K
2400 K → 3200 K80 B*
↱ TransmissionsdiagrammKB 12 3200 K → 5500 K
2350 K → 3400 K
2250 K → 3200 K80 A* (= Fuji LBB-12)
↱ TransmissionsdiagrammKB 15 * Farbkorrekturfilter
Zur Nomenklatur in der 3. Spalte:
K = Korrektur; B = Blau; [Zahl] = ca.-Betrag der Farbverschiebung in [mireds ÷ 10] (⭬ Mireds-Werte für bläuliche Filter sind negativ)Wird ⭬ Kunstlichtfilm mit Tageslicht belichtet, bekommen die Aufnahmen einen bläulichen Farbstich; dieser wird mit einem rötlichen Filter korrigiert (Blauanteile im Aufnahmelicht werden gesperrt).
Kunstlichtfilm wird kaum noch genutzt, die rötlichen Filter werden jedoch auch gerne als Farbfilter vor dem Blitzgerät verwendet.
s. a. ⭬ Wärmefilter
engl.: CTO filter (convert to orange; colour temperature orange); LA filter (light balancing filter amber)
Farbtemperatur
vorh. Licht → FilmFilter
Kodak-Wratten
≙3400 K → 3200 K
6100 K → 5500 K81 A
↱ Transmissionsdiagramm
Etwas rötlicher als ein ⭬ Skylightfilter; taugt als immer-drauf-Filter wenn man seine Dias etwas wärmer mag.KR 2 3500 K → 3200 K
6450 K → 5500 K81 B
↱ TransmissionsdiagrammKR 2,5 3600 K → 3200 K
6600 K → 5500 K81 C
↱ Transmissionsdiagramm
Gut für angenehme Hauttöne und schöneres Weiß/Schwarz (z. B. Kleidung bei Hochzeitsfotografie) im Schatten. KR 3 3850 K → 3200 K
8400 K → 5500 K81 EF
↱ TransmissionsdiagrammKR 6 4500 K → 3200 K
9900 K → 5500 K85 C*
↱ TransmissionsdiagrammKR 9 5500 K → 3400 K 85*
↱ Transmissionsdiagramm
Das ist z. B. der in den Super-8-Kameras standardmäßig eingeschwenkte Filter, da Super-8-Film üblicherweise ⭬ Kunstlichtfilm (Typ A) war.KR 12 5500 K → 3200 K 85 B*
↱ TransmissionsdiagrammKR 15 * Farbkorrekturfilter
Zur Nomenklatur in der 3. Spalte:
K = Korrektur; R = Rot; [Zahl] = ca.-Betrag der Farbverschiebung in [mireds ÷ 10]engl.: colour conversion filter, light-balancing filter, LB filter
Farbausgleichsfilter
Soll es exakt werden, nutzt man zur Analyse des Aufnahmelichts ein Farbtemperaturmessgerät (Kolorimeter) und korrigiert kleinste Verschiebungen zur spektralen Sensibilisierung der fotogr. ⭬ Schicht mit Farbausgleichsfiltern (Kodak: CC-Filter; Agfa: AK-Filter).
engl.: colour compensating filter
Kontrastfilter für die Schwarzweißfotografie (Aufnahmefilter)
(für Kontrastfilter zur Nutzung mit kontrastvariablem Fotopapier: siehe ⭬ dort)
Farbfilter für Schwarzweißfilme lassen auf ⭬ panchromatischen fotogr. ⭬ Schichten die Filterfarbe heller erscheinen, dessen Komplementärfarbe dunkler; sie dienen der Kontrastbeeinflussung. Die Filter gibt es jeweils in verschiedenen Dichten zur Differenzierung der Wirkung.
Wichtig ist, bei der Belichtung die Filterfaktoren zu berücksichtigen. Diese sind abhängig vom Filmmaterial und der Lichtquelle, daher unbedingt die Datenblätter der Filmhersteller lesen und nicht stumpf die Werte der Filterhersteller übernehmen.
Test zur Ermittlung des Filterfaktors:
Aufnahme ohne Filter; Belichtungsparameter gemessen ohne Filter
Aufnahme mit Filter; Belichtungsparameter gemessen durch den Filter
Aufnahme mit Filter; Belichtungsparameter wie in Schritt 2, jedoch Blende um eine halbe Stufe geöffnet
Aufnahme mit Filter; Belichtungsparameter wie in Schritt 2, jedoch Blende um eine ganze Stufe geöffnet
evtl. eine weitere Aufnahme mit Filter; Belichtungsparameter wie in Schritt 2, jedoch Blende um eineinhalb Stufen geöffnet
Film entwickeln usw.
⭬ Kontaktstreifen anfertigen; Belichtungszeit so wählen, dass die erste (ungefilterte) Aufnahme korrekt erscheint
diejenige gefilterte Aufnahme aussuchen, die der ersten am nächsten kommt
Korrekturwert ermitteln und merken
Bei manchen ⭬ Belichtungsmessern kann man den Korrekturwert hinterlegen.
Filterfarbe Grau-Wiedergabe auf panchromatischen Schichten Rot Grün Blau Gelb heller heller dunkler Grün dunkler heller dunkler Orange heller dunkler dunkler Rot heller dunkler dunkler Blau dunkler dunkler heller Der populärste Kontrastfilter ist der mittlere Gelbfilter (benannt u. a. als K2, Yellow #8, Y48 [= sperrt bis 480 nm]). Klassische Schwarzweißfilme sind zu empfindlich für Blau/
Violett/ UV, daher werden diese Farben für unsere Wahrnehmung ohne Gelbfilter zu hell wiedergegeben; insbesondere der Himmel. Das Ausmaß dieses Effekts hängt jedoch von der Lichtsituation und vom Filmmaterial ab. So schreibt Kodak: Die Blauempfindlichkeit der KODAK PROFESSIONAL T-MAX Filme ist etwas geringer als die anderer panchromatischer Schwarzweißfilme von Kodak. Dadurch entspricht die Wahrnehmung dieses Films eher der Wahrnehmung des menschlichen Auges. Das bedeutet, dass Blautöne von diesem Film ggf. etwas dunkler dargestellt werden und daher natürlicher wirken. (Kodak Professional T-MAX 400 Film. Firmenschrift Kodak F-4043. Okt. 2007. (Ansel Adams vertieft das Thema Kontrastfilter in Das Negativ, Kap. 5.)
s. a. ⭬ Sensibilisierung
engl.: black-and-white contrast filter
Farbauszugsfilter für die ⭬ Dreifarbenfotografie
Für ⭬ Farbauszüge zu Reprozwecken nutzt man schmalbandigere Filter, z. B. Wratten 29 (Rot), 61 (Grün) und 47B (Blau).
Rot [= Wratten 25]
Grün [= Wratten 58]
Blau [= Wratten 47]
engl.: colour separation filter, tricolour printing filter
s. a. ⭬ Farbauszug
Infrarot-Filter
Dunkelrot [= Wratten 88A]
sperrt Licht < 720 nm
Schwarzrot [= Wratten 87C]
sperrt Licht < 790 nm
↱ Transmissionsdiagrammengl.: infrared filter
s. a. ⭬ Infrarot-Fotografie
Literatur
Adams Ansel: Das Negativ. Übers. Fritz Presser. 9. Aufl. München: Christian, 1998
Hanke, Rudolph: Filter-Faszination. Monheim: Hama, 1977.
Kodak Filter für den Berufsfotografen. Firmenschrift Kodak P-I 1. o. D.
Farbkontrollkarte
Bei der Reproduktion von Aufsichtsvorlagen wird die F. mit fotografiert, damit man bei der Ausarbeitung eine visuelle Referenz für die Farbkorrektur hat.
Die einfachen F. (Kodak Q-13/
Q-14 und entsprechende Klone) waren für Arbeiten zu Analogzeiten brauchbar, taugen jedoch nicht zur messtechnischen Auswertung digitaler Aufnahmesysteme; dafür gibt es aufwendigere Referenztafeln, z. B. ⭬ IT 8-Targets und den SpyderCheckr von Datacolor.Webseite von Kodak zur Q-13/
Q-14 : ↱ kodak.com/en/motion/page/color-separation-guides-and-gray-scales/ [2023-11-12]Webseite von Datacolor zum Spyder
Checkr : ↱ datacolor.com/spyder/welcome-to-spyder-checkr/ [2023-11-12]Lit.:
Schnetz, Jakob: »Kacheln, Mosaike, Raster ; Kalkulierte Natürlichkeit in der digitalen Farbfotografie«. In: Rundbrief Fotografie. Bd. 29 (2022), Nr. 1, S. 7–20
s. a. ⭬ IT 8-Target; ⭬ Testtafel
Farbnegativfilm
Farbsatz
Farbseparation
engl.: colour separation
Farbtemperatur
Wird ein (theoretischer) Schwarzer Körper – gleichmäßig erwärmt, ändert sich seine Farbe mit dem Anstieg der Temperatur: von Schwarz über Rot und Weiß zu Hellblau (das ist die gekrümmte Linie unten rechts im CIE-XYZ-»Schuhsohlendiagramm«).
Übliche ›weiße‹ Lichtquellen mit einem kontinuierlichen Spektrum geben Licht in einer Farbe ab, die ungefähr der Farbe des Schwarzen Körpers bei einer bestimmten Temperatur entspricht. Diese Temperatur – gemessen in Kelvin – ist die Farbtemperatur; für ›farbiges‹ Licht gilt das nicht.
Reale Dinge absorbieren nicht die komplette auf sie einwirkende Energie, sondern reflektieren einen Teil davon. Das erklärt, weshalb das Stück Stahl nicht erst bei 3000 K rot glüht. Die Umrechnung gelingt, wenn man den Absorptionsgrad des Materials kennt.
Die F. des Sonnenlichts an einem klaren Tag ist auf 5000 K ›festgelegt‹.
Farbfilm ist für eine definierte Farbtemperatur sensibilisiert: ⭬ Tageslichtfilm für 5500 K (das ist meist auch die Farbtemperatur von Blitzlicht), ⭬ Kunstlichtfilm für 3200 K (Typ B), 3400 K (Typ A; hist.) bzw. 3800 K (Typ F für Blitzlichtbirnchen mit Aluminium-Füllung; hist).
Entspricht die Beleuchtung bei der Aufnahme diesen Farbtemperaturen, wird das Motiv auf dem jeweiligen Filmmaterial »farbrichtig« abgebildet. Wenn nicht, nutzt man ⭬ Farbfilter.
Die Farbtemperatur wird mit einem Farbtemperaturmessgerät bestimmt oder mit Farbkärtchen geschätzt (im unten abgebildeten Beispiel: Vergleich der Farbe des rechten Streifens mit den Feldern daneben).
s. a. ⭬ mireds
engl.: colour temperature
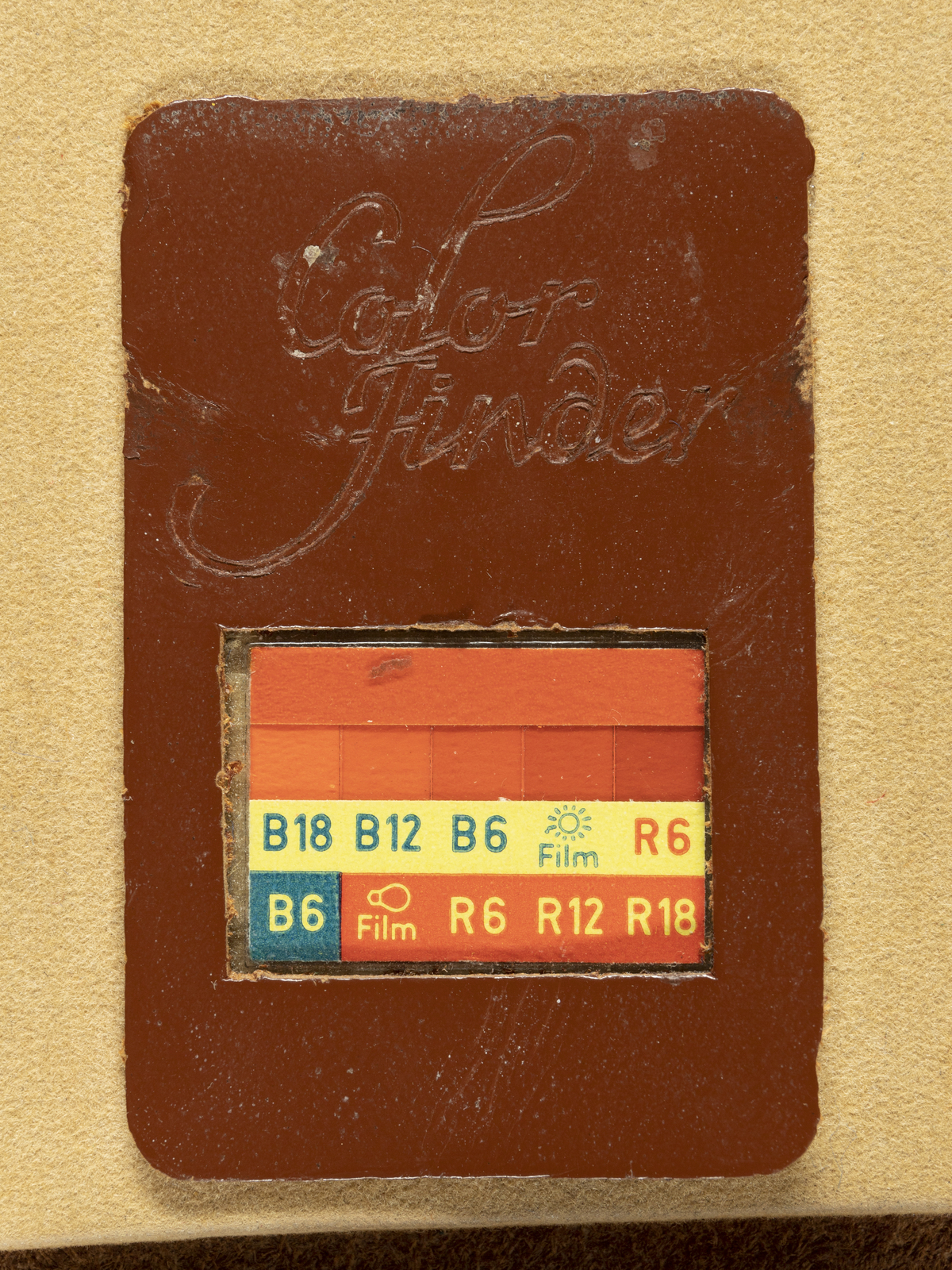
Farbtäfelchen des Gossen Lunasix zum Schätzen der Farbtemperatur mit Empfehlungen für den passenden ⭬ Farbkorrekturfilter
(hier bei 5000 Tageslicht-Leuchtstoffröhre)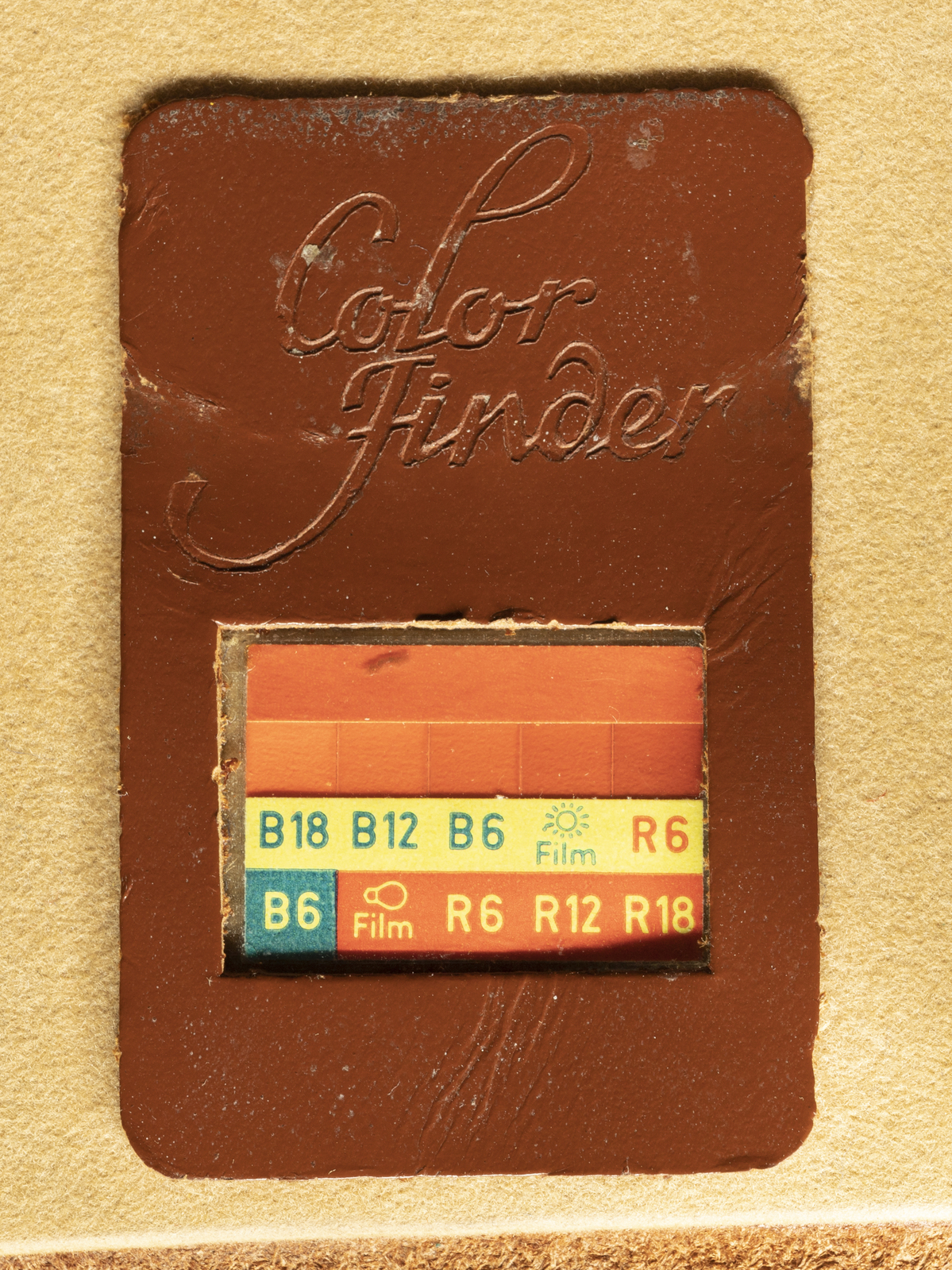
Farbtäfelchen des Gossen Lunasix zum Schätzen der Farbtemperatur mit Empfehlungen für den passenden ⭬ Farbkorrekturfilter
(hier bei 6500 Tageslicht im Schatten)Farmerscher Abschwächer
Lösung aus Rotem Blutlaugensalz (Kaliumferrizyanid, K₃[Fe(CN)₆]; 50 g auf 1 l Wasser = Teil 1) und Fixiersalz (Natriumthiosulfat, Na₂S₂O₃; 100 g auf 1 l Wasser = Teil 2) zum ⭬ Bleichen des Bildsilbers (je nach Verdünnung für überbelichtete oder überentwickelte Negative; für die Bearbeitung von ⭬ Prints wird noch Kaliumbromid zugegeben); aber Achtung: weg ist weg: da der ⭬ Fixierer schon in der Lösung ist, kann nicht mehr rückentwickelt werden (⭬ Rückentwicklung).
Kurz vor der Anwendung werden die Teile 1 und 2 gemischt; der Ansatz ist nur kurz haltbar.
engl.: farmers reducer
Faustregeln
-
Die Veränderung der Filmentwicklungszeit um 25 % ändert die Gradation beim Vergrößern um eine Stufe; das gilt in beide Richtungen: Wenn Sie regelmäßig mit Gradation 4 vergrößern, verlängern Sie Ihre Filmentwicklungszeit um ¼, und printen künftig mit Gradation 3. Wenn Sie häufig Gradation 1 benötigen, verkürzen Sie die Filmentwicklungszeit um ¼ und vergrößern künftig mit Gradation 2.
s. a. ⭬ Zonensystem
Richtige Belichtung für eine Reproduktion:
⭬ Belichtungsmesser auf ⭬ E I ÷ 5 einstellen
Weißes Blatt Papier anmessen (= ⭬ Zone X), das an der Stelle des zu reproduzierenden Bildes liegt und wie dieses beleuchtet wird
Repro mit diesem Wert anfertigen
Das funktioniert, da die Vorlage einen deutlich geringeren Dynamikumfang hat als realweltliche Motive.
-
Kürzeste Belichtungszeit für das Fotografieren aus der Hand (Freihandgrenze):
mind. [Kehrwert der Brennweite] sNutzt man z. B. ein 50 mm-Objektiv, sollte die Belichtungszeit ¹⁄₆₀ s oder kürzer betragen, damit das Bild nicht verwackelt.
Prozesskontrolle beim Entwickeln von Fotopapier:
⭬ BildspurzeitSchätzung der Belichtungsparameter:
⭬ Sunny-16-RegelBei der Belichtung deutlich ⭬ überlagerten Films ist die ISO-Zahl pro Dekade seit dem ›Ablauf‹-Datum zu halbieren.
-
Faktor für die Verlängerung/
Verkürzung der Entwicklungszeit bei ⭬ Push-/ Pull-Entwicklung : 1,33[Anzahl der ›Blenden‹]
-
Ferrotypie
FFKalk (hist.)
Ein Programm unter MS-DOS für kleine und mittlere Produzenten, freie Filmemacher und alle anderen, die Filme kalkulieren und abrechnen wollen. Das Programm ist auf dem Kalkulationsschema der Filmförderungsanstalt (FFA) aufgebaut.
Version 1.0: April 1990
Version 1.1: Nov. 1990
Version 1.2: Feb. 1991
Version 1.3: Feb. 1992
Version 2.0: April 1993
Programmiert von Martin Frech; bis Mitte der 1990er-Jahre im Vertrieb der Barfuss Film/Futurum-X GmbH, Köln; nicht mehr am Markt Filmempfindlichkeit
s. a. ⭬ Nennempfindlichkeit; ⭬ Sensitometrie; ⭬ Zonensystem
engl.: film speed
Filmkennzeichnung
Informationen zum Entwicklungsprozess auf Kleinbild-Filmpatronen und Rollfilmschutzpapieren, Codierung der Filmsorte und Emulsionsnummer sowie Numerierung der Bilder auf Filmrändern bei Rollfilmen und Codierung der Filmsorte bei Planfilmen:
Farbcodierung bei ⭬ Kleinbildfilmen durch Aufdruck auf der Patrone
Farbcodierung bei ⭬ Rollfilmen durch Aufdruck auf dem Schutzpapier bzw. der Allonge
Lichtsignierung an den Rändern von Rollfilmen
⭬ Kerbcodierung am Rand von ⭬ Planfilmen
Filmkorn, Granularität
Wird ein fotografisches Bild vergrößert angeschaut, sieht man ein zufälliges Muster, das ›Filmkorn‹. Wird dieses ›Korn‹ mit einem Mikrodensitometer gemessen, erhält man mit dem ⭬ RMS-Wert einen objektivierten Wert für die ›Granularität‹ des entsprechenden Filmmaterials.
s. a. ⭬ print grain index
engl.: film grain
Filmlader für ⭬ Meterware
Umspulgerät, in das im Dunkeln eine max. 100-ft-Rolle Film eingelegt wird (⭬ Meterware). Dieses Material kann mit dem F. im Hellen in spezielle Kleinbild-Patronen umgerollt werden.
Früher (wann eigentlich?) waren die 100-ft-Rollen deutlich günstiger als die konfektionierten Kleinbildpatronen, damals hat sich das Umspulen preislich eher gelohnt als heute: Stand Nov. 2022 kosten 100-ft Ilford HP5+ etwa 100 € und eine Filmpatrone (ca. 6-mal wiederverwendbar) ungefähr 1,8 €. Wenn alles klappt, können aus einer 100-ft-Rolle 18 KB-Filme à 36 Aufnahmen geschnitten werden. Die reinen Materialkosten für den selbst konfektionierten HP5+ betragen also ca. 5,85 €. Dazu kommen anteilig die Kosten für den Filmlader (z. B. AP Bobinquick Junior: 80 €), der Zeitaufwand, das ein oder andere Missgeschick sowie eine gewisse Unsicherheit, ob der Film nicht doch den einen oder anderen Kratzer abbekommen hat oder ob die wiederverwendete Patrone noch lichtdicht ist. Ein fertig konfektionierter HP5+-Einzelfilm kostet ca. 8 €, im Zehnerpack evtl. weniger; preislich lohnt sich das Selbstladen also eher nicht.
Es gibt allerdings Filmmaterial, das man nicht fertig konfektioniert bekommt (z. B. Kinefilm; aber hat man den richtigen Wickelkern?); oder man will weniger in der Patrone als die üblichen 1,6 m; oder man hat eine Quelle für günstige Meterware …
engl.: bulk film loader
Filmpatronenöffner
Werkzeug zum Abhebeln des Verschlusses einer ⭬ Kleinbild-Filmpatrone, funktioniert wie ein Flaschenöffner für Kronkorken. Alternativ gibt es ein Werkzeug, das wie eine ›umgekehrte Zange‹ an die Patrone angesetzt wird. Beide funktionieren zuverlässig besser als der oft empfohlene Flaschenöffner/
Kapselheber. Mit den neuen Foma-/Lomography-Patronen kommen beide nicht klar, dafür gibt es einen speziellen Öffner:
↱ https://fomaobchod.cz/de/fotografenbedarf/otviraknaplastovekazety/kassettenoffnerauskunststoff[10800] [2025-04-27]engl.: film cassette/
canister/ cartridge opener Filmrückholer
engl.: film leader retriever
Filmsuppe
Flüssigkeit, in der ein Film vor oder nach der Belichtung gebadet wird. Durch die Vorbehandlung wird die Schicht so verändert, dass das Bildergebnis auf Grund von Farbverschiebungen, Mustern, partiellen Schichtablösungen usw. unvorhersehbar wird.
Die F. besteht aus Wasser, in dem irgendwelche haushaltsüblichen Substanzen gelöst sind (experimentieren!).
Üblicherweise wird dafür Kleinbildfilm genutzt und der Film in der Patrone einige Stunden ›behandelt‹, was eine wochenlange Trocknungszeit nach sich zieht.
Gesuppter Film sollte nicht ohne Vorwarnung ins Labor gegeben werden, da (je nach Vorbehandlung) Partikel der angelösten Schicht die Bäder verunreinigen können; am besten selbst entwickeln.
engl.: film soup
Film-Typ xyz (Kodak)
Kodak begann 1913, ihre ⭬ Rollfilm-Typen zu numerieren, beginnend mit Typ 101 für die ›No. 2 Bullet‹-Kamera; dieser erste benummerte Rollfilm wurde von 1895 bis 1956 produziert. Agfa, Ansco und andere Firmen pflegten bis ungefähr zur Mitte des 20. Jh. eine eigene Nomenklatur. Die Film-Typ-Bezeichnung wurde oft in den Kameras vermerkt:
Auswahl der heute noch interessanten Film-Typen:
Für die komplette und ausführliche Liste siehe Gustavson (2009) [⭬ Literatur].Kodak-Typ ≙ Agfa-Typ Aufnahmeformat noch in
Produktionwird noch
konfektioniert110 ― 11 × 17 mm ✗ ✓
als Negativfilm: ↱ Lomography [2024-07-27] (⭬ Lomografie)Pocketfilm (⭬ Kleinstbildfilm); 16 mm breiter Film in Kassette; gab es auch als ⭬ Diafilm.
Wiederverwendung der Typ-Nummer eines 1929 eingestellten Rollfilms.
Bei ORWO hieß diese – zum Kodak-Typ 110 allerdings inkompatible – Konfektionierung »Kassette 16« (die Pentacon K 16 hatte das Aufnahmeformat 13 × 17 mm).
116 D-6 2 ½ × 4 ¼ ″ ✗ (Kodak: 1899 – 1984) ✓
↱ FFC [2024-07-27]70 mm breit 120 B-2; FB-2 abhängig von der Kamera ✓ (Kodak seit 1901) der Standard-⭬ Rollfilm für ⭬ Mittelformat-Fotografie 122 G-6 ✗ (Kodak: 1903 – 1971) ✓
↱ FFC [2024-07-27]126 ― 26 × 26 mm ✗ (Kodak: 1963 – 1999; Ferrania produzierte diesen Film noch bis 2007)
(✓)
FFP bietet korrekt perforierten Rollfilm an zum Befüllen von alten Original- oder 3D-gedruckten FakMatic-Kassetten (jedoch ohne das Schutzpapier).⭬ Instamatic; 1963; 35 mm breiter Film in Kassette (›Kodapak‹).
Wiederverwendung der Typ-Nummer eines 1949 eingestellten Rollfilms.
127 A-8, FA-8 abhängig von der Kamera ✗ (Kodak 1912 – 1995) ✓
↱ FFC [2024-07-27]s. a. ⭬ Rollfilm
135 ― abhängig von der Kamera ✓ (Kodak seit 1934) s. a. ⭬ Kleinbildfilm
Standardfilm zur Nutzung in ⭬ Kleinbild-Kameras220 ― abhängig von der Kamera (✓) s. a. ⭬ Rollfilm
240 ― 30,2 × 16,7 mm
25,1 × 16,7 mm
30,2 × 9,5 mm✗ ✗ unperforierter 24 mm breiter Film auf dünner PE-Basis;
Details siehe ⭬ APS616 PD-16 ✗ (Kodak 1931 – 1984) ✓
↱ FFC [2024-07-27]620 PB-20 ✗ (Kodak 1931 – 1995) ✓
↱ FFC [2024-07-27]ähnlich Typ 120, etwas andere Spulen (dünnere Achse, kleinere Flansche, feinere Kupplungsschlitze); hat man die entsprechenden Spulen, kann man 120er-Film selbst umrollen 828 ― 28 × 40 mm ✗ (Kodak 1935 – 1984) ✓
↱ FFC [2024-07-27]⭬ 35 mm-Film ohne Randperforation mit Papierträger auf offenen Spulen; ein Perforationsloch pro Bild; ursprünglich für die Amateur-Kamera »Kodak Bantam«
Lit.:
»Films and Plates«, in: Encyclopedia of Practical Photography, Bd. 6, Garden City (NY): 1978, S. 1055 ff
Gustavson (2009, S. 353 f.) [⭬ Literatur]
History of Kodak Cameras. Kodak Customer Service Pamphlet AA-13. Dez. 1987.
Standard Film and Plate Sizes. o. D.. Online: ↱ earlyphotography.co.uk/site/sfs.html [2022-06-09]
D’Asaro, Matthew: Building a Punch to Make Properly Perforated 828 Film. 24. Sep. 2014. Online: ↱ dasarodesigns.com/projects/building-a-punch-to-make-properly-perforated-828-film [2022-05-01; DIY-Anleitung]
Filter
Gefärbte Folien oder Gläser, die im Objektiv (Einschubf.), vor dem Objektiv oder vor der Lichtquelle angebracht werden, um bestimmte Lichtanteile zu sperren.
Effektfilter/
Tricklinsen ⭬ Farbfilter
dort:Farbkonversionsfilter und Farbkorrekturfilter
Farbausgleichsfilter
Kontrastfilter (Aufnahmefilter für die Schwarzweißfotografie)
Farbauszugsfilter für die ⭬ Dreifarbenfotografie
Infrarot-Filter
⭬ Kontrastfilter (zur Nutzung mit kontrastvariablem Fotopapier)
engl.: filter
Fischaugenobjektiv, fisheye
Gewöhnliche Objektive bilden eine Ebene, die senkrecht zur Objektivachse steht, zentralperspektivisch ab. Dagegen bilden F. eine kugelförmige Fläche (Objektschale) auf die Bildebene ab.
F. sind meist extreme Weitwinkelobjektive (Bildwinkel bis zu > 180°) um den Preis starker Verzeichnung des Bildes.
Man unterscheidet zwischen Zirkular- und Vollformat-F. Erstere haben einen Bildkreis, dessen Durchmesser maximal der kurzen Seite des Aufnahmeformats entspricht. Der Bildkreis von Vollformat-F. entspricht mindestens der Diagonale des Aufnahmeformats.
Das Auge das HAL ist das legendäre Nikon 8 mm-F.-Objektiv.
engl.: fisheye lens
Fixierer
Das Fixieren ist ein Schritt im ⭬ Entwicklungsprozess konventioneller fotogr. ⭬ Schichten.
Der Fixierer entfernt nach dem Entwickeln die nicht reduzierten Silberhalogenide aus der Schicht und macht diese damit lichtunempfindlich. Übrig bleibt bei Schwarzweißprozessen das bei der Entwicklung gebildete bildformende metallische Silber; bei Farbprozessen das Farbbild aus den während der chromogenen Entwicklung entstandenen oder nach der chromolytischen Entwicklung übrig gebliebenen Farbstoffen.
Die Fixierlösung besteht aus der fixierenden Substanz – Natriumthiosulfat (Na₂S₂O₃; engl. hypo) oder für kürzere Fixierzeiten Ammoniumthiosulfat (NH₄)2₂S2₂O₃ – und etwas zur Einstellung des pH-Werts: es gibt saure, neutrale und alkalische Fixierbäder.
Saures Fixierbad (Agfa-Rezeptur 300) Menge Substanz 200 g Natriumthiosulfat (Na₂S₂O₃) krist. 20 g Natriumdisulfit (Na₂S₂O₅) in ca. 750 ml Wasser lösen, mit Wasser auf 1 l auffüllen Ein Fixierer kann die Gelatine ⭬ härtende Zusätze enthalten (Härtefixierbad).
F. für Schwarzweiß-, Farb-, Negativ- und Positivprozesse unterscheiden sich nicht prinzipiell, sie sind nur auf den jeweiligen Prozess optimiert (pH-Wert, Zusatz von EDTA zur Komplexbildung …).
Das Fixierbad muss erneuert werden, bevor es verbraucht ist.
Werte für gutes Fixierbad:
Säuregehalt zwischen pH 4 und pH 8
Silbergehalt nicht über 2 bis 3 g/Liter
Dichtewert nur wenig unter dem Frischwert
Zum Testen gibt es mehrere Möglichkeiten:
Zur schnellen Kontrolle gibt es Teststäbchen, die kombiniert den pH-Wert und den Silbergehalt anzeigen; diese sind jedoch nicht exakt.
Die Hersteller geben die Kapazität des Fixierers an. Zählen Sie, wie viel Filme bzw. welche Fläche an Fotopapier Sie fixiert haben (s. a. ⭬ Fotopapier-Formate).
Nutzen einer Testlösung:
Testlösung für Fixierer nach ⭬ Anchell (2016, 338) Menge Substanz 5 g Kaliumpermanganat (KMnO₄)
in 80 ml Wasser lösen; mit Wasser auf 100 ml auffüllen10 ml der Testlösung in 100 ml Fixierer geben und gut mischen (schütteln); wenn ein weißer oder gelblich-weißer Niederschlag entsteht, sollte der Fixierer ersetzt werden.
Prüfen der fixierten Abzüge mit einer Testlösung:
Silber-Testlösung für Fixierbäder ST-1 (Kodak-Rezeptur) Menge Substanz 2 g Natriumsulfid (Na₂S)
in 100 ml Wasser lösen
(etwa drei Monate lang haltbar)Ein Tropfen der verdünnten Lösung (1+9) wird auf den Rand des abgequetschten Abzugs aufgetragen und nach 3 Minuten wieder entfernt. Verfärbt sich die entsprechende Stelle deutlich, befinden sich Silberverbindungen auf dem Material. Zum Vergleich führt man den Test auf einem in zwei frischen Fixierbädern verarbeiteten Fotopapier durch.
-
Für Film-Fixierer:
Im frischen Fixierer ein Stück komplett belichteten Film (z. B. den Filmanfang) im Hellen fixieren und die Zeit messen, bis der Film komplett klar geworden ist (= initiale Klärzeit).
Das Doppelte dieser Zeit ist die minimale Fixierzeit für diesen Filmtyp; diese kann sicherheitshalber um zwei Minuten verlängert werden.
Wenn sich die initiale Klärzeit verdoppelt hat, sollte der Fixierer ersetzt werden.
Lit.:
Troop/
Anchell (2020), S. 143 ff. [⭬ Literatur]
engl.: fixer
Flecken
Flachkristallfilm
Die Form der Silberalogenidkristalle in der fotogr. ⭬ Schicht von Flachkristallfilmen ist durch kontrolliertes Kristallwachstum hinsichtlich des Verhältnis’ von Oberfläche zu Volumen optimiert: Die Kristalle sind flach, nicht kubisch wie bei den traditionellen Filmen. Dies ermöglicht eine höhere Auflösung, bessere Konturenschärfe und ein feineres Filmkorn. Dadurch unterscheidet sich der Look der mit diesen Filmen produzierten Bilder jedoch auch von denen, die auf konventionellen Filmen aufgenommen wurden.
Flachkristall-Schwarzweißfilme sind seit den 1980er-Jahren unter verschiedenen Bezeichnungen am Markt: Delta-Kristall (Ilford), Sigma-Kristall (Fujifilm), T-Kristall (Kodak).
Lit.:
Kofron, J. T. und Booms, R. E.: Kodak T-Grain Emulsions in Color Films. In: Journal of the Society of Photographic Science and Technology of Japan. Bd. 49, Nr. 6, 1986. S. 499-504. Online: ↱ jstage.jst.go.jp/article/photogrst1964/49/6/49_6_499/_article [2024-07-27]
engl.: tabular-grain film
Fomatol PW (Foma)
Proprietärer ⭬ Entwickler für Warmton-⭬ Silbergelatine-Fotopapiere (z. B. für Fomas Fomatone-MG-Papiere); verstärkt den ›warmen‹ (bräunlichen) Bildton der Papiere.
ohne ⭬ Hydrochinon ⚠
Fomatol PW wird in als Pulver in zwei Beuteln geliefert, die nacheinander in Wasser gelöst werden für 1 l Stammlösung; die Entwicklungszeit beträgt etwa vier Minuten. Wird der Entwickler weiter verdünnt, wird der Bildton brauner, allerdings bei deutlich verlängerter Entwicklungszeit (12 Minuten bei einer ⭬ Verdünnung von 1:3.)
↱ Infoblatt d. Herstellers [2024-07-27
Fotoalbum
engl.: photo album
Fotoautomat
Eines der bekanntesten Fotos von Franz Kafka ist ein ›Selbstportrait‹, das 1923/
1924 in einem Fotoautomaten im Kaufhaus Wertheim (Berlin, Leipziger Platz) angefertigt wurde. (↱ Digitalisat im Bildarchiv Klaus Wagenbach [2024-07-27) Lit.:
Vizzari, Anthony: »An Intro Guide to Process, Cosumables, Formulas & Set-Up for Analog Photobooths.« In: A Blog about Photobooths, Art, & Photography. 26. Nov. 2020. Online: ↱ aastudiosinc.com/post/2018/03/11/an-intro-guide-to-process-consumables-formulas-set-up-for-analog-photobooths [2024-02-16]
engl.: auto-photography machine; photobooth
Fotofilm
Fotogramm
Fotografie, die ohne Kamera entsteht. F. werden üblicherweise in der ⭬ Dunkelkammer hergestellt, indem man opake, transluzide oder transparente Objekte auf einer lichtempfindlichen ⭬ Schicht (z. B. ⭬ Fotopapier) plaziert (direkt oder mit Abstand), den Aufbau belichtet und die Schicht im entsprechenden Prozess weiterverarbeitet. Die richtige Belichtungszeit muss ausgetestet werden.
zeitgenössische künstlerische Fotogramm-Arbeit:
↱ Tine Edel: Die vier Wände [2024-07-27Lit.:
Neusüss, F. M. (Hrsg.): Das Fotogramm in der Kunst des 20. Jahrhunderts: die andere Seite der Bilder – Fotografie ohne Kamera. Köln: DuMont, 1990. ISBN 978-3-7701-1767-3
- Spitzing, Günter: Fotogramme mit allen Schikanen ; Fotografik gestalten ohne Kamera in SW und Farbe. Düsseldorf: Wilhelm Knapp, 1977
engl.: photogram
s. a. ⭬ Kontaktkopie
Fotogravüre
engl.: photogravure; photoengraving
Fotolabor
Einrichtung zur Verarbeitung von fotogr. Filmen und Papieren. Zentraler Bereich des F. ist die Dunkelkammer, in der lichtempfindliches Material verarbeitet wird. Die üblichen ⭬ Fotopapiere für die Schwarzweiß-Fotografie sind nur für Licht bis knapp 600 nm sensibilisiert; längerwelliges Licht bewirkt keine Schwärzung der fotogr. ⭬ Schicht. Daher wird die Dunkelkammer zur Arbeitserleichterung rot beleuchtet (wichtig: ⭬ Schleiertest machen). Werden ⭬ panchromatische Materialen verarbeitet (z. B. ⭬ Planfilmentwicklung in Schalen, Farbvergrößerungen), muss dies jedoch bei absoluter Dunkelheit geschehen. Neben der Dunkelkammer umfasst das F. weitere Arbeitsräume, bspw. zur Wässerung, Trocknung und Weiterbearbeitung der Abzüge.
Lit.:
- »Custom Labs«, in: Encyclopedia of Practical Photography, Bd. 4, Garden City (NY): 1978, S. 640 ff
- »Darkroom, Amateur«, in: Encyclopedia of Practical Photography, Bd. 4, Garden City (NY): 1978, S. 662 ff
- Darkroom Design for Amateur Photographers. Firmenschrift Kodak AK-3. 8 S. März 2007.
- »Darkroom, Professional«, in: Encyclopedia of Practical Photography, Bd. 4, Garden City (NY): 1978, S. 669 ff
Fotomontage
engl.: photomontage
Fotopapier
Mit einer lichtempfindlichen ⭬ Schicht versehenes Papier zur Herstellung von Fotografien (⭬ Vergrößerung oder ⭬ Kontaktkopie).
Albuminpapier
Negativ-Positiv-Prozess
A. wird hergestellt, indem Papier mit einer Eiweiß-Ammoniumchlorid-Schicht versehen und anschließend in einer Silbernitrat-Lösung sensibilisiert wird (nach Louis Désiré Blanquart-Evrard (1802–1872)). Im Prinzip eine Weiterentwicklung des Salzpapiers (s. u.) mit dem Vorteil, dass die Eiweißschicht eine geschlossene Oberfläche ermöglicht.
Belichtet wird üblicherweise im ⭬ Kontaktverfahren unter Sonnenlicht (UV-Licht).
A. wurde ab dem späten 19. Jahrhundert in großen Mengen manufakturartig hergestellt (v. a. von den Dresdener Albuminfabriken); keeping the chickens of Europe busy. Der hohe Bedarf hatte vor allem zwei Gründe: den Boom der billigen Portraitfotografie und die hohe Nachfrage nach ⭬ Stereobild-Karten.
Wichtig ist die Papierqualität: Weltweit gab es damals nur zwei Papierfabriken, die entsprechendes Papier liefern konnten (Blanchet Frères et Klébler Co. in Rives/
Frankreich (»Rives paper«) und Steinbach and Company in Malmedy/ Belgien, damals deutsch: Malmünd (»Saxe paper«). Lit.:
Jarvis, Chad: Albumen printing. 16. Feb. 2010. Online: ↱ alternative
photography.com/albumen-printing/ [2022-12-27]Klemm Bettina: »Wie Dresden Fotogeschichte schrieb«. In: Sächsische Zeitung. 16. Aug. 2018. Online: ↱ saechsische.de/wie-dresden-fotogeschichte-schrieb-3956977.html [2022-12-27]
Reilly, James M.: The Albumen Salted Paper Book ; The history and Practice of Photographic Printing 1840–1895. 1980. Online: ↱ cool.culturalheritage.org/albumen/library/monographs/reilly/ [2022-12-27]
engl.: albumen paper
Salzpapier
Negativ-Positiv-Prozess; ⭬ vegan
zeitgenössische künstlerische Position, die den Salzpapier-Prozess nutzt:
↱ Brian Culbertson: Adverse [2024-07-27]Lit.:
Reilly, James M.: The Albumen Salted Paper Book ; The history and Practice of Photographic Printing 1840–1895. 1980. Online: ↱ cool.culturalheritage.org/albumen/library/monographs/reilly/ [2022-12-27]
Silbergelatine-Fotopapier
Negativ-Positiv-, Positiv-Negativ- oder Positiv-Positiv-Prozess
Parameter:
- Typ
- Barytpapier
Das traditionelle Fotopapier, bei dem zwischen dem Papierträger und der lichtempfindlichen Schicht eine Gelatine-Bariumsulfat-Schicht aufgebracht ist; nur noch für den Schwarzweiß-Prozess verfügbar; Oberfläche kann hochglänzend gepresst werden (⭬ Trockenpresse). Korrekt verarbeitet, ist die Haltbarkeit von Baryt-Abzügen sehr hoch. - PE-Papier
Fotopapier, bei dem der Papierträger beidseitig mit einer dünnen Polyethylen-Schicht (PE) beschichtet ist; das PE auf der Schichtseite ist mit dem Weißpigment Titandioxid (TiO2) gefärbt.
PE-Papier kann in Maschinen verarbeitet werden, ist im feuchten Zustand stabil, hat kurze Wässerungszeiten, liegt plan und ist dimensionsstabil.
Nachteilig ist, dass die PE-Schicht spröde wird und evtl. aufreisst (resin cracking), wenn das PE-Polymer oxidiert. Das kann passieren, wenn das TiO₂ mit UV-Licht zu Ti₂O₃ reagiert, wodurch sich freie Radikale bilden; diese können auch das Silberbild verändern. Die Hersteller verwenden zwar entsprechende Stabilisatoren, diese verzögern das Problem jedoch nur. ⭬ Tonung oder ein Stabilisierungsbad würden zumindest gegen die Veränderung des Silberbildes helfen, das wird bei PE-Prints jedoch selten gemacht. PE-Papier ist außerdem empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und chemischen Umweltbelastungen (z. B. Lösungsmitteldämpfe).
PE-Papier ist zwar deutlich einfacher zu verarbeiten als Baryt-Fotopapier, aber eben nicht annähernd so langzeitstabil.
- Barytpapier
- Stärke
- Oberfläche
- Bildton
warm (⭬ warmton), neutral, kalt; Eigenschaft der fotogr. Schicht und abhängig von der Größe und Struktur des entwickelten Bildsilbers: Größere Silberkörner ergeben einen kälteren, feinere einen wärmeren Bildton; Entwicklung, Tonung und die Art der Trocknung beeinflussen den Bildton. - P-Wert (Lichtempfindlichkeit nach ISO)
ISO-P-Werte geben die Lichtempfindlichkeit des Papiers an. Diese Werte sind jedoch nicht vergleichbar mit den ISO-Werten für die ⭬ Filmempfindlichkeit.
Für die Nutzung in der Dunkelkammer hat der Wert der Papier-Empfindlichkeit keine praktische Bedeutung; für die Nutzung des Fotopapiers als Papiernegaiv in Kameras kann man seine Tests mit einem Filmempfindlichkeits-ISO-Wert von 6 starten (Ilfords Multigrade FB Classic). Warmton-Papiere sind etwa halb so empfindlich wie die Normalton-Papiere, ebenso die harten Papiere (Grad. 4 und 5). - maximale Schwärzung
deutlich über D = 2.0 - R-Wert (Kopierumfang nach ISO-Norm 6846; range)
Maß dafür, welcher Negativkontrast auf dem Papier abbildbar ist (R40 bis R190); exakter als die herstellerspezifische Gradationszahl. Der R-Wert ist hundert Mal der log.-Wert der Belichtungs-Spanne, die den kompletten Dichteumfang des Papiers erzeugt. Der R-Wert 120 bedeutet beispielsweise, dass es sich um eine weiche Papiergradation handelt, die einen log. Negativdichte-Umfang von 1.2 abbilden kann (≙ 1 : 16 oder 4 Blendenstufen).
Laut Datenblatt erreicht Ilfords Multigrade FB Classic bei der Filterung 5 einen R-Wert von 50 (≙ 1∶3 und bei der weichsten Gradation mit Filterung 00 einen R-Wert von 170 (≙ 1 : 50); während das Fomabrom Variant III max. einen R-Wert von 160 erreicht (≙ 1 : 40). - bzw. Gradationszahl
traditionelles Maß für die Gradation eines Fotopapiers; nicht genormt, die Zahlen der einzelnen Papiersorten sind daher nur bedingt vergleichbar.
Gradationszahlen werden angegeben von 00 (sehr weich; große R-Werte; für Negative mit hohem Kontrast) bis 5 (sehr hart; kleine R-Werte; für Negative mit geringem Kontrast)
Foma gibt keine Zahlen an sondern benennt die Gradationen: soft (R-Wert: 120), special (R-Wert: 100), normal (R-Wert: 180), hard (R-Wert: 60)
- festgraduiert
- kontrastvariabel
⭬ kontrastvariables Fotopapier - spektrale Sensibilisierung
Lit.:
- Processing and Finishing Ilford Resin Coated Papers. Ilford Technical Information. Harman technology Ltd. 2010-06. Online: ↱ ilfordphoto.com/amfile/file/download/file/1826/product/1944/ [2022-10-24]
- Wagner, Sarah S.: »An Update on the Stability of B+W Resin Coated Papers«. In: Topics in Photographic Preservation. Bd. 8. 1999. S. 60–66. Online: ↱ resources.culturalheritage.org/pmg-topics/1999-volume-eight/ [2022-10-24]
Fotopapier-Formate
Format ugs. cm in Anz. Blatt
≈ 1 m2Postkarte 10,5 × 14,8 (= DIN A6) 64 13 × 18 12,7 × 17,8 5 × 7 44 18 × 24 17,8 × 24,0 7 × 9,5 23 24 × 30 24,1 × 30,5 9,5 × 12 13 30 × 40 30,5 × 40,6 12 × 16 8 40 × 50 40,6 × 50,8 16 × 20 4 engl.: photo(graphic) print size
FP (Ilford)
FP: Fine Grain Panchromatic
mittelempfindlicher Schwarzweißfilm, klassische Kornstruktur
FP (1935)
FP 1 (1937)
FP 2 (1937)
FP 3 (1942)
FP 4 (1968)
FP 4 Plus (1990)
Fungus
G
Gegenlichtblende
Gelatine
Grundlage der lichtempfindlichen fotografischen ⭬ Schicht; siehe dort.
s. a. ⭬ Veganismus und Fotografie
engl.: gelatin
Generative Fotografie
Glaspilz, Fungus
Sporen von Ei- und Schlauchpilzen können Objektive befallen und dort auskeimen. Deren Stoffwechselprodukte schädigen die Glasoberflächen irreversibel.
Daher: Objektive sauber halten (der Pilz lebt ja nicht vom Glas), nicht anhauchen und belüftet lagern bei einer rel. Luftfeuchtigkeit < 60 %; also nicht in Kamerataschen oder irgendwelchen Beuteln, sondern in Kunststoffboxen mit Kieselgel (Silikagel) und idealerweise einem Feuchtigkeitsindikator.
Hilfe bei der Berechnung der Trockenmittelmenge:
↱ silicagel.de/Mengenberechnung/Wieviel-brauchen-Sie/ [2024-07-27]engl.: lens fungus
Golddruck, Chrysotypie
Lit.:
Ware, Mike: The Chrysotype Manual ; The Science and Practice of Photographic Printing in Gold. Trowbridge: Cromwell Press, 2006
Ware, Mike: Prints of Gold: the Chrysotype Process Re-invented. o. D.. Online: ↱ mikeware.co.uk/mikeware/Prints_of_Gold.html [2024-07-26]
engl.: gold print; chrysotype
Gradation γ
Bezeichnung für die Steigung des geradlinigen Teils der ⭬ Schwärzungskurve einer fotogr. ⭬ Schicht: Maß für die Kontrastwiedergabe des Materials.
Eine Schicht mit steiler Gradation überträgt geringe Motivkontraste in hohe Bildkontraste (»hart« arbeitendes Material), eine »weiche« Schicht mit flacher Gradation bildet starke Motivkontraste als geringe Bildkontraste ab. Eine flache G. ermöglicht also einen großen Belichtungsspielraum (typisch für das übliche Aufnahme-Negativmaterial; γ ≈ 0,7), während eine steile G. wenig Belichtungsspielraum bietet (typisch für ⭬ Diamaterial; γ ≈ 1,4).
Graufilter, Neutraldichtefilter, ND-Filter
G. filtern nicht, sondern bewirken eine farbneutrale Lichtreduktion. Sie werden vor allem mit Filmkameras genutzt, da dann die Belichtungszeit fix ist, man aber aus gestalterischen Gründen eine bestimmte ⭬ Blendenzahl benötigt.
Aber auch in der Fotografie gibt es Anwendungen für G. – beispielsweise weil man mit offener Blende fotografieren will (z. B. Portrait), dies jedoch zu einer zu kurzen Verschlusszeit führen würde. Oder aber, wenn man sehr lange Belichtungszeiten benötigt (z. B. Landschaft, Architektur).
⭬ Schwarzschildeffekt und mögliche Farbverschiebungen beachten!
Der Verlängerungsfaktor ist üblicherweise auf dem Filter angegeben: entweder der lineare Verlängerungsfaktor oder indirekt über den log. Dichtewert x (der lineare Verlängerungsfaktor ist dann 10^x).
Ein Filter der Dichte 0.3 lässt die Hälfte der auftreffenden Lichtmenge durch [log₁₀ (2) ≈ 0,3] und jede weiteren 0.3 wiederum je die Hälfte; hat der Filter eine Dichte von 0.6, lässt er also 25 % passieren, hat er eine Dichte von 2.0, kommt nur noch 1 % der auftreffenden Lichtmenge durch.
Blendenstufen (gerundet)
= log₂ (10) · Dichte
= log₂ (Verlängerungsfaktor)Dichte (log.)
= log₁₀ (2) · Blendenstufen
= log₁₀ (Verlängerungsfaktor)Verlängerungsfaktor (linear, gerundet)
= 2^Blendenstufen
= 10^Dichte0 0.0 † 1 1 0.3 2 2 0.6 4 3 0.9 8 3 ⅓ 1.0 10 4 1.2 16 5 1.5 32 6 1.8 64 6 ⅔ 2.0 100 10 3.0 1000 13 ⅓ 4.0 10 000 16 ⅔ 5.0 100 000 20 6.0 1 000 000 † Klarglas›filter‹ (clear filter), als Schutz für die Frontlinse
Kombiniert man Graufilter, addieren sich die Dichten. Der wirksame Verlängerungsfaktor ergibt sich aus dem Produkt der einzelnen Verlängerungsfaktoren.
G. können mit ⭬ Farbfiltern kombiniert werden. Da unter dem Kombinieren von Filtern die Bildqualität immer ein bisschen leidet, gab es einige häufig genutzte Kodak-Wratten-Filter als Kombinationsfilter mit einer Neutraldichte; z. B. # 8N5, den mittleren Gelbfilter + 0.5 ND oder # 85N6, den Farbkonversionsfilter inkl. 2 Blenden ND.
Beachte: Zum Schutz der Retina muss ein ND-Filter für die direkte Sonnenbeobachtung mind. eine Dichte von 5.0 haben – auch im UV- und im IR-Spektrum!
engl.: ND filter, neutral-density filter
s. a. ⭬ Grauverlaufsfilter
Graukarte
Hilfsmittel zur ⭬ Belichtungsmessung: Eine Seite ist neutralgrau und reflektiert 18 % des auftreffenden Lichts, die andere Seite ist weiß und reflektiert 90 % (± 1 %); idealerweise metameriefrei und über das ganze sichtbare Spektrum in gleichem Maße (z. B. Kodak R-27).
Zur Ermittlung der Belichtungsparameter wird die G. an die Stelle des Motivs gehalten, mit demselben Licht beleuchtet und die graue Seite aus Aufnahmerichtung angemessen (Objektmessung nur auf die G.).
Ist so wenig Licht vorhanden, dass der Belichtungsmesser nicht reagiert, wird die weiße Seite angemessen und gegenüber der Messung 2 ⅓ Blenden knapper belichtet.
Die G. wird nicht senkrecht zur Aufnahmerichtung gehalten, sondern gekippt (jeweils ⅓ der horizontalen und vertikalen Winkel, mit denen das Hauptlicht auf das Objekt scheint). Wichtig ist, dass kein Schatten auf die G. fällt und keine grellen Reflexionen zu sehen sind (G. evtl. leicht verdrehen).
Um das Verhältnis zwischen Haupt- und Aufhelllicht zu messen, wird eine Messung mit beiden Lichtern gemacht und eine zweite nur mit dem Aufhelllicht.
Unterschied in Blenden Verhältnis 1 2:1 1 ⅔ 3:1 (klassisch für Farb-Portraits) 2 4:1 2 ⅓ 5:1 (klassisch für Schwarzweiß-Portraits) 2 ⅔ 6:1 3 8:1 3 ⅓ 10:1 Bei Reproduktionen wird die G. zur Lichtmessung an Stelle der Vorlage plaziert und die Aufnahme gegenüber der Messung um ½ Blende knapper belichtet (evtl. ⭬ Verlängerungsfaktor beachten).
Die G. ist auch nützlich zur Bestimmung der Farbbalance bei der Ausarbeitung von Farbaufnahmen: Man macht beim selben Licht eine separate Aufnahme mit der G. im Bild, um damit beim Vergrößern die Neutralfilterung zu bestimmen. Wichtig: Die üblichen Farbfilme erzeugen jedoch auch bei korrekter Farbtemperatur des Lichts mit Rücksicht auf gute Hauttöne kein wirklich neutrales Grau. Den besten Bildeindruck ergibt daher häufig eine korrigierte Filterung, bei der die G. dann nicht mehr perfekt neutralgrau erscheint.
Eine Aufnahme der G. ist auch nützlich zur Bestimmung der Filmdichte (⭬ Densitometer), z. B. zur Qualitätskontrolle nach der Entwicklung.
Die G. eignet sich auch dazu, regelmäßig (mit derselben Lichtquelle) den ⭬ Belichtungsmesser zu prüfen.
engl.: grey card; gray card
s. a. ⭬ Belichtungsmesser
Graukeil
Grauverlaufsfilter
-
Ein G. ist zur Hälfte neutral grau gefärbt, die andere Hälfte ist klar; dazwischen ist je nach Typ ein mehr oder weniger weicher Übergang. Wird gerne in der Landschaftsfotografie verwendet, um einen zu hellen Himmel abzudunkeln.
engl.: graduated neutral-density filter, graduated ND filter
s. a. ⭬ Graufilter
-
Großformat
Sammelbegriff für Filmformate ab etwa Postkartengröße für die Großformatfotografie mit ⭬ Fach- und ⭬ Lochkameras, meist als ⭬ Planfilm; für Luftbildkameras gibt es Großformatfilm auch als ⭬ Rollfilm.
s. a. ⭬ Ultra Large Format
engl.: large format
Großlabor
s. a. ⭬ Fachlabor
Gummidruck-Verfahren
Negativ-Positiv-Prozess; ⭬ vegan
Der G. ist kein Druckverfahren, sondern dient zur Herstellung von Einzelblättern; er wird den kunstfotografischen ⭬ Edeldruckverfahren zugeordnet und war bei den Piktorialisten ab dem späten 19. Jahrhundert sehr beliebt.
Das Verfahren nutzt in der lichtempfindlichen ⭬ Schicht keine Silberhalogenide, sondern eine Mischung aus Ammonium- bzw. Kaliumdichromat ⚠, Gummiarabikum (oder anderen Kolloiden) und einer wasserlöslichen Farbe, die auf feuchtstabiles Papier aufgebracht wird. Ist die Schicht getrocknet, wird sie im ⭬ Kontakt mit dem Negativ unter UV-Licht/
Sonne belichtet. Die belichteten Stellen werden dabei ›gegerbt‹, sie verhärten und werden wasserunlöslich. Entwickelt wird durch gründliches Wässern, wobei die unbelichteten Stellen ausgewaschen werden. Der trockene ⭬ Print ist langzeitstabil. Für mehrfarbige G. wird dieser Vorgang mehrmals ausgeführt; ein Problem ist allerdings die Registerhaltigkeit, da das Papier durch das viele Wässern nicht formatstabil bleibt.
Der G. kann auch über einem ⭬ Platindruck mit dem selben Negativ ausgeführt werden.
Alternativ kann die Schicht ohne Wasserfarbe angerührt und der Prozess wie beschrieben ausgeführt werden. Das gut getrocknete Blatt wird mit einer Ölfarbe eingerieben. Die Schattenpartien werden gefärbt, die gegerbten Stellen (Lichter) dagegen nehmen keine Farbe an. Ein abschließendes Alaun-Bad klärt das Bild.
⚠ Ammonium- und Kaliumdichromat gelten als ↱ besonders besorgniserregende Stoffe | ↱ substances of very high concern (SVHC)
engl.: gum bichromate printing process, photo-aquatint process
H
H & D curve
(nach Ferdinand Hurter (1844–1898) und Vero Charles Driffield (1848–1915))
Halbformat
⭬ Kleinbildfilm-Aufnahmeformat in Halbformat-Kameras: 18 × 24 mm; verglichen mit dem typischen 24 × 36 mm-Kleinbildformat doppel so viele Bilder pro Filmpatrone
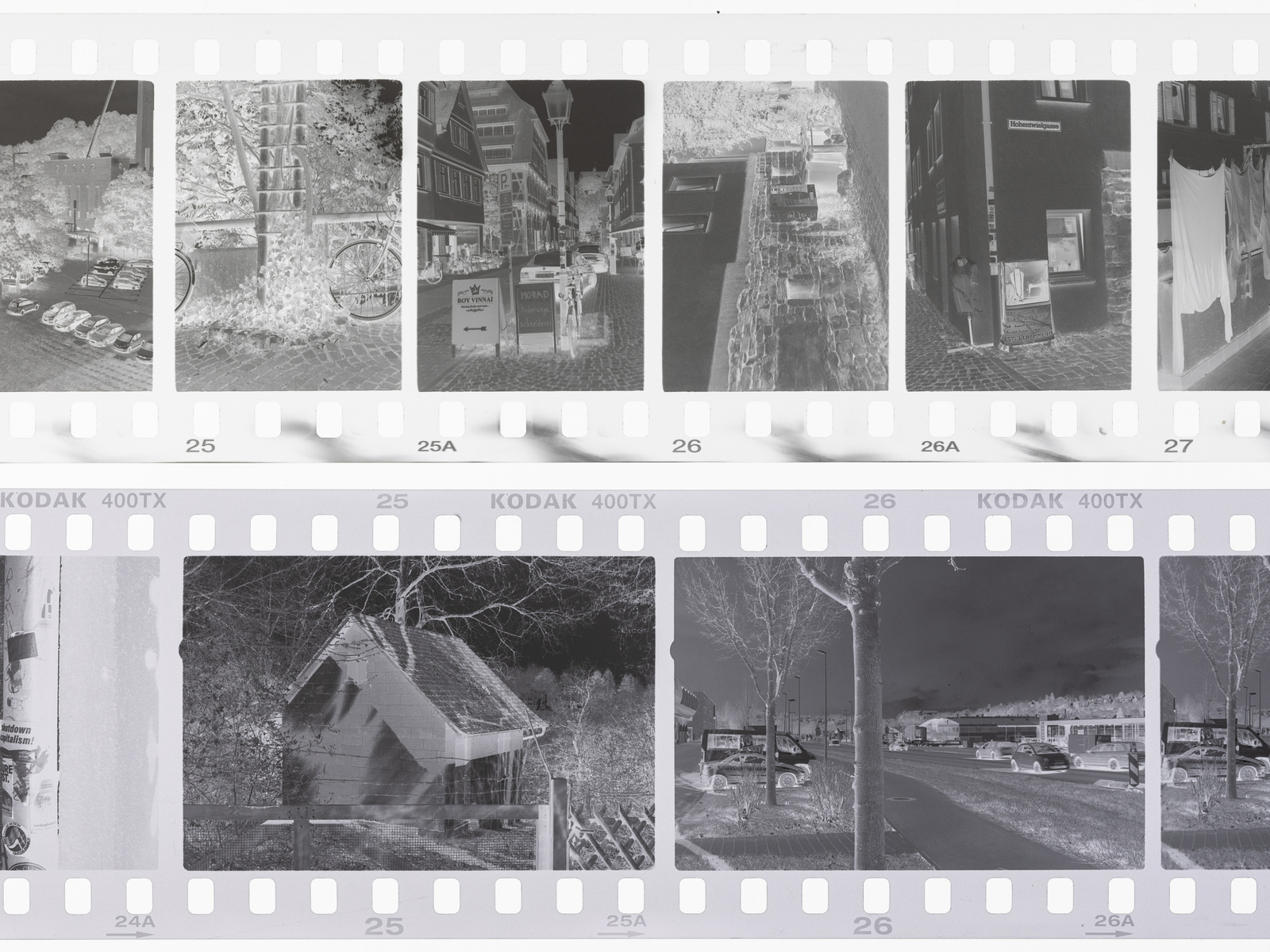
Halbformat- und Kleinbildnegative im Vergleich: Bei ›normaler‹ Kamerahaltung entstehen mit den meisten Halbformatkameras hochformatige Bilder.
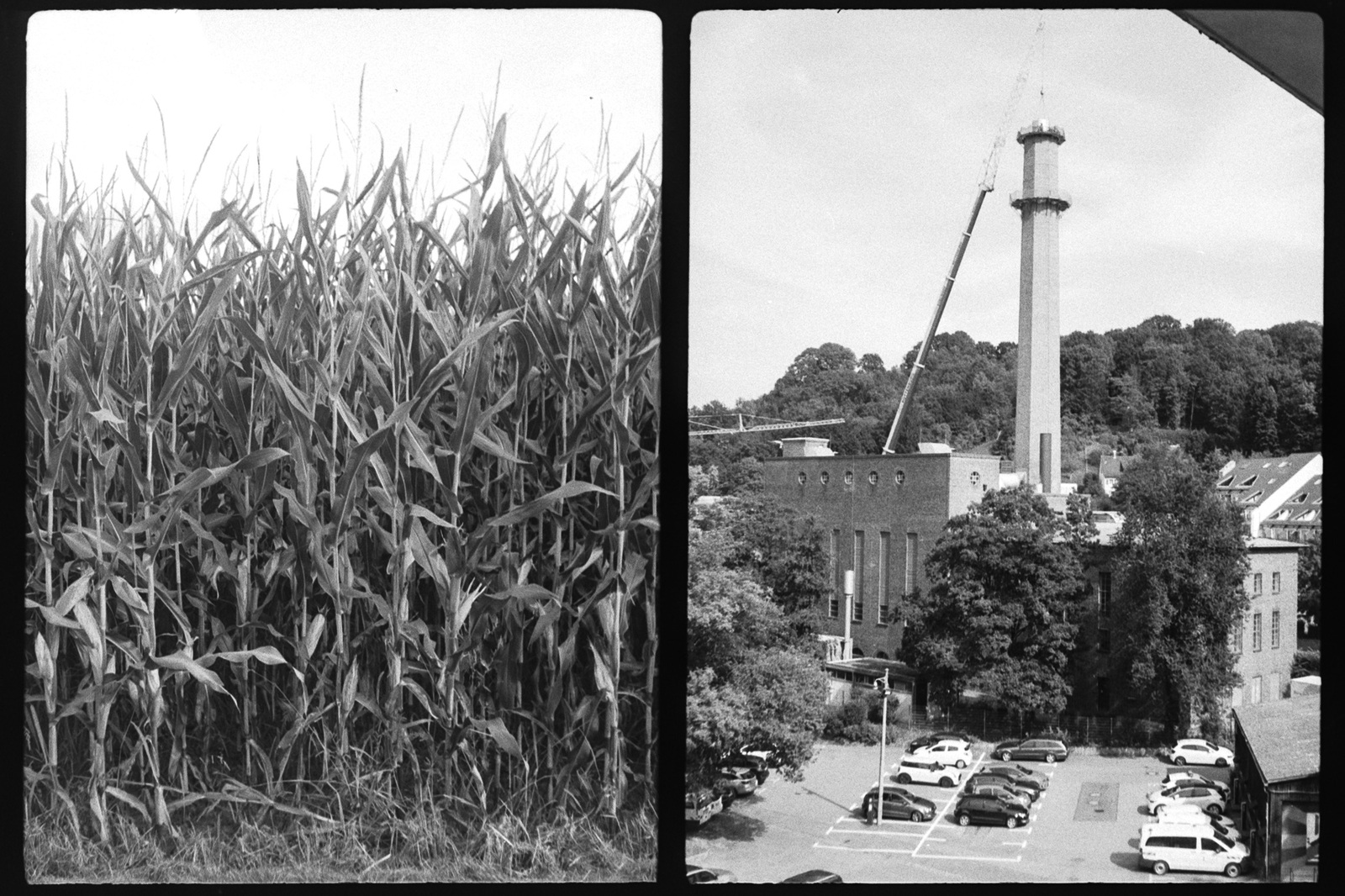
Zwei nacheinander aufgenommene Halbformatnegative ergeben ein ⭬ Diptychon. Das kann reizvoll sein, wenn bei der Ausarbeitung im Großlabor zwei Bilder ›zufällig‹ gepaart werden.
Arbeiten von mir, die mit einer Halbformatkamera entstanden sind:
「Globalisierung konkret」 (2017)
「Celebi heimholen」 (2011)
Lit.:
Frech, Martin: »Agfa Parat-I«. In: Notizen zur Fotografie. 9. April 2007. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2007-04-09/Agfa_Parat-I.html [2023-05-12]
engl.: half-frame, single-frame
Halbtonbild
engl.: continuous-tone image
s. a. ⭬ Strichbild
Handabzug
Hängung, Wandgestaltung
-
Blockhängung (Rasterhängung)
Beispiele:

Martin Frech: → 「Verfallende Kaimauer an der Prorer Wiek」 (2017)
(schaelpic photokunstbar, Köln; Mai 2019)
Martin Frech: → 「Dieter zeichnet」 (2011)
(Kulturhalle, Tübingen; 2011) -
Diptychon
-
Einzelhängung
Beispiel:

Martin Frech: → 「Bilderschachtel」 (2014)
(Kunstaktionstag Tübingen, 2014) -
Horizontale Hängung (Reihenhängung)
-
Kantenhängung
-
Petersburger Hängung (Salonhängung)
schön erklärt bei Foto-Paradies: ↱ fotoparadies.de/inspiration/petersburger-haengung.html [2024-01-01]
engl.: Petersburg hanging; salon style hanging
-
Triptychon
Beispiel:
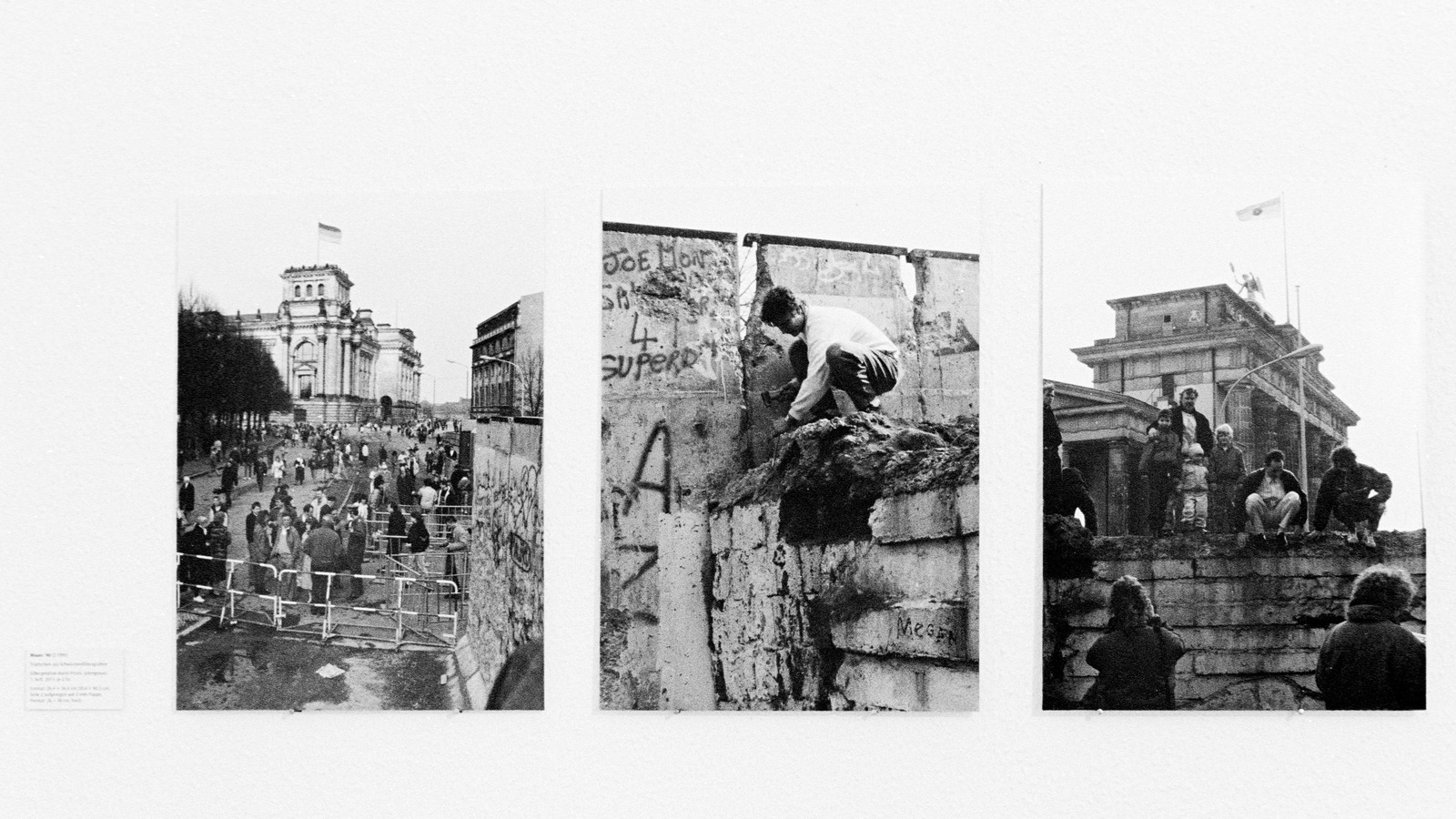
Martin Frech: → 「Mauer ’90」 (1990)
(M2O, Tübingen; 2013) -
Vertikale Hängung (Reihenhängung)
engl.: hanging; wall design
s. a. ⭬ Passepartout
-
Härtebad
Das Härten kann ein Schritt im ⭬ Entwicklungsprozess konventioneller fotogr. ⭬ Schichten sein.
Ein H. macht die Emulsion i. d. R. nicht härter im Sinne von ›kratzfester‹, sondern schützt die Gelatine vor zu starkem Aufquellen in warmen Bädern (Ilford empfiehlt den Härter-Zusatz bei einer Wässerungstemperatur von > 30 °C); das Wässern dauert dann allerdings bis zu viermal länger.
Härtende Substanzen sind Kali- bzw. Chromalaun oder Formalin; entweder als Zusatz zum ⭬ Fixierbad (Härtefixierbad) oder als separate Lösung vor der Schlusswässerung.
Bei den üblichen Badtemperaturen (20 °C bis 24 °C) verzichtet man auf das H. zugunsten einer kürzeren Wässerungszeit.
Lit.:
»Hardening Baths«, in: Encyclopedia of Practical Photography, Bd. 8, Garden City (NY): 1978, S. 1308 f
Verarbeitung von SW-Filmen. Firmenschrift Ilford. Okt. 2022
s. a. ⭬ Tropen
engl.: hardening bath
HC-110 bzw. High Concentrate Developer (ursprünglich Kodak)
proprietärer ⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilme; enthält ⭬ Hydrochinon ⚠
HC-110 ist ein flüssiges Konzentrat mit einer sirupartigen Konsistenz, das zur Verwendung als Einmalentwickler stark ⭬ verdünnt wird (HC: High Concentrate).
Zur Kennzeichnung der üblichen Verdünnungen werden Buchstaben verwendet. Kodak hat die Verdünnungen A bis F spezifiziert – G und H sind ›nicht-offizielle‹ Varianten:
Kennzeichnung Verdünnung des Konzentrats A 1∶15 B 1∶31 C 1∶19 D 1∶39 E 1∶47 F 1∶79 G 1∶119 H 1∶63 Pro Film sollten jedoch mind. 4 ml Konzentrat genutzt werden.
2019 wurde die Formulierung für HC-110 geändert, allerdings so, dass die Verdünnungen und Entwicklungszeiten weiterhin gelten; ich habe auch nicht festgestellt, dass das neue Produkt andere Bildergebnisse zeitigt als das ältere. Die Inhaltsstoffe und die Viskosität sind jedoch verschieden zur Originalversion, eigentlich wäre ein neuer Name angebracht gewesen. Das Alleinstellungsmerkmal des Originalprodukts war, dass das Konzentrat kein Wasser enthielt, daher seine legendär lange Haltbarkeit (auch wenn das von Kodak nicht garantiert war und in der Praxis auch irrelevant ist); das ist beim neuen HC-110 nicht gegeben.
↱ Website für das neue HC-110 [2025-06-04]↱ Kodak-Datenblatt des originalen HC-110 (vor 2019) [2022-07-23]
Adox hat 2025 zusätzlich zum 110 Professional Entwickler (= Adox-Abfüllung des Photo-Systems-Konzentrats) mit HC-110 Professional ein Produkt auf den Markt gebracht, das angeblich nach der Originalrezeptur hergestellt wird und wieder die lange Haltbarkeit sowie das Arbeiten mit hohen Verdünnungen ermöglichen soll.
Weitere Alternativen: Ilford Ilfotec HC (↱ Datenblatt [2022-07-23]) und Bellini Euro HC (↱ Datenblatt [2024-01-04])
Lit.:
Covington, Michael A.: Kodak HC-110 Developer ; An Unofficial Resource Page. o. D. Online: ↱ covington
innovations.com/hc110/ [2023-12-27]El Mozayen, Marwan: »ADOX HC-110 Professional ; Celebrating the Return of a War Hero«. In: SilvergrainClassics (Webseite). 27. Jan. 2025. Online: ↱ silvergrainclassics.com/en/2025/01/adox_hc-110/ [2025-02-17]
Troop/
Anchell (2020), S. 74 ff. [⭬ Literatur]
Heißaufziehpresse
engl.: dry mounting press
Hi 16 (hist.)
Produktionsverfahren für ⭬ 16 mm-Film; 1990 vorgeschlagen von dem Dokumentarfilmer Peter Krieg (1947–2009), der dafür im März 1990 die int. »Hi 16 Coalition« gründete.
Der Hi 16-Standard:
– Bildaufnahme: ⭬ Super 16
– Filmmaterial: einseitig perforiert, ⭬ Flachkristall-Emulsion
– Optiken: hochauflösend
– Ton: stereo, digital aufgenommen (DAT), min. 10–15.000 Hz
– Tonbearbeitung: mit Dolby SR
– Abtastung: idealerweise vom Negativ
– ⭬ Projektion: Super-16-Projektor mit gekoppeltem CD-I- oder DAT-Player
Es sind zwei Publikationen erschienen:Hilfsverschluss
Variante eines ⭬ Kameraverschlusses
s. a. ⭬ Schieber
engl.: secondary shutter
Holga (Kamera)
einfache Sucherkamera aus Kunststoff für 120er-Rollfilm; Brennweite: 60 mm; Aufnahmeformat: 6 × 6 cm oder 4,5 × 6 cm; fixe Verschlusszeit (ca. ¹⁄₁₀₀ s); frühe Modelle haben eine, spätere zwei Blenden (ca. f/8; f/11)
Die originale H. wurde von Lee Ting-mo 1981 als kostengünstige ›Volkskamera‹ konstruiert und bis 2015 in Hongkong hergestellt; millionenfach verkauft wurde sie jedoch vor allem in den Westen, wo sie als ⭬ Toy Camera geschätzt wird.
Deutlich befördert wurde die H.-Begeisterung durch ↱ David Burnetts [2024-07-27] fotojournalistische Arbeiten (v. a. zu Al Gores Wahlkampagne 2000), die dieser mit einer H. fotografierte.
Neben dem hier vorgestellten Modell 120N gab und gibt es noch viele andere H.-Varianten – Loch, Stereo- und Panoramakameras, Modelle für Kleinbildfilm und mit eingebautem Blitz usw.
Arbeiten von mir, die mit der H. entstanden sind:
Holga 120N Typ Sucherkamera Sucher Durchsichtsucher ohne Parallaxenausgleich Objektiv »Optical Lens«; 1:8/60 mm, nicht wechselbar Blendeneinstellungen zwei: Wolken (ca. f/8) und Sonne (ca. f/11)
(bei meinem Modell wirkungslos)Filtergewinde ― Naheinstellgrenze ca. 1 m Fokusierung stufenlos; vier Symbole für Bereichsfokusierung: 1 Person (1 m) | 3 Personen (2 m) | 7 Personen (6 m) | Berge (∞) Belichtungsmesser ― Verschluss Verschlusszeiten B (Bulb, Langzeitbelichtung) und N (ca. ¹⁄₁₀₀ s)
keine DoppelbelichtungssperreAnschluss für ⭬ Drahtauslöser ―
(3D-gedruckter Adapter erhältlich)Selbstauslöser ― Filmtransport manuell per Drehrad; rotes Filmnummernsichtfenster, umschaltbar für 12 und 16 Aufnahmen ⭬ Blitzsynchronanschluss ― Zubehörschuh Standard-Mittenkontakt-Blitzschuh eingebauter Blitz ― ⭬ Stativgewinde ¼″ ⭬ Filmtyp 120er-⭬ Rollfilm Aufnahmeformat 6 × 6 cm und 4,5 × 6 cm (hoch; mit Einlegemaske) Stromversorgung ― Maße (B × H × T, cm) 14 × 10 × 8 Gewicht 215 g (mit Film und Aufwickelspule) Zubehör Objektivdeckel, Filmspule, Maske für 4,5 × 6 cm, Handschlaufe Hersteller 1982 bis 2015: Universal Electronics, Ltd. (Hongkong)
seit 2016: Zhongshan Sunrise Studio Equipment Co., Ltd. (China)Lit.:
Bates, Michelle: Plastic Cameras ; Toying with Creativity. 2. Aufl. Burlington (MA, USA), Oxford (UK): Focal Press (Elsevier), 2011. ISBN 978-0-240-81421-6
Dowling, Stephen: The simple cult camera that inspired Instagram. 14. Nov. 2017. Online: ↱ bbc.com/future/article/20171113-the-toy-camera-that-inspired-instagram [2024-05-29]
Hinterseer, Claudia: »The Hong Kong-made toy cameras that triggered a retro photography trend«. (= Cultured; 3) Video für die South China Morning Post. 4. Feb.2024. Online: ↱ youtube.com/watch?v=ZeVYrmIIwpA [2024-05-25]
Okazaki, Manami: »The Holga story: a cheap plastic camera made in Hong Kong and how it became a cult classic«. In: South China Morning Post. Hongkong. 19. Mai 2017). Online: ↱ scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/2094833/holga-story-cheap-plastic-camera-made-hong-kong [2024-05-05]
s. a. ⭬ Boxkamera; ⭬ Toy Camera
Holgarama
Bei der ⭬ Holga-Kamera ist der Filmtransport nicht mit dem Spannen des ⭬ Verschluss’ gekoppelt. Das nutzt man aus, um mittels überlagerter Belichtungen ein Panorama zu fotografieren:
die 6 × 6 cm-Maske nutzen, dennoch den Schieber des Filmnummernsichtfensters auf ›16‹ schieben
Kamera waagerecht auf ein Stativ montieren
von links nach rechts fotografieren: nach jeder Aufnahme die Kamera um 45° nach rechts drehen (acht Aufnahmen für eine 360°-Ansicht)
Film so transportieren, als wäre die 4,6 × 6 cm-Maske eingelegt (ca. 30 Klicks), dadurch überlagern sich die einzelnen Bilder zu einem langen Bildstreifen, dem Holgarama.
So wird das ein ›perfektes‹ H.
Experimentierfreudige verzichten aufs Stativ, variieren den Filmtransport, fotografieren vertikal oder doch von rechts nach links …Das Prinzip ist auf alle Kameras mit ›freiem‹ Filmtransport und ohne Doppelbelichtungssperre übertragbar.
Holografie, Holographie
engl.: holography
HP (Ilford)
HP: Hypersensitive Panchromatic
Hochempfindlicher Schwarzweißfilm, klassische Kornstruktur
HP (1935)
HP 2 (1937)
HP 3 (1941)
HP S (1953 – 1969)
HP 4 (1965)
HP 5 (1976)
HP 5 Autowinder (1982)
HP 5 Plus (1989)
Hybrider Workflow
-
auf Film fotografieren, diesen ⭬ entwickeln, das Negativ/
⭬ Diapositiv jedoch nicht analog im Fotolabor ausarbeiten, sondern digitalisieren, am Computer bearbeiten und die Datei als Bild ausdrucken Die einfachste Methode ist m. E., das Negativ mit einer Digitalkamera abzufotografieren und die Datei in einem Bildbearbeitungsprogramm in ein Positiv umzuwandeln. Solange das Programm die Möglichkeit bietet, Gradationskurven für die einzelnen Farbkanäle zu bearbeiten, sind keine weiteren Programme/
Plug-Ins nötig. Wer kein entsprechendes Programm hat, nutzt Digitaliza, ein Online-Tool der Fa. ⭬ Lomographic Society:
↱ lomography.tools/digitaliza [2024-05-29]Weitere hilfreiche Links:
↱ Gleb Shtengel: Infos zur Wartung/
Reparatur von Nikon-Scannern [2023-12-08]↱ Das VueScan-Blog der Hamricks [2024-05-29]
-
digital fotografieren, die Bilddatei als Negativ auf Folie ausdrucken und dieses Negativ auf Fotopapier ⭬ im Kontakt umkopieren
If one was going to all the trouble to shoot film I’d assume it would be in order to print it on wonderful emulsion rich photographic paper. I guess only the Digi-Kinder who’ve never tasted photographic perfection would be sated by the weak brew that is digital scanning plus ink jet printing. None for me thanks. (Kirk R. Tuck, 23.08.2022)
-
Hydrochinon (⚠; chem. Verbindung: C₆H₆O₂)
Xn: gesundheitsschädlich | N: umweltgefährlich
↱ CAS-Stoffdatenbankwichtiges Reduktionsmittel in der Fotochemie; Bestandteil ziemlich vieler ⭬ Entwickler; Kodak nannte H. ›Quinol‹, bei ORWO hieß es ›Entwicklersubstanz H 142‹.
H. steht im Verdacht, ein für uns und die Umwelt problematischer Stoff zu sein. Für viele Entwickler gibt es Alternativprodukte ohne Hydrochinon – es spricht ja nichts dagegen, diese zumindest auszuprobieren. Als Universalentwickler für Schwarzweißnegativfilme empfehle ich ⭬ XTOL (oder einen der Clone), als Positiventwickler ⭬ ECO 4812.
engl.: Hydroquinone
I
ICC-Profil
ID-11 (Ilford)
proprietärer ⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm; ähnlich ⭬ D-76
↱ Datenblatt [2022-07-23]
enthält ⭬ Hydrochinon ⚠
Ilfochrome (hist.)
Infrarot-Fotografie
Infrarotstrahlung beginnt bei ca. 780 nm/
385 THz (= nahes Infrarot) und damit ›unterhalb‹ (infra) des sichtbaren roten Lichts (Frequenz = Lichtgeschwindigkeit ÷ Wellenlänge). Herkömmliche ⭬ panchromatische Schichten sind nur bis ca. 680 nm sensibilisiert. Schwarzweiß-Infrarot-Filme waren dagegen empfindlich vom UV bis ca. 900 nm, außer für Grün (↱ Kodak HIE [2024-07-27]); es gab auch Infrarot-Farbfilme (⭬ Falschfarbenfilm). Werden UV und das sichtbare Licht durch starke Rotfilter gesperrt, bildet der Film das nicht sichtbare ›infrarote Bild‹ ab. Fokusdifferenz beachten: Wie gewohnt Scharfstellen und dann die Einstellung auf die Infrarot-Markierung übertragen.
Echte Infrarot-Filme werden nicht mehr produziert; man kann den Effekt von Schwarzweiß-Infrarotfilm simulieren mit ⭬ superpanchromatischen Filmen.
engl.: infrared photography
Lit.:
Spitzing, Günter: Moderne Infrarot- und UV-Fotografie. 3. Aufl. Augsburg: Augustus, 1992
s. a. ⭬ Falschfarbenfilm
Instamatic (Kodak; hist.)
Kodak-System von Kameras und Filmen rund um den ⭬ Kodak Film-Typ 126, eingeführt 1963. Kameras wurden produziert bis in die späten 1980er-Jahre (die Kodak Instamatic X-15F war die letzte), Kodak stellte die Instamatic-Filmproduktion am 31.12.1999 ein. Als letzter Hersteller gab Ferrania 2007 die Produktion von Instamatic-Film auf.
Es gibt 3D-gedruckte Adapter (›FakMatic‹) zum Befüllen mit 35 mm-Film; jedoch kommt nicht jede I.-Kamera mit der falschen Perforation klar. FPP bietet dafür korrekt perforierten 126er-Film an, allerdings ohne das Schutzpapier (Filmnummernfensterchen usw. abkleben): ↱ filmphotographystore.com/collections/126-film [2024-07-12].
35 mm breiter Rollfilm auf Papierträger in Einweg-Kunststoff-Kassette mit Codierung für die Filmempfindlichkeit (›Kodapak‹); einseitig 1 Perforationsloch pro Bild; Dia-/
Negativformat: 28,6 × 28,1 mm; Dias in Papprähmchen sowie Vergrößerungen der Großlabore wurden auf 26,5 × 26,5 mm maskiert. 1972 führte Kodak die ›Pocket Instamatic‹ mit dem ⭬ Kodak Film-Typ 110 ein; dasselbe Prinzip, nur kleiner.
Lit.:
Keppler, Herbert: Instant 35 mm. In: Modern Photography, 06/1963.
Instax
System aus Sofortbildkameras, -druckern und -filmen von Fuji mit drei verschiedenen Bildformaten (alles ⭬ Integralfilme):
Mini Square Wide Bildgröße 62 × 46 mm (hoch) 62 × 62 mm 62 × 99 mm (quer) Seitenverhältnis ≈ 2:3 1:1 ≈ 3:2 Blattgröße 86 × 54 mm (hoch) 86 × 72 mm (hoch) 108 × 86 mm (quer) 10 Aufnahmen pro Filmpack
Farb- und Schwarzweißfilme
⭬ Filmempfindlichkeit: ISO 800/30°
spektrale ⭬ Sensibilisierung: 5500 K (⭬ Tageslicht)
Entwicklungszeit nach dem Auswerfen: ca. 90 sWebsite d. Herstellers: ↱ instax.com [2024-05-20]
s. a. ⭬ Polaroid
Integralfilm
Variante eines ⭬ Sofortbildfilms, bei dem Negativ und Positiv nach der Entwicklung nicht getrennt werden.
s. a. ⭬ Trennbildfilm
interActiva (hist.)
Internationales Festival für interaktive Medien, gegr. von Peter Krieg (1947–2009); fand vier Mal statt:
14.–16.09.1992, Köln
09.–11.09.1993, Köln
13.–15.10.1994, Potsdam-Babelsberg
19.–21.10.1995, Potsdam-Babelsberg
Zu jeder Veranstaltung ist ein Programmheft erschienen:Lit.:
Frech, Martin: »3. interActiva 1994: Ein Festivalbericht.« In: Informer (Zeitung am Arbeitsbereich Informationswissenschaften an der FU Berlin) (1995) 5, S. 6–9. 🗎 pdf-Datei
interaktives Kino
isochromatisch
ISO-Wert
IT 8-Target (Kodak: Q 60-Target)
Vorlage mit definierten 24 Grau- und 264 Farbfeldern (aus verschiedenen Farbmodellen) für Durchsicht (IT 8.7/1) und Aufsicht (IT 8.7/2); nur für Positive; standardisiert seit 1993 (ANSI).
Die Vorlage dient zum Kalibrieren von Scannern: Da die Soll-Werte der Felder bekannt sind (zu jedem Target gehört eine Datei mit diesen Referenzwerten), können die durch Scanner-Fehler bedingten Abweichungen der Ist-Werte berechnet werden. Diese Korrekturwerte werden in einem ⭬ ICC-Profil gespeichert, womit scannerbedingte Farbfehler jedes Scans automatisch korrigiert werden. Es ist sinnvoll, ein Target aus dem zu scannenden Material zu nutzen, da der Scanner auf die Farbstoffe der unterschiedlichen Hersteller möglicherweise verschieden reagiert.
Bezugsquelle für günstige IT 8-Targets: ↱ Wolf Faust [2024-07-27]
Lit.:
KODAK Q-60 Color Input Targets. Firmenschrift Kodak TI-2045. Juni 2003.
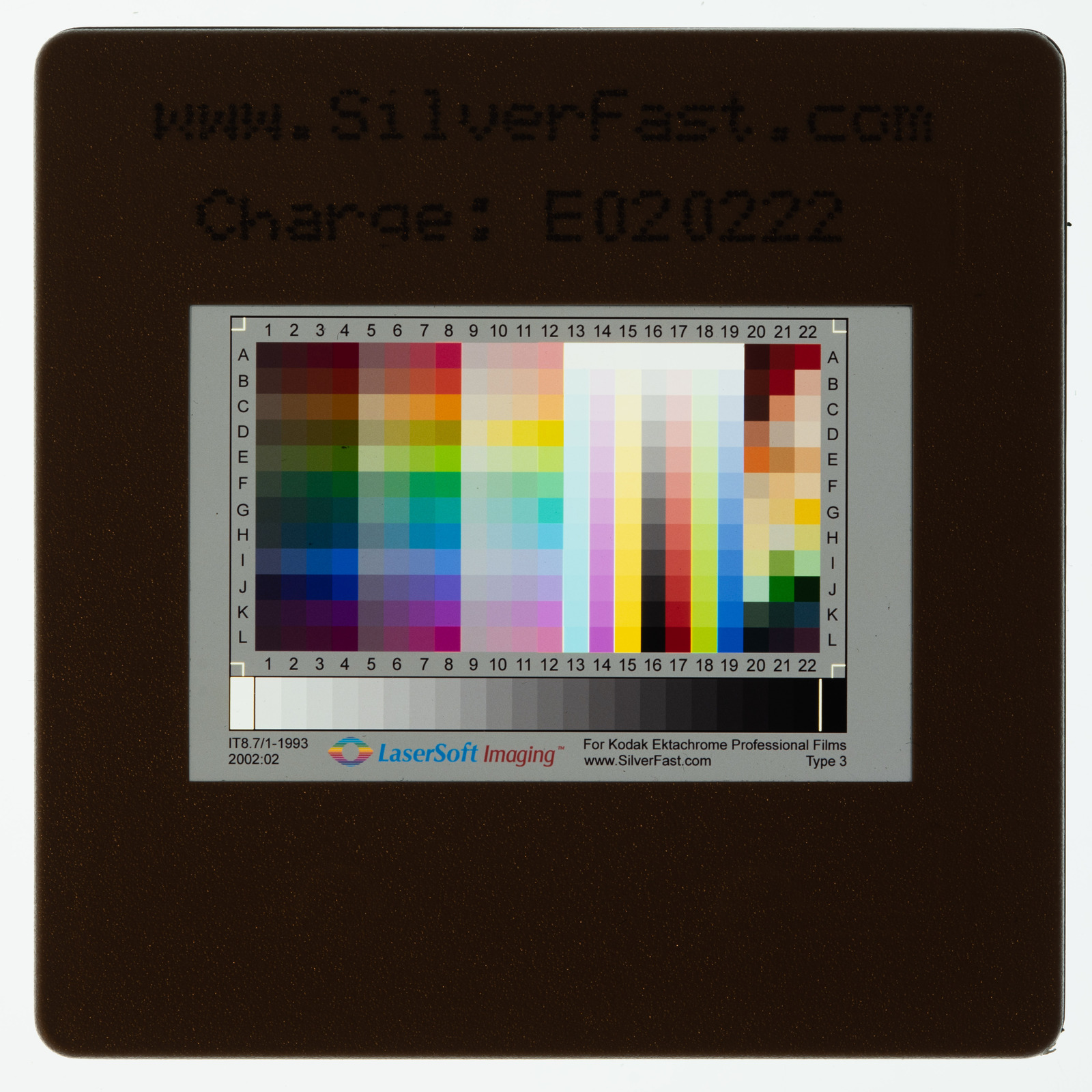
IT-8.7/1-Target (gerahmtes KB-Dia Kodak ⭬ Ektachrome, Lasersoft)
J
JCII und JMDC (Japan Machinery Design Center)
Abk. für Japan (Nippon) Camera and optical instruments Inspection and testing Institute, später geändert in Japan Camera Industry Institute
Das JCII wurde 1954 als herstellerunabhängige Einrichtung vom japanischen Staat gegründet, um die Qualität der Fotogeräte aus heimischer Produktion zu steigern und deren Reputation zu verbessern. Wenn Stichproben eines Produkts die Qualitätsprüfung des JCII (und des JMDC) bestanden hatten, bekam es den Aufkleber JCII passed JMDC. Das JMDC stellte sicher, dass das Produkt keine Kopie eines anderen Herstellers ist.
Lit.:
Kimata, Hiroshi: More than just a sticker? In: Modern Photography, April 1974
The last word. In: Popular Photography, 1957.
s. a. ↱ JCII Camera Museum [2024-07-27]
Jobo
Hersteller von Zubehör fürs ⭬ Fotolabor; bekannt vor allem für die ⭬ Tageslichtentwicklungsdosen und Rotationsentwicklungsmaschinen (ATL, CPE, CPP); gegr. 1923 von Johannes Bockemühl
Website: ↱ jobo.com [2024-07-27]
Lit.:
Kesberger, Andreas: »Das Joboläum ; eine 100-jährige Entwicklung«. In: Photonews, Nr. 10/2023, S. 4.
K
Kabinettformat
engl.: cabinet card
Kallitypie
engl.: kallitype
Kalotypie
engl.: calotype
Karat-Filmpatrone (Agfa; hist.)
Die erste Kleinbildkamera Karat von Agfa wurde 1937 vorgestellt. Der Kleinbildfilm für zwölf Aufnahmen befand sich gerollt (ohne Spule) in speziellen Blechpatronen und wurde beim Transportieren in die Aufwickelpatrone umgerollt; der Film wurde am Ende nicht zurückgespult. Wie beim ⭬ Rollfilm wurde die Filmpatrone nach dem Entnehmen des Films zur neuen Aufwickelpatrone.
Kaschieren, Aufziehen
Lit.:
Kesberger, Andreas: »Vom Leben nach dem Kleben ; Über das Kaschieren von Fotografien«. In: Photonews Nr. 9/2012, S. 26–27
Kerbcode
⭬ Planfilme sind an der kurzen Seite gekerbt; zwei Gründe:
- Sind die Kerben im Hochformat oben rechts, ist die ⭬ Schichtseite vorne; das vereinfacht im Dunkeln das Einlegen der Filme in die Kassetten.
- Art und Anordnung der Kerben sind filmspezifisch; das Prüfen des Codes vor der Entwicklung kann Missverständnisse verhindern.
engl.: notch code
Keykode (Kodak)
ausführlich in Frech [2017]
Lit.:Frech, Martin: »Kinefilm im Fotoapparat (z. B. via Cinestill): EASTMAN KEYKODE Numbers statt Bildnummern«. In: Notizen zur Fotografie. 7. Sep. 2017. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2017-09-07/Kinefilm-im-Fotoapparat.html [2022-06-04]
Kinefilm
Klappe, Filmklappe, Synchronklappe
Hilfsmittel beim Filmen mit separater Tonaufzeichnung, das beim Schnitt das Anlegen des Tons erleichtert (auch als Backup, wenn man mit Timecode arbeitet): Wenn die Tonaufzeichnung läuft (›Ton ab! … läuft.‹), wird die Assistentin gerufen, die Klappe ins Bild zu halten und zu schlagen (›Klappe!‹). Diese sagt zuerst die Klappenbeschriftung an (z. B. Szenennummer), dann wird die Kamera gestartet und die Klappe angefordert (›Klapp!‹). Der Assistent hält die Klappe komplett sichtbar ins Bild, schlägt sie und verschwindet aus dem Bild. Erst dann übergibt die Kamera an die Regie (›Bitte!‹).
Beim Dokumentarfilm (oder wenn die Einstellung sehr dunkel beginnt) ist auch die Schlussklappe üblich: Am Anfang der Einstellung sagt man nur ›Schlussklappe‹ ins Mikro. Vor Abschalten von Kamera und Ton schlägt man die umgekehrt gehaltene Klappe und macht die Ansage.
Klassisch sind schwarze Holzklappen, die mit Kreide beschriftet werden; das fühlt sich an den Händen unangenehm an. Da sich von Einstellung zu Einstellung jedoch meist nur die Zahlen auf der Klappe ändern, hat man (auf der Rückseite) daher meist einen Vorrat Zahlen auf einzelnen Stückchen Klebeband vorbereitet, die man vorne austauscht. Praktischer sind Klappen aus halbtransparentem Kunststoff (die Sticks sind weiterhin aus Holz), die man mit Boardmarkern beschriftet. Diese haben zudem den großen Vorteil, dass sie bei dunklen Szenen nicht extra beleuchtet werden müssen.
Beim Anlegen des Tons achtet man auf das Geräusch der zuklappenden Klappe, sucht das dazugehörige Bild und richtet beides synchron aus.
engl.: clapper board; clapboard
Kleinbild-Aufnahmeformate
Aufnahme-Formate auf ⭬ Kleinbildfilm; das ›klassische‹ Format ist 24 × 36 mm, daneben existieren viele weitere, z. B. ⭬ Halbformat, quadratisch (⭬ Robot, Rollei), Panoramaformate, Stereokamera-Formate.
Lit.:
- Frech, Martin: »100 Jahre Leica | 100 Jahre Kleinbildfotografie«. In: Notizen zur Fotografie, 2025-08-17. Online: ↱ medienfrech.de/foto/NzF/2025-08-17_Martin-Frech_100-Jahre-Leica_100-Jahre-Kleinbildfotografie.html [2025-08-21]
Kleinbildfilm
⭬ 35 mm-Film für ⭬ Kleinbild-Kameras; üblicherweise als Rollfilm in Patronen konfektioniert (⭬ Film-Typ 135); auch als ⭬ Meterware erhältlich
Min. Längen in konfektionierten Filmpatronen (ISO 1007-2000):
- 12 Aufnahmen: 689,91 mm
- 24 Aufnahmen: 1145,91 mm
- 36 Aufnahmen: 1601,91 mm
Lit.:
- Frech, Martin: »100 Jahre Leica | 100 Jahre Kleinbildfotografie«. In: Notizen zur Fotografie, 2025-08-17. Online: ↱ medienfrech.de/foto/NzF/2025-08-17_Martin-Frech_100-Jahre-Leica_100-Jahre-Kleinbildfotografie.html [2025-08-21]
Kleinbild-Kamera
Sammelbegriff für Fotoapparate, die ⭬ Kleinbildfilm nutzen; typisches Aufnahmeformat: 24 × 36 mm; es existieren viele weitere ⭬ Kleinbild-Aufnahmeformate.
Kleinstbild-Aufnahmeformate
Kleinstbildfilm
Sammelbegriff für Filmmaterial mit einer Breite schmaler als ⭬ 35 mm-Film zur Nutzung in ⭬ Kleinstbild-Kameras; meist in Kassetten konfektioniert; z. B. Pocketfilm (Kodak ⭬ Film-Typ 110), ⭬ Kodak Disc-Film, ⭬ Minox 8 × 11 mm, ⭬ 16 mm-Film in Rollei- oder Minolta-Kassetten; manche zählen auch das ⭬ APS- und das ⭬ Halbformat dazu.
Fan-Website: ↱ submin.com [2024-07-27]
Kleinstbild-Kamera
Sammelbegriff für Kameras, die ⭬ Kleinstbildfilm nutzen
Kompakte ⭬ 8 mm- oder ⭬ 16 mm-Kinefilm-Kameras im Einzelbildmodus sind eine interessante Alternative zu K. (so hat das z. B. Le Corbusier in den 1930er-Jahren gemacht).

Kleinstbildkamera Mycro III A, 1950er-Jahre (für 17,5 mm-⭬ Rollfilm auf Schutzpapier)

Kleinstbildkamera Mycro III A, 1950er-Jahre (für 17,5 mm-⭬ Rollfilm auf Schutzpapier): Rückseite mit geschlossenem Filmnummernsichtfenster
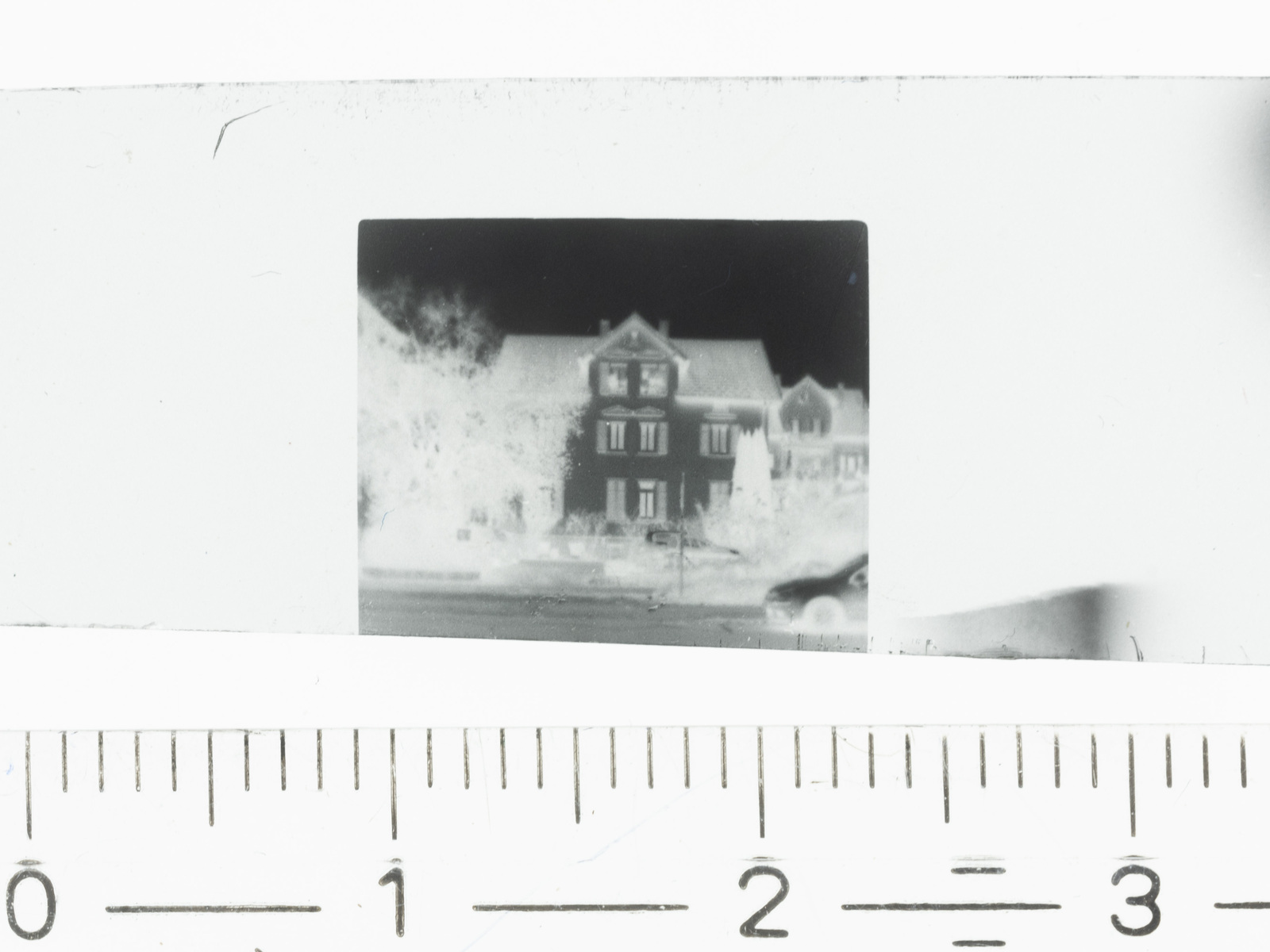
Negativ aus der Kleinstbildkamera Mycro III A (zugeschnittenes Stück Planfilm Fomapan 100); Aufnahme: Antonia Theresia Schrottwieser
Lit.:
- Benton, Tim: »Le Corbusier, der geheime Fotograf«. In: Herschdorfer, N. ; Umstätter, L. (Hrsg.): Le Corbusier und die Macht der Fotografie. München: Deutscher Kunstverlag, 2012. ISBN 978-3-422-07158-2 S. 30–53
engl.: subminiature camera
s. a. ⭬ Minox
KMQ-Betrachter/
Stereo-Sichtgerät SSG 1b Prismen-⭬ Stereoskop zur Betrachtung von einem übereinander angeordneten ⭬ Stereo-Bildpaar (rechtes Bild ist oben); benannt nach den Entwicklern an der Universität Hohenheim Christoph Koschnitzke, Rainer Mehnert, Peter Quick
Kodachrome (Kodak; hist.)
-
Farbdiafilm (⭬ Diafilm) von Kodak mit eigenem Entwicklungsprozess (K-14, bis 2009). Noch vorhandene Kodachrome-Filme können nicht mehr zum Farbdia entwickelt werden, mit etwas Aufwand jedoch zum Schwarzweißnegativ (Zheng Li zeigt das in seiner DIY-Anleitung und außerdem, wie er die Graustufendateien KI-gestützt koloriert).
Kelly-Shane Fuller und die Softwarefirma VSCO haben den K-14-Prozess angeblich nachempfunden.
Lit.:
Frech, Martin: »Kodak Kodachrome (1935–2009)«. In: Notizen zur Fotografie. 25. Juni 2009. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2009-06-25/RIP_Kodachrome.html [2022-04-08]
Fuller, Kelly-Shane: »They took my Kodachrome away … so I brought it back«. In: Emulsive. 2. Mai 2020. Online: ↱ emulsive.org/articles/darkroom/developing-film/they-took-my-kodachrome-away-so-i-brought-it-back [2023-11-06]
Hale, Kyle: Reviving Kodachrome. Firmenwebsite. 25. Aug. 2020. Online: ↱ eng.vsco.co/reviving-kodachrome/ [2023-11-06]
Kodachrome Professional Filme. Firmenschrift Kodak P-B 7. o. D.
Kluge, Hans A. (Hg.): Foto in Farben. Zwickau i. Sa.: Förster & Borries, 1938.
Koshofer, Gert: »Nachruf auf einen Einzigartigen: Kodachrome ist Geschichte«. In: fotointern.ch. 13 Sep. 2009. Online: ↱ fotointern.ch/archiv/2009/09/13/nachruf-auf-einen-einzigartigen-kodachrome-ist-geschichte/ [2021-01-19]
Krause, Peter: 50 Years of Kodachrome. In: Modern Photography, Okt. 1985. S. 47 ff.
Li, Zheng: »Finding Kodachrome and Bringing Back Color (the Digital Way)«. In: 35mmc. 5. Mai 2022. Online: ↱ 35mmc.com/05/05/2022/finding-kodachrome-and-bringing-back-color-the-digital-way-by-zheng-li [2022-05-06]
- Lied von Paul Simon (* 1941) aus dem Album There Goes Rhymin’ Simon (Columbia, 1973)
Paul Simon ändert über die Jahre seine Einstellung dazu, ob wirklich alles schlechter aussieht in Schwarzweiß (in der ersten Version 1973: ↱ YouTube), oder doch besser (1981 im Central-Park-Konzert: ↱ YouTube), oder doch schlechter (2018 im Hyde-Park-Konzert: ↱ YouTube) …
Vielleicht sollte er sich gelegentlich mit Nina Hagen (* 1955) austauschen, die sich bei diesem Thema bereits 1974 festgelegt hat (»Du hast den Farbfilm vergessen«: ↱ YouTube).
-
Kodacolor
Kodalk, Kodak Balanced Alkali
Kodak-Name für Natriummetaborat (NaBO₂) als Bestandteil in ⭬ Entwicklern
Kohledruck, Kohlepigmentdruck
Negativ-Positiv-⭬ Kontaktkopier-Verfahren (⭬ Pigmentdruckverfahren); 1855 patentiert von Alphonse Louis Poitevin
Lit.:
King, Sandy: »A Brief History of Carbon Printing«. 29. Januar 2018. Online: ↱ www.alternative
photography.com/a-brief-history-of-carbon-printing/ [2024-07-27]King, Sandy: »The carbon transfer process«. 4. März 2010. Online: ↱ alternative
photography.com/the-carbon-transfer-process/ [2024-07-27]
engl.: carbon print
s. a. ⭬ Carbrodruck
Kollodium-Nassplatten-Prozess
Positiv-Negativ-Prozess
engl.: collodion wet plate process
Lit.:
- Frech, Martin: »Das nasse Kollodiumverfahren – eine fotohistorische Verortung«. In: Notizen zur Fotografie. 17. März 2014. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2014-03-17/nasses-Kollodiumverfahren.html [2022-06-04]
- »Wet Collodion Process«, in: Encyclopedia of Practical Photography, Bd. 14, Garden City (NY): 1978, S. 2579 ff
Kolorieren
engl.: colouring
Kontaktbogen Kontaktabzug, Streifenkopie
Ein Blatt Fotopapier, auf das ein kompletter Farb- oder Schwarzweiß-Negativfilm (seltener ein Diafilm) ⭬ im Kontakt umkopiert wurde. Jedes Negativ des Films ist in Originalgröße als Positiv abgebildet.
Lit.:
Vestal, David: Contact Printing ; How to make professional-quality black-and-white proof sheets. In: Popular Photography, Mai 1981. S. 97–104
Zlobinski, Miriam: »Alles auf einen Blick? Kontaktbögen zwischen historischer und gegenwärtiger Bildpraxis am Beispiel des ›Stern‹-Fotoarchivs«. In: Rundbrief Fotografie. Bd. 31 (2024), Nr. 3/4, S. 23–33
engl.: contact sheet, proof sheet
Kontaktkopie
Größengleiche Kopie einer Vorlage (meist eines Negativs), die im direkten physischen Kontakt mit einem lichtempfindlichen Material (meist ⭬ Fotopapier) in einem Farb- oder einem Schwarzweißprozess entstanden ist.
Der Anwendungsbereich für K. ist groß und reicht von künstlerischen Fotogramm-Arbeiten über das Anfertigen von Probestreifen und das Ausarbeiten von Großformat-Negativen bis hin zur Vervielfältigung technischer Pläne, dem Herstellen von Rasterfilmen und dem Belichten von Druckplatten.
Die K. ist der einfachste Weg, aus einem fotogr. Negativ ein Papierbild herzustellen und gleichzeitig der hochwertigste, da keine Informationsverluste durch Optiken im Strahlengang (Kondensor, Filter, Vergrößerungsobjektiv) auftreten.
Herstellung einer Schwarzweiß-K. im Negativ-Positiv-Verfahren:
- Das Negativ wird unter ⭬ Rotlicht auf Fotopapier plaziert (idealerweise auf einem elastischen Untergrund, beispielsweise einem Stapel Zeitungspapier).
Bequemer ist die Arbeit mit einem Kontaktkopierrahmen. - Dieses Sandwich wird für guten Kontakt mit einer sauberen Glasplatte beschwert.
- Belichtet wird entweder unter dem ⭬ Vergrößerungsgerät oder einer anderen Lichtquelle direkt über dem Sandwich (auf gleichmäßige Ausleuchtung achten). Bei Bedarf kann partiell nachbelichtet und/
oder Licht partiell abgehalten werden. - Die Belichtungszeit wird z. B. mittels ⭬ Probestreifen ermittelt.
Kontaktkopiergeräte funktionieren andersrum: In einem großen Kasten sind unter einer Glasplatte Lichtquellen angebracht, darüber eine Glasplatte, auf die das zu belichtende Sandwich gelegt wird. Ein Deckel sorgt mit einer entsprechenden Verriegelung und/
oder einer Vakuumpumpe für guten Kontakt. engl.: contact print
s. a. ⭬ Fotogramm
- Das Negativ wird unter ⭬ Rotlicht auf Fotopapier plaziert (idealerweise auf einem elastischen Untergrund, beispielsweise einem Stapel Zeitungspapier).
Kontrastfilter (für ⭬ kontrastvariables Fotopapier)
s. a. ⭬ kontrastvariables Fotopapier; ⭬ Splitgrade-Printing
Kontrastfilter (Aufnahmefilter in der Schwarzweißfotografie)
⭬ Farbfilter | Kontrastfilter
Kontrastvariables Fotopapier (Multikontrast-Papier, Multigrade-Papier, Polycontrast-Papier; Polymax-Papier; VC-Papier; Varigam-Papier)
⭬ Fotopapier, dessen ⭬ Gradation von 00 bis 5 über die Lichtfarbe gesteuert wird (stufenlos mit einem Farbmischkopf oder in halben Stufen mit ⭬ Kontrastfiltern).
Ilfords Multigrade-Papier besitzt eine Schicht mit drei spektral unterschiedlich sensibilisierten Silbersalzen. Alle haben den gleichen (flachen) Kontrast und sind gleich blauempfindlich, jedoch verschieden stark grünempfindlich. Blaues Licht schwärzt alle Schichten, der Kontrast wird hoch; grünes Licht dagegen bewirkt einen geringen Kontrast, da nicht alle Silbersalze aktiviert werden. Ungefiltertes weißes Licht ergibt ungefähr Gradation 2. Foma-Papier verhält sich ebenso.
An einem Farbmischkopf sperrt der Gelbfilter den Blauanteil des Lichts und der Magentafilter den Grünanteil. Je dichter man den Gelbfilter nutzt, desto kontrastärmer (weicher) wird daher das Bild – je dichter man den Magentafilter nutzt, desto kontrastreicher (härter) wird es.
Der Hauptvorteil von kontrastvariablem Papier gegenüber festgraduiertem ist, dass man die Kontraststeuerung partiell anwenden kann (z. B. Nachbelichten mit einem anderen Kontrast).
Lit.:
Bessanova, Lina: »The (Hi)Story of Photo Paper«. In: Silvergrain Classics. Nr. 6, Spring 2020,
- Contrast Control for Ilford Multigrade Variable Contrast Papers ; Technical Information. Firmenschrift Ilford. Apr. 2010. Online: ↱ ilfordphoto.com/amfile/file/download/file/1824/product/733/ [2022-10-22]
- Fomabrom Variant IV 123. Datenblatt. Foma. Jan. 2016-01. Online: ↱ foma.cz/en/fomabrom-variant-IV [2022-10-22]
- Kodak Professional Polymax Fine-Art-Paper. Technical Data G-24. Kodak. Juni 2005. Online: ↱ 125px.com/docs/paper/kodak/g24.pdf [2022-10-22]
- Multigrade FB Classic. Datenblatt. Ilford. Okt. 2013. Online: ↱ ilfordphoto.com/amfile/file/download/file/1748/product/733/ [2022-10-22]
s. a. ⭬ Kontrastfilter (für kontrastvariables Fotopapier); ⭬ Splitgrade-Printing; ⭬ Fotopapier
Kornscharfsteller
engl.: focus finder; grain focuser
Kunstlicht
engl.: tungsten light
Kunstlichtfilm
Film, dessen fotogr. ⭬ Schicht spektral so sensibilisiert ist (⭬ Sensibilisierung), dass Motive ohne Filterung bei einem Aufnahmelicht mit einer ⭬ Farbtemperatur von 3200 K (Typ B), 3400 K (Typ A, z. B. Kodachrome 40 Super-8-Film; hist.) bzw. 3800 K (Typ F für Blitzlichtbirnchen mit Aluminium-Füllung; hist) farbrichtig wiedergegeben werden.
Um bei anderen Farbtemperaturen farbrichtige Abbildungen zu erhalten, müssen Farbkonversions-, Farbkorrektur- oder Farbausgleichsfilter (⭬ Farbfilter) verwendet werden.
K. ist eine beinahe ausgestorbene Filmgattung: Für die Stehbild-Farbfotografie werden weder ⭬ Dia- noch Negativfilme mehr hergestellt. Kodak produziert noch die Kunstlicht-Kinefilme VISION 3 500 T (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]) und VISION 3 200 T (↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]). Beides ist Kunstlicht-Negativ-Material, das sich allerdings nur bedingt für die Stehbildfotografie eignet: Es wird von Kodak nicht entsprechend konfektioniert, es gibt keine ⭬ Randnummern, für optimale Ergebnisse muss es im ⭬ ECN-2-Prozess entwickelt werden und das Material hat eine ⭬ Rem-Jet-Beschichtung als ⭬ Lichthofschutzschicht, die mechanisch entfernt werden muss.
Gleichwohl konfektionieren diverse Anbieter die Kodak-Vision-Kinefilme in Kleinbild-Patronen. Manche entfernen vorher sogar die Rem-Jet-Schicht für die problemlose ⭬ Crossentwicklung im ⭬ C-41-Prozess (z. B. ⭬ CineStill Film).
engl.: tungsten film
s. a. ⭬ Farbtemperatur; ⭬ Farbfilter; ⭬ Sensibilisierung; ⭬ Tageslichtfilm
L
Lambert-Beer’sches Gesetz
in unserem Kontext:
- Verdoppelt sich die Entfernung zur Lichtquelle, verringert sich die Lichtintensität auf ein Viertel.
- Verringert sich die Entfernung zur Lichtquelle auf die Hälfte, so ist die Lichtintensität vier mal so hoch.
engl.: Lambert–Beer law
Lehrbücher (Auswahl)
Bavister, Steve: Porträts – perfekt ausgeleuchtet. München: Laterna magica, 2002. ISBN 3-87467-785-0
Carroll, Henry: Read This If You Want to Take Great Photographs of People. London: Laurence King, 2015. ISBN 978-1-78067-624-1
Feininger, Andreas [1906–1999]: Andreas Feininger’s große Fotolehre. 10. Aufl. Neuausgabe 01/2001. München: Heyne, 2014. ISBN 978-3-453-17975-2
Golpon, Roland: Reproduktionsfotografie ; Grundlagen und Verfahrenstechniken der fotomechanischen und elektronischen Reproduktion. 6. Aufl. Frankfurt/M.: Polygraph, 1988. (= Lehrbuch der Druckindustrie). ISBN 3-87641-179-3
Ihme, Rolf: Lehrbuch der Reproduktionstechnik. 3. Aufl. Leipzig: VEB Fachbuchverlag, 1987
Nocon, Gene: Photographic Printing. o. O.: Antler Books, 1987. ISBN 1-85227-015-2
Weber, Ernst A.: Fotopraktikum. 4. überarb. Aufl. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2004. ISBN 3-7643-6689-3
s. a. ⭬ Literatur
Leitzahl
Zahl, die die Stärke eines Kompaktblitzgeräts beschreibt, meist bezogen auf eine ⭬ Filmempfindlichkeit von ISO 100/21°. Je größer die L., desto größer die Lichtenergie des Blitzgeräts. Bei Studioblitzen wird die Leistung meist in Wattsekunden (Joule) angegeben
Lz = Blendenzahl × [Entfernung zum Motiv]
Mit der L. rechnet man die richtige Blendeneinstellung aus:
Blendenzahl = Lz ÷ [Entfernung zum Motiv]
Vor dem Rechnen unbedingt prüfen, ob sich die verwendete L. auf Meter oder feet bezieht.
engl.: guide Number
Leporello
Figur in der Oper Don Giovanni (Wolfgang Amadeus Mozart, KV 527), die während der Handlung eine lange Liste präsentiert.
Druckprodukt aus einem langen Streifen Papier in Zick-Zack-Faltung; gut geeignet zum in Form bringen von Fotoserien.
nette DIY-Anleitung von Frau Schimpf: ↱ youtube.com/watch?v=hGsvYBc8Yo4 [2024-07-27]
Lit.:
Zeier, Franz: Schachtel Mappe Bucheinband. 2. Aufl. Bern und Stuttgart: Paul Haupt, 1990. ISBN 3-258-04284-5. S. 203 ff.
Lichthofschutzschicht; auch: Antihalo-Schicht, Rem-jet (removable-jet)
Die L. verhindert, dass während der Belichtung Licht vom Träger auf die fotografische Schicht zurückgestrahlt wird vermindert so Reflexionslichthöfe (Überstrahlungen heller Flächen bei starken Objektkontrasten) – sie wird vor oder während der Entwicklung entfernt (bei Kinefilmen mechanisch (s. u.), bei Stehbildfilmen meist chemisch).
Stehbildfilm
I. d. R. dünne gefärbte Schicht zwischen Träger und fotogr. ⭬ Schicht eines Films; es gibt/
gab jedoch auch Fotofilme, mit einer rückseitigen L. (z. B. ⭬ Kodachrome). Kinefilm
Ruß-Gelatine-Schicht auf der Rückseite des Trägers (Rem-jet), die neben der Minimierung von Lichthöfen auch verhindert, dass beim Filmtransport in der Kamera statische Aufladungen entstehen.
Entfernen der Rem-jet-Schicht vor der Entwicklung:
- ca. 25 g Natriumhydrogencarbonat (NaHCO₃; Natron, nicht Soda!) in 1 l Wasser (ca. 40 °C) auflösen
alternativ die Kodak-Rezeptur nutzen (S. 7-27 in Processing Kodak Motion Picture Films, Module 7 ; Process ECN-2 Specifications. Firmenschrift Kodak H-24.07. 2020. Online: ↱ kodak.com/content/products-brochures/Film/Processing-KODAK-Motion-Picture-Films-Module-7.pdf [2020-06-04]) - Film in Natronlösung geben; mehrmals: gut schütteln, warten, gut schütteln, warten, …
- gründlich warm wässern, bis das Wasser klar ist
- entwickeln, bleichen, fixieren, wässern
- Rem-jet-Rückstände vorsichtig entfernen (Schutzhandschuhe nutzen)
- Stabi-Bad
engl.: anti-halation backing
Die Hersteller verwenden unterschiedliche Farbstoffe für die Lichthofschutzschicht:
- ca. 25 g Natriumhydrogencarbonat (NaHCO₃; Natron, nicht Soda!) in 1 l Wasser (ca. 40 °C) auflösen
Lichtwert (LW)
In den 1950er-Jahren von der Firma Friedrich Deckel (Hersteller von ⭬ Kameraverschlüssen) eingeführte (mechanische) Koppelung von Zeit- und ⭬ Blendenwerten zur Vereinfachung der entsprechenden Einstellungen an ⭬ Zentralverschlüssen.
LW = Zeitwert + Blendenwert
→ Je mehr Licht vorhanden ist, desto höher ist der LW.Zeitwert = 0 für 1 s Belichtungszeit; erhöht sich um 1 für jede Halbierung der Belichtungszeit (Verschlusszeiten sind allerdings keine exakten Verdoppelungen)
Blendenwert = 0 für f/1; erhöht sich um 1 für jede weitere höhere ganze Blendenstufe (je × √2; s. a. ⭬ Blende)
Jeder Lichtwert steht für eine Schar von Blende-/
Verschlusszeit-Kombinationen. Der für eine Aufnahme passende Lichtwert wird mit dem ⭬ Belichtungsmesser ermittelt oder einer Tabelle entnommen und an der Kamera eingestellt. Da Blende und Verschlusszeit mechanisch gekoppelt sind, bewirkt eine Änderung der Blende oder der Verschlusszeit eine kompensierende Änderung des jeweils anderen Parameters, so dass die Gesamtbelichtung des Films unverändert bleibt. ↱ Photography light calculator [2024-07-27]
engl.: exposure value (EV; Eᵥ)
s. a. ⭬ APEX
Linefilm
linsenlose Fotografie
Literatur (Auswahl)
Anchell (2016):
Anchell, Steve: The Darkroom Cookbook. 4. Aufl. New York: Routledge, 2016Coot (1996):
Coote, Jack H. [Howard Roy]: Ilford Monochrome Darkroom Practice; A Manual of Black & White Processing & Printing. 3. Aufl. Oxford: Focal Press, 1996
Die 2. Aufl. ist online verfügbar: ↱ via Internet Archive [2024-07-21]Fotografie (1999):
Fotografie. Textheft zur Folienserie des Fonds der Chemischen Industrie ; Nr. 26. Autoren: Team der Agfa-Gevaert AG. 1999. Online: ↱ vci.de/vci/downloads-vci/publikation/texth.pdf [2024-04-11]Gustavson (2009):
Gustavson, Todd: Camera ; A History of Photography from Daguerreotype to Digital. New York, London: Sterling, 2009Hunt (1995):
Hunt, R[obert] W[illiam] G[ainer]: The Reproduction of Colour. 5. Aufl. Kingston-upon-Thames (GB): Fountain Press, 1995. ISBN 0-86343-381-2 (6. Aufl. 2004 bei Wiley: ISBN 978-0-470-02425-6)Die 4. Aufl. (2. Druck, 1987) ist online verfügbar:
↱ archive.org/details/reproductionofco0000hunt_j9q8/page/n5/mode/2upKrüger (1914):
Krüger, Otto F. W.: Die Illustrations-Verfahren ; Eine vergleichende Behandlung der verschiedenen Reproduktionsarten, ihrer Vorteile, Nachteile und Kosten. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1914- Starl (2009)
Starl, Timm: Bildbestimmung ; Identifizierung und Datierung von Fotografien 1839 bis 1945. Marburg: Jonas, 2009 Troop/
Anchell (2020):
Troop, Bill und Anchell, Steve: The Film Developing Cookbook. 2. Aufl. New York, NY: Routledge, 2020Ullrich (2003)
Ullrich, Wolfgang: Die Geschichte der Unschärfe 2. Aufl. Berlin: Klaus Wagenbach, 2003. (= Kleine kulturwissenschaftliche Bibliothek; 69) ISBN 3-8031-5169-4- Webers (1983)
Webers, Johannes: Handbuch der Film- und Videotechnik ; Film, Videoband und -Platte im Studio und Labor. München: Franzis, 1983. (= Franzis Unterhaltungs-Elektronik) ISBN 3-7723-7111-6
Spezifische Literatur ist unter den einzelnen Einträgen verzeichnet.
s. a. ⭬ Lehrbücher
s. a. PhotoLit – Data Bank on Photographic Literature: ↱ photolit.de/ [2024-01-19]
Lith-Print
Negativ-Positiv-Verfahren
⭬ Vergrößerung oder ⭬ Kontaktkopie von einem (normalen) Schwarzweiß- oder Farbnegativ auf ⭬ Silbergelatine-Fotopapier. Im Vergleich zur ›normalen‹ Vergrößerung wird das Papier zwei bis drei Blenden überbelichtet (weniger Licht = mehr Kontrast) und unterentwickelt. Statt eines herkömmlichen ⭬ Schwarzweiß-Papierentwicklers wird ein verdünnter ⭬ Lithentwickler verwendet; warmer Entwickler beschleunigt den Prozess. Im klassischen Schwarzweiß-Positivprozess wird das Papier ausentwickelt, beim Lith-Printing wird die Entwicklung im ›richtigen‹ Moment unterbrochen (auf die Schatten achten).
Nicht jedes Fotopapier eignet sich für das L. – vor allem darf in der Schicht kein Entwickler eingelagert sein (gut geeignet sind Foma Fomatone MG und Ilford Multigrade FB Warmtone); lithet das Papier schlecht, kann man es nach der Lithentwicklung ⭬ bleichen und nochmal im Lithentwickler versuchen.
Lith-Prints sind schon ohne ⭬ Tonung meist rötlich/
bräunlich und zeigen gute Lichterzeichnung bei kaum differenzierten Tiefen. engl.: lith print
Lit.:
Rudman, Tom: The Master Photographer’s Lith Printing Course: A Definitive Guide to Creative Lith Printing. London: Argentum, 1998. ISBN 9781902538020
Lithfilm
Lithentwickler
s. a. ⭬ Lith-Print
Lochkamera
Vorrichtung für ⭬ linsenlose Fotografie. Es gibt zwar Lochkameras zu kaufen; selbermachen ist jedoch spaßiger – jeder lichtdichte Behälter kann zur Lochkamera werden: einfach innen Film/
⭬ Fotopapier befestigen und gegenüber ein winziges Loch stechen – fertig! Das Loch wird üblicherweise mit einer Nadel in eine Metallfolie gestochen (Alu, Kupfer, ca. 0,03 mm stark) und hat meist einen Durchmesser von 0,2 bis 0,6 mm.
Alternativ können auch andere Objekte mit kleinen Löchern als ›Linsen‹ fungieren (s. a. ⭬ Camera Crackerstenopeica).
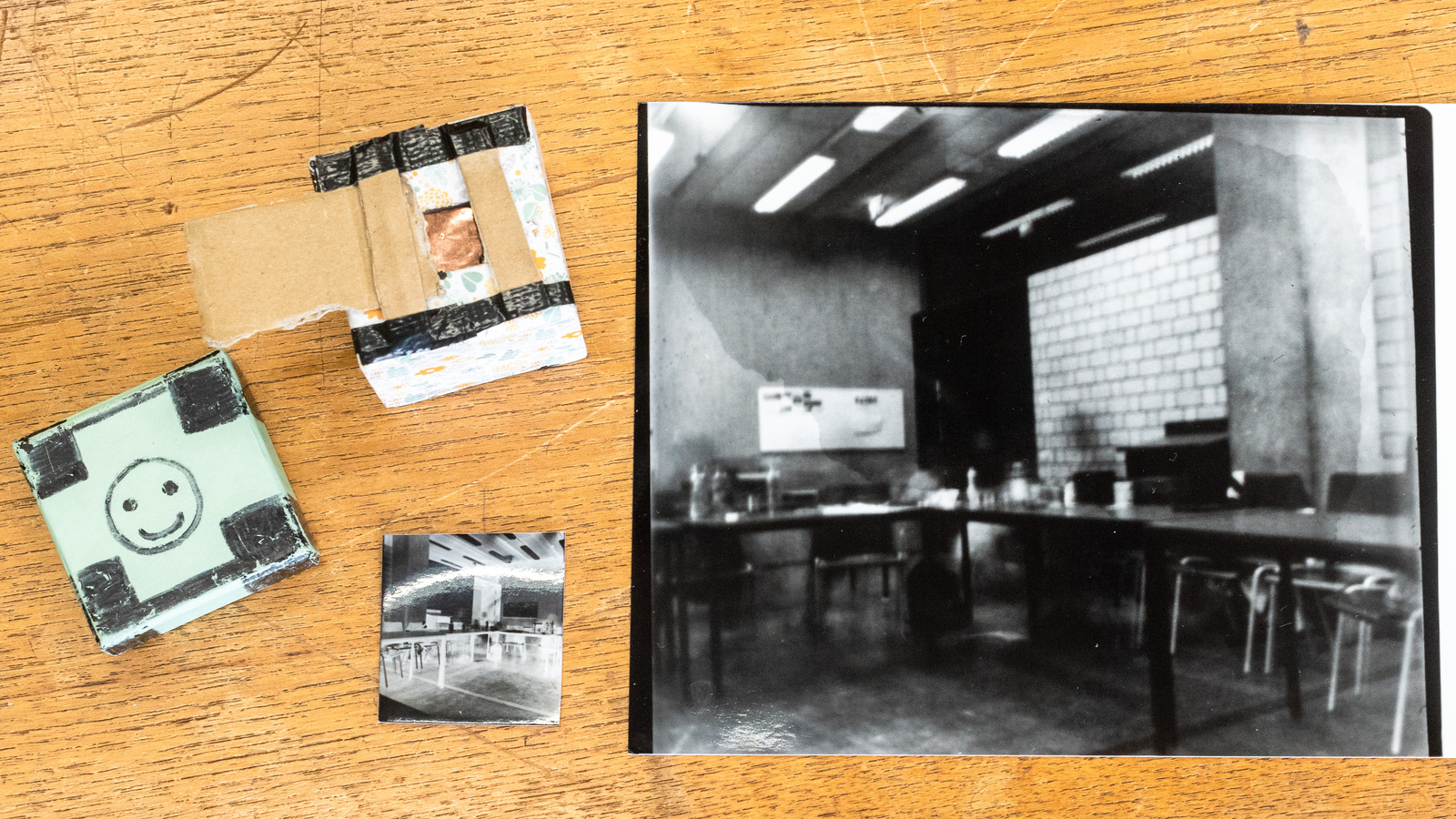
Lochkamera im Eigenbau; li.: Kameranegativ; re.: ⭬ Vergrößerung
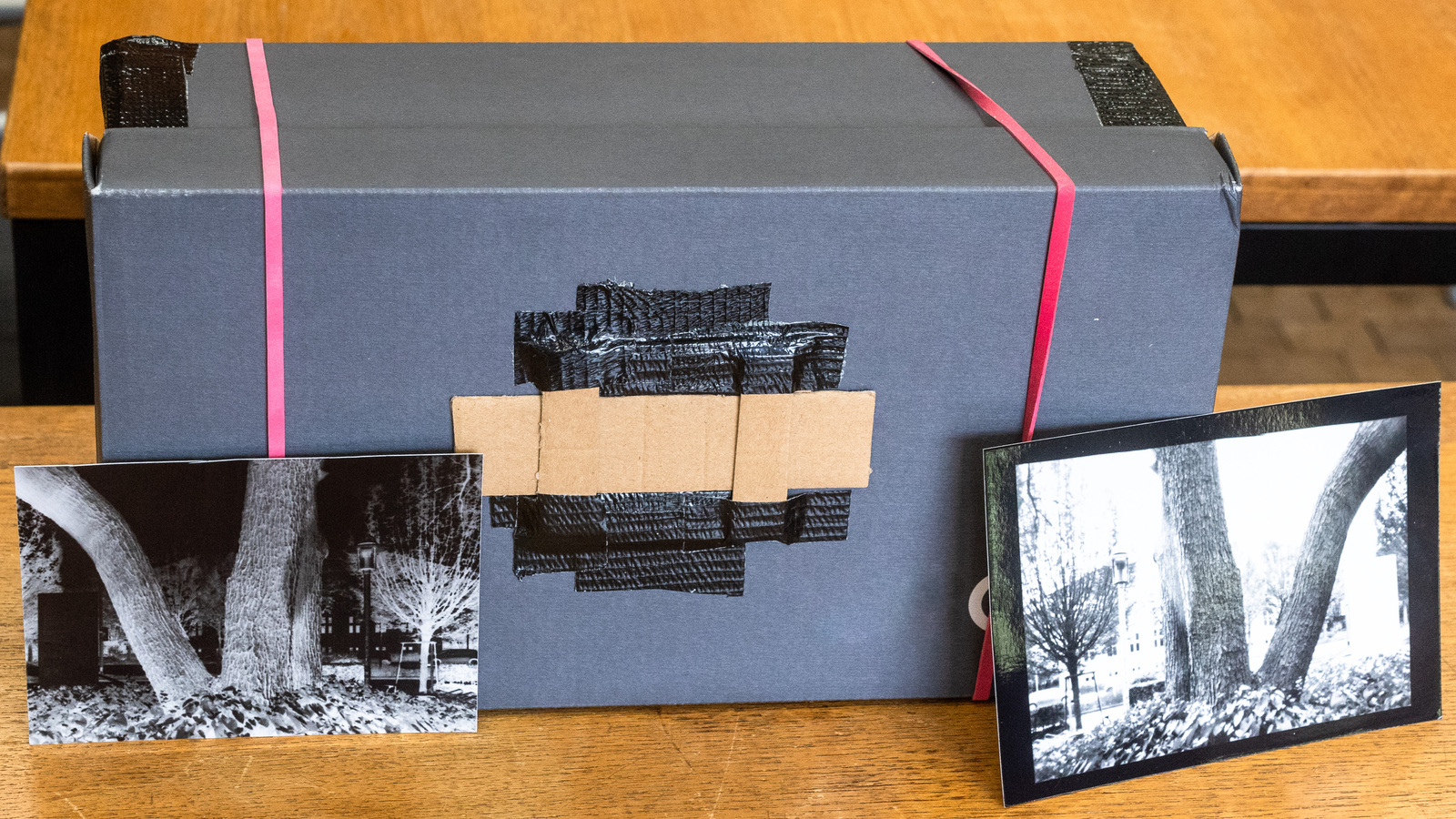
Lochkamera im Eigenbau; li.: Kameranegativ; re.: ⭬ Kontaktkopie
Belichtungszeit: ausprobieren, schätzen oder messsen
Zum qualifizierten Schätzen oder zum Messen der Belichtungszeit (⭬ Belichtungsmesser) muss man die ⭬ Blendenzahl des Lochs kennen:
f-Zahl = (Abstand Loch zu Film in mm) ÷ (Durchmesser des Lochs in mm)Das Loch vermisst man am einfachsten in einem hochaufgelösten Scan desselben; 🗎 Beispiel als pdf-Datei.
Übliche Belichtungsmesser zeigen die hohen Blendenzahlen nicht an. Man misst die Belichtungszeit daher bei einer handhabbaren Blende (tBeli) und rechnet das Ergebnis auf die eigentliche Blendenzahl um:
t = tBeli × (fLk ÷ fBeli)²
⭬ Schwarzschildeffekt der fotogr. ⭬ Schicht beachten!Alternativ nutzt man zur Umrechnung eine Rechenscheibe, die man sich z. B. mit der ↱ Vorlage von Ilford [2024-07-27] selbst bastelt.

Selbstportrait während Selbstportrait-Sitzung mit der Caotina-Cam, der selbstgebauten Lochkamera
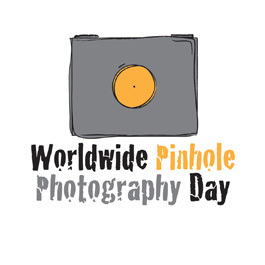
Mitmachen: ↱ Worldwide Pinhole Photography Day
Anleitung und Bastelbogen für die legendäre ›Dirkon‹ – eine Selbstbau-Lochkamera aus Pappe zur Nutzung mit 35 mm-Filmpatronen – von Martin Pilný, Mirek Kolář und Richard Vyškovský, veröffentlicht 1979 in der Zeitschrift ABC mladých techniků a přírodovědců. Wieder zugänglich durch David Balihar: ↱ pinhole.cz/en/pinholecameras/dirkon_01.html [2024-07-27]
online-Rechner rund um den Lochkamera-Selbstbau und die -Nutzung bei Mr. Pinhole: ↱ mrpinhole.com [2024-07-27]
s. a. ⭬ Camera obscura
engl.: pinhole camera
Lit.:
Abe, H. ; Olpe, P. ; Honnef, K. ; Musée suisse de l’appareil photographique (Hrsg.): Out of Focus – Lochkameras und ihre Bilder. Kat. Ausst. »Out of Focus« im Schweizer Kameramuseum, Vevey 2012. Sulgen (CH): Niggli, 2012. ISBN 978-3-7212-0851-1
- Breidbach, Olaf ; Klinger, Kerrin ; Müller, Matthias: Camera Obscura ; Die Dunkelkammer in ihrer historischen Entwicklung. Stuttgart: Franz Steiner, 2013. ISBN 978-3-515-10005-2
Ebenfeld, Dietrich ; Winterlich, Karl-Otto: »Eine Lochkammer für die Architektur-Photogrammetrie«. In: Borchers, G. (Hrsg.): Architektur-Photogrammetrie ; Internat. Symposium für Photogrammetrie in der Architektur und Denkmalpflege, Bonn, 10.–13. Mai 1976. Köln: Rheinland-Verl., 1977. ISBN 3-7927-0324-6
Dietrich, J. (Hrsg.): Zwischenzeit: Camera obscura im Dialog ; 20 FotografInnen und 7 TextautorInnen äussern sich zum Thema Lochkamera. Stuttgart: Lindemanns, 1993. ISBN 978-3-928126-60-1
Gatton, Matt ; Carreon, Leah: »Probability and the Origin of Art: Simulations of the Paleo-camera Theory«. In: Journal of Applied Mathematics Bd. 4 (2011), Nr. 4, S. 181–190; online verfügbar: ↱ aplimat.com/files/Journal_volume_4/Number_4.pdf [2023-04-23]
Irvine, Steve: »Say Clay! Making a Ceramic Pinhole Camera«. In: Pottery Making Illustrated Bd. 8 (2005), Nr. 2, S. 24–28
Keeney, Chris: Pinhole Cameras ; A Do-It-Yourself Guide. New York: Princeton Architectural Press, 2011. ISBN 978-1-56898-989-1
- Lefèvre, Wolfgang (Hrsg.): Inside the Camera Obscura – Optics and Art under the Spell of the Projected Image. Preprint 333. Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte: Berlin, 2007. Online: ↱ mpiwg-berlin.mpg.de/sites/default/files/Preprints/P333.pdf [2025-07-27]
Olpe, Peter: Die Lochkamera : Funktion und Selbstbau. Stuttgart: Lindemanns, 1993. ISBN 978-3-928126-62-5
Renner, Eric: Pinhole Photography. 4. Aufl., 2009
Rohr, M[oritz] v.: »Zur Entwicklung der dunklen Kammer (camera obscura)«. In: Central-Zeitung für Optik und Mechanik / Elektrotechnik und verwandte Berufszweige Bd. 15 (1925), S. 233–304
- Steadman, Philip: Vermeer’s Camera ; Uncovering the Truth Behind the Masterpieces. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-19-280302-6
Tsuji, Shigeru: »Brunelleschi and the camera obscura: the discovery of pictorial perspective«. In: Art History Bd. 13 (1990), Nr. 3, S. 276–292
Wiedemann, Eilhard (Übers.): »Über die Camera obscura bei Ibn al Haiṯam«. In: Sitzungsberichte d. phys.-mediz. Sozietät Erlangen Bd. 46 (1914), S. 155–169. Nachgedruckt in: Wiedemann, Eilhard, und Wolfdietrich Fischer. Aufsätze zur Arabischen Wissenschaftsgeschichte Bd. 2. Reprograf. Nachdruck Olms, 1970. (= Collectanea VI/2) ISSN 0175-8594
Lochkamera-Arbeiten von mir:
→ 「Pinhole-Selfies」 (2015)
「The scattered body」 (2012)
「Ende 2009」 (2009)
「My first cigarette」 (2008)
↱ Pinhole #217 (2007)
Beitrag zum Projekt ↱ ›Camera Obscura 2005/1 – ∞‹ (eine Hommage an Roman Opalka und sein Werk 1965/1 – ∞)
→ 「Frühling」 (18.03.2006)
「sehens wert」 (2006)
Meine Beiträge zum Worldwide Pinhole Photography Day:
↱ Railroad, Sunrise (2009)
↱ Uferzone (2008)
↱ Father and Son (2007)
Lomografie (auch: Lomographie, Lomography)
Marketingbegriff für einen amateurfotografischen Stil (Spielart der ⭬ Low-fi Fotografie); ab 1992 (eher im Scherz?) als künstlerische Praxis propagiert von Studenten in Wien (Matthias Fiegl-Bibawy, Christoph Hofinger, Wolfgang Stranzinger; Verein »Lomographische Gesellschaft«, 10 Regeln s. u., Manifest); ab 1995 kommerzialisiert durch die »Lomographische GmbH«, später als »Lomographische AG«; bis heute der ⭬ emulsionsbasierten Fotografie verpflichtet; benannt nach der Firma Ломо aus Petrograd/
Leningrad/ Sankt Petersburg (Ленинградское оптико-механическое объединение; Leningrader mechanisch-optische Werke) Für die Studenten war ihr Projekt finanziell wahrscheinlich auskömmlich. Die Kehrseite ist jedoch, dass sie der Öffentlichkeit den falschen Eindruck vermittelten, dass emulsionsbasierte Fotografie technisch prinzipiell von schlechter Qualität sei.
Die ›Lomografischen Regeln‹ stehen unter dem Motto Don’t Think, Just Shoot (vgl. ↱ lomography.de/about/the-ten-golden-rules [2024-07-07]) und eignen sich m. E. prima als Bildfindungsstrategien: Fotografieren Sie eine Woche ohne nachzudenken und schauen sich die Bilder kritisch an – ist etwas dabei, das Ihnen gefällt, machen Sie entsprechend weiter.
Nimm deine Kamera überall hin mit.
Verwende sie zu jeder Tages- und Nachtzeit!
Die Lomographie ist nicht Unterbrechung deines Alltags, sondern ein integraler Bestandteil desselben.
Übe den Schuss aus der Hüfte!
Nähere dich den Objekten deiner Lomographischen Begierde so weit wie möglich!
Don’t think. (William Firebrace)
Sei schnell.
Du musst nicht im Vorhinein wissen, was dabei heraus kommt.
Im Nachhinein auch nicht!
Vergiss die Regeln!
Website: ↱ lomography.com [2024-04-25]
Lit.:
Frech, Martin: »Ломо-Fisheye«. In: Randgebiete. Nr. 3 2 (2005) 2, S. 7 f. Online: 🗎 medienfrech.de/foto/pdf/Martin-Frech_R3-2005.pdf [2024-06-09]
Lischka, Konrad: »Wie Putin die Lomo-Fotokunst rettete«. In: Spiegel Netzwelt. 9. Aug. 2009. Online: ↱ spiegel.de/netzwelt/web/25-jahre-lc-a-a-640219.html [2024-05-30]
The Lomography Manifesto. Lomographische Gesellschaft. 1992. Online: fotomanifeste.de/manifeste/1992-lomographischegesellschaft-thelomographymanifesto [2022-04-29; nicht mehr verfügbar] | via Wayback Machine: ↱ web.archive.org/web/20230208111450/http://fotomanifeste.de/manifeste/1992-lomographischegesellschaft-thelomographymanifesto [2024-04-25]
s. a. ⭬ Low-fi Fotografie; ⭬ Toy Camera
Low-fi-Fotografie
Fotografische Praxis, die den ästhetischen Mehrwert sucht, indem der apparative Aufwand gering gehalten wird; eine technisch minderwertige Bildqualität wird in Kauf genommen.
Zeitgenössisch häufig eine Reaktion auf ein Unbehagen mit der ubiquitären ›Digitalität‹, ist die künstlerische Praxis der L. deutlich älter; vgl. z. B. Nancy Rexroth (1974); Mark Schwartz (späte 1970er-Jahre); David Featherstones The Diana Show in Carmel 1980.
Arbeiten von mir, die der L. zuordenbar sind:
「Globalisierung konkret」 (2017)
「Pinhole-Selfies」 (2015)
「Verblassende Erinnerung」 (2012)
「Celebi heimholen」 (2011)
「My first cigarette」 (2008)
「Mauergedenken」 (2007)
「Frühling (18.03.2006)」 (2006)
Lit.:
Frech, Martin: »„Light Leaks“, ein abgeschlossenes Sammelgebiet«. In: Notizen zur Fotografie. 7. Okt. 2011. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2011-10-07/Light-Leaks_ein-abgeschlossenes-Sammelgebiet.html [2024-06-09]
Frech, Martin: »Toy camera: Debonair (Diana-Klon)«. In: Notizen zur Fotografie. 15. Juli 2009. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2009-07-15/Toy-camera_Debonair.html [2024-06-09]
engl.: lo-fi photography
s. a. ⭬ Boxkamera; ⭬ Lochkamera; ⭬ Lomografie; ⭬ Toy Camera; ⭬ Wegwerfkamera
Lumen printing
Wird ⭬ Fotopapier lange belichtet, entsteht ein Bild auch ohne Entwickeln. So hat William Henry Fox Talbot (1800–1877) in den frühen 1830er-Jahren seine photogenic drawings auf ⭬ Salzpapier hergestellt.
s. a. ⭬ SolarigraphyM
Meniskuslinse
engl.: meniscus lens
Metamerie
engl.: metamerism
Meterware
I. w. S. unbelichteter ⭬ Rollfilm, der nicht für eine direkte Verwendung in einer Kamera konfektioniert, sondern nur aufgewickelt ist.
I. e. S. meist 100 ft (30,5 m) ⭬ Kleinbildfilm, aufgerollt auf einem Wickelkern; zum selbst konfektionieren in Kleinbild-Patronen mit Hilfe eines ⭬ Filmladers oder zum Befüllen von Langfilmmagazinen und Kleinbildkameras, die nicht für die Kleinbildpatrone (⭬ Typ 135) eingerichtet sind (frühe Leicas, Robot).
s. a. ⭬ Filmlader
engl.: bulk film material
Minox (hist.)
Hersteller der legendären ⭬ Kleinstbild-Kameras mit dem Aufnahmeformat 8 × 11 mm; der 9,5 mm breite Film ist in speziellen Minox-Kassetten konfektioniert.
Es gibt auch Kameras anderer Hersteller, die Minox-Filmkassetten nutzen; beispielsweise die Atoron/
Atoron Electro von Yashica (bzw. die baugleiche Porst EX 55 Electronic). »Eine Minox ist tausendmal besser als meine Kodak Instamatic [Kodak ⭬ Film-Typ 126], die immer nur quadratische Bilder macht, weshalb man sie schräg halten muss, um etwas Hohes aufzunehmen, weil man mehr draufkriegt, wenn das Bild wie eine Raute ist, obwohl das dann im Album blöd aussieht und außerdem ziemlich viel Platz wegnimmt. Eine Minox ist außerdem noch viel kleiner, nicht viel größer als eine Schachtel Welthölzer, nur eben länglich und silbern.« (Witzel, Frank: Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. 6. Aufl. Berlin: Matthes & Seitz, 2015. S. 19 f.)
mireds (micro-reciprocal degrees; SI: mireks (mega-reciprocal kelvins, MK⁻¹)
Mireds-Werte beschreiben den Einfluss von ⭬ Farbfiltern auf die effektive ⭬ Farbtemperatur der Lichtquelle.
Nach dem Wien’schen Verschiebungsgesetz verhält sich die maximal ausgestrahlte Wellenlänge eines idealen Schwarzen Körpers antiproportional zu seiner Temperatur. Auch wenn dieser ein ganzes Spektrum ausstrahlt, bedeutet dies dennoch, dass sich mit linear ändernder Temperatur das Spektrum reziprok in den Wellenlägen bewegt. Der mireds-Wert sorgt für eine lineare Beziehung zwischen Farbe (Wellenlänge) und Energie, sodass sich mit linear änderndem mireds-Wert das ausgestrahlte Spektrum ebenfalls linear ändert.
mireds-Wert = 10⁶ ÷ [Farbtemperatur in K] Mireds-Verschiebungswerte repräsentieren die wahrnehmbare Änderung der Farbtemperatur besser als die entsprechenden Differenzen der Kelvin-Werte (die Kelvin-Skala ist nicht farblinear, s. o.): Zum Anpassen der Farbtemperatur eines Aufnahmelichts von 3600 K auf ⭬ Kunstlichtfilm Typ A (Verschiebung 35 mireds) ist beispielsweise ein anderer Filter nötig als für die Anpassung von 5100 K auf ⭬ Tageslichtfilm (Verschiebung −14 mireds) – obwohl in beiden Fällen der Farbtemperatur-Unterschied 400 K beträgt.
Mireds-Verschiebungswert:
(1/[Farbtemp. gefiltertes Licht in K] − 1/[Farbtemp. Lichtquelle in K]) · 10⁶positiver Wert:
Filter (gelblich) verringert Farbtemperatur; Licht wird ›wärmer‹negativer Wert:
Filter (bläulich) erhöht Farbtemperatur; Licht wird ›kälter‹Mischlicht
Beleuchtung mit mehreren Lichtquellen, deren Licht spektral unterschiedlich zusammengesetzt ist (z. B. im Innenraum, der beleuchtet wird mit ⭬ Kunstlicht aus der Raumbeleuchtung und dem ⭬ Tageslicht durch die Fenster).
Fotografiert man Farbaufnahmen bei M., bekommen diese einen nicht ausfilterbaren ›Farbstich‹, da die fotogr. ⭬ Schicht entweder für Kunst- oder für Tageslicht sensibilisiert ist (⭬ Sensibilisierung).
engl.: mixed light
Mischung
Mittelformat
Monobad
Mordançage
Dunkelkammer-Technik, zur Veränderung eines ⭬ Prints/
Negativs: Nach dem ⭬ Bleichen wird die ⭬ Emulsion an den dunklen Bildpartien vom Träger gelöst und neu positioniert. Danach wird rückentwickelt (⭬ Rückentwicklung), nochmal fixiert (⭬ Fixierer) und gewässert. Das Verfahren aus dem späten 19. Jh. wurde von Jean Pierre Saudre wiederbelebt.
Bildbeispiele:
- ↱ Vincenzo Caniparoli: Diario Di Una Stella Morente (2017-2019) [2024-07-27]
- ↱ Elizabeth Opaleniks Arbeiten [2024-07-27]
Lit.:
Anderson, Christina Z: The Bleach-Etch process, aka Mordançage. In: Anchell (2016), S. 164 f. [⭬ Literatur]
Coote (1996), S. 301 ff [⭬ Literatur]
Multigrade Developer (Ilford)
proprietärer ⭬ Entwickler für ⭬ Silbergelatine-Fotopapier
↱ Datenblatt [2022-07-23]
enthält ⭬ Hydrochinon ⚠
N
Nachtaufnahmen
Anhaltspunkte:
Eher in der Dämmerung statt nachts fotografieren.
Bei hohem Motivkontrast: ⭬ EI = halbe ⭬ Nennempfindlichkeit; nur ¾ der Entwicklungszeit entwickeln
Eine knappe Blende zugeben, um die Schatten zu retten.
Die Schatten anmessen und diesen Wert um 2 Blenden unterbelichten.
Belichtungszeit1,3 (wg. ⭬ Schwarzschild-Effekt)
engl.: night photography
Nahlinse, Vorsatzlinse
Hilfsmittel für die Makrofotografie: Zusätzliche optische Einzel- oder Doppellinse mit positiven Dioptrien (›Lesebrille fürs Objektiv‹, die Brennweite des Objektivs wird verkürzt), die vor dem Objektiv angebracht wird, um Objekte näher als die Naheinstellgrenze des Objektivs zu fotografieren; Nahlinsen können kombiniert werden (die stärkere am Objektiv).
Bei den günstigen Einzel-Nahlinsen treten i. d. R. chromatische Aberrationen auf, die eine zweite Linse weitgehend ausgleichen kann (achromatische Dublettenlinse); Canon kennzeichnet diese mit einem ›D‹, Nikon mit einem ›T‹.
s. a. ⭬ Balgengerät; ⭬ Zwischenring
engl.: close-up lens
nass ausgearbeitet
»Digital ist trocken. Traditionelle Fotos entwickelt man mit Flüssigkeit. Sie sind einmal nass gewesen. Das muss schon sein. Mein Leben = Fotografie. Und ohne Feuchtigkeit kann man nicht leben. Man darf nicht austrocknen.« Nobuyoshi Araki
ND-Filter, Neutraldichtefilter
Negativfilm
Nennempfindlichkeit
Die auf die Filmverpackung gedruckte Empfindlichkeitsangabe (⭬ Filmempfindlichkeit); hält einer Validierung (⭬ Sensitometrie) leider nicht immer stand.
s. a. ⭬ EI
engl.: box speed
Netzmittel
Das N.-Bad ist der letzte Schritt im ⭬ Entwicklungsprozess konventioneller fotogr. ⭬ Schichten.
Das N. enthält ein Tensid, das die Oberflächenspannung des Wassers aus der Schlusswässerung herabsetzt, damit es von Filmen und Fotopapieren während des Trocknens gleichmäßig abläuft – dadurch werden Wasserinseln und Kalkflecken vermieden.
N. können bakterizide, antistatische oder härtende Zusätze enthalten.
N. werden üblicherweise als Konzentrate geliefert (z. B. Adox Adoflo, Foma Fotonal, Kodak Photo-Flo, Tetenal Mirasol) und zur Anwendung mit demineralisiertem Wasser hoch verdünnt.
engl.: wetting agent
Neutol (Adox; urspr. Agfa)
proprietärer ⭬ Entwickler für ⭬ Silbergelatine-Fotopapier
↱ Webseite d. Herstellers [2022-07-23]
Von Agfa gab es Neutol in drei Varianten: WA (Warmschwarz), NE (Neutralschwarz) und BL (Blauschwarz), jeweils als Pulver und als Flüssigkonzentrate; Adox-Neutol gibt es nur als flüssiges NE und WA, Compard WA entspricht Neutol WA.
enthält ⭬ Hydrochinon ⚠
umweltfreundliche Variante ohne ⭬ Hydrochinon ⚠: Neutol Eco (↱ Webseite d. Herstellers [2022-08-31]); das hat jedoch – außer dem Namen nach – nichts mit der Agfa-Rezeptur zu tun.
O
Öl und Fett
Kameras enthalten viele bewegliche Teile (⭬ Verschluss, ⭬ Blende, Filmtransport), die geschmiert sein müssen. Hier ist die Verwendung der richtigen Öle und Fette kritisch.
Thomas Sadewasser hat eine schöne Übersicht zusammengestellt:
↱ vesab.de/wpvesab/fotografie/oel_fett_kamera_schmierung-6874/ [2024-05-27]Old Brown
erschöpfter Papierentwickler
Statt diesen zu entsorgen, kann er genutzt werden, um frisch angesetzten ⭬ Entwickler zu ›reifen‹, diesen also absichtlich zu verunreinigen – vor allem mit den Bromiden, die während des Entwicklungsprozesses entstehen und die im frischen Entwickler noch fehlen. Die Idee ist, das der Entwickler dann von Anfang an seine optimale Zusammensetzung hat. Ich habe damit keine Erfahrung, es soll mit ⭬ Metol-basierten Entwicklern am besten funktionieren.
orthochromatisch (griech. ὀρθός: richtig), isochromatisch (griech. ̓ίσος: qual. gleich)
Fotografische ⭬ Schichten werden durch Silbersalze lichtempfindlich. Diese reagieren jedoch nur auf Licht kurzer Wellenlänge (UV, blau); rotes Licht schwärzt diese Schichten nicht. Realweltliche Motive werden damit für unser Empfinden nicht tonwertrichtig widergegeben. Durch spektrale ⭬ Sensibilisierung wird die Schicht zusätzlich für längerwelliges Licht empfindlich (Hermann Wilhelm Vogel (1834–1898), 1884 und Adolf Miethe (1862–1927)/
Arthur Traube (1878–1948), 1902). Durch rötliche Farbstoffe orthochromatisch sensibilisierte Schichten werden von Licht bis ca. 600 nm (Gelb) geschwärzt, können also unter Rotlicht verarbeitet werden (⭬ Dunkelkammer). Frühe o. Schichten vor der Einführung der Eosinsilberplatte (Otto Perutz (1847–1922)) waren allerdings zu blau-empfindlich, so dass ein Gelbfilter nötig war. Bis ins frühe 20. Jahrhundert gab es nur orthochromatisches Filmmaterial; arbeitet man heute mit rotblindem Film, kann das den Fotos einen Retro-Look geben. Der Look lässt sich mit ⭬ panchromatischem Film und einem Cyanfilter (z. B. Wratten 44 A oder B+W KB 20) vortäuschen.
2024 verfügbares o. Filmmaterial:
Ferrania Orto
Fomapan Foma Ortho 400
↱ Datenblatt [2024-04-04]Ilford Ortho Plus
↱ Datenblatt [2024-04-04]Rollei Ortho 25 plus
↱ Datenblatt [2024-04-04]
s. a. ⭬ panchromatisch; ⭬ orthopanchromatisch; ⭬ superpanchromatisch
orthopanchromatisch (griech. ὀρθός: richtig; πᾶν: alles)
⭬ panchromatische Schicht mit etwas geringerer Rotempfindlichkeit; Stand der Technik bis ca. 1950er-Jahre (Agfa Isopan); wird daher verkaufsfördernd als »klassisch Sensibilisierung« (Datenblatt zum ADOX CHS 100 II vom 12.10.2015) stilisiert.
z. B. ADOX CHS 100 II ↱ Datenblatt [2024-07-27]; Rollei Blackbird ↱ Webseite d. Herstellers [2024-07-27]
s. a. ⭬ orthochromatisch; ⭬ panchromatisch; ⭬ superpanchromatisch
Orton-Effekt
Überstrahlungs-Effekt durch passgenaues Übereinanderlegen (⭬ Pinregistrierung) eines scharfen überbelichteten Dias mit einem unscharf überbelichteten Dias desselben Motivs.
Benannt nach Michael Orton (↱ Website [2024-07-27]).
Lit.:
Orton, Michael: Orton Effect. o. D. Online: ↱ michaelortonphotography.com/ortoneffect.html [2024-07-27]
engl.: Orton effect
s. a. ⭬ Diffusionsfilter
OTUC (One-time-use camera)
Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Polylux
engl.: overhead projector
s. a. ⭬ Epidiaskop
P
Pan F (Ilford)
niederempfindlicher Schwarzweißfilm, klassische Kornstruktur; seit 1948; seit 1992 als Pan-F Plus (ISO 50/18°)
↱ Datenblatt Ilford Pan F Plus [2024-07-27]
panchromatisch (griech. πᾶν: alles)
Fotografische ⭬ Schichten werden durch Silbersalze lichtempfindlich. Diese reagieren jedoch nur auf Licht kurzer Wellenlänge (UV, blau); rotes Licht schwärzt diese Schichten nicht. Realweltliche Motive werden damit für unser Empfinden nicht tonwertrichtig widergegeben. Durch spektrale ⭬ Sensibilisierung wird die Schicht zusätzlich für längerwelliges Licht empfindlich (Vogel, 1884 und Miethe/
Traube, 1902). Panchromatisch sensibilisierte Schichten werden vom kompletten sichtbaren Licht geschwärzt (bis ca. 680 nm) und müssen daher bei völliger Dunkelheit verarbeitet werden (⭬ Dunkelkammer).
Nahezu alle aktuellen Schwarzweißfilme sind panchromatisch sensibilisiert.s. a. ⭬ orthochromatisch; ⭬ orthopanchromatisch; ⭬ superpanchromatisch
Panoramafotografie
Panoramakamera
Technisch unterscheidet man vier prinzipiell verschiedene Methoden, Panoramen aufzunehmen; erklärt in Frech [2006]
Lit.:
Frech, Martin: »Michael Westmoreland, Jook Leung u. a.: ›360 Grad‹«. In: Notizen zur Fotografie. 26. Sep. 2006. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2006-09-26/Westmoreland_Leung_360-Grad.html [2022-04-08]
Papiernegativ
engl.: paper negative
s. a. ⭬ Fotopapier
PaRodinal
Passepartout
Ein Karton, der über das Bild gelegt wird; in diesen ist ein ›Fenster‹ geschnitten, um das Bild freizugeben. Das P. schützt das Bild bei Präsentation und Lagerung, indem es den permanenten Kontakt der Bildoberfläche mit dem Glas/
Plexiglas des Bilderrahmens bzw. der Schutzhülle verhindert. Es gibt verschiedene Arten, den Ausschnitt zu schneiden, üblich ist ein Winkel von 45° (= Schrägschnitt-P.), damit werden Schatten auf das Bild verhindert. s. a. ⭬ Hängung

Farbfotografie (aus meiner Arbeit → 「DDR ’90」) unter einem Schrägschnitt-Passepartout
PC-TEA
⭬ Schwarzweißnegativentwickler auf Basis von Phenidon, Vitamin C und Triethanolamin (C₆H₁₅NO₃)
Lit.:
Gainer, Patrick A: Three Long-Lasting Single-Solution Sulfite-Free Developers. In: Anchell (2016), S. 32 [⭬ Literatur]
PE-Fotopapier
engl.: resin coated
PE-Print
⭬ Nass ausgearbeitete analoge Vergrößerung auf ⭬ PE-Fotopapier
Pergamin
Semitransparentes Spezialpapier aus gebleichtem Zellstoff.
Säurefreies, pH-neutrales P. wird in unserem Kontext für Zwischenblätter in ⭬ Fotoalben sowie für Ablagehüllen für Negative und Fotoabzüge verwendet. Ein Vorteil von P.- gegenüber Kunststoffverpackungen ist – besonders bei Klimaschwankungen – dessen Luftdurchlässigkeit.
P. im Materialarchiv: ↱ materialarchiv.ch/de/ma:material_637 [2024-07-27]
engl.: glassine
Petersburger Hängung, Salonhängung
engl.: Petersburg hanging; salon style hanging
Photo CD (Kodak, Philips; hist.)
Photo CD (PCD) ist ein Meilenstein in der Geschichte der digitalen Fotografie: Vorgestellt auf der Photokina 1990 und verfügbar ab 1992, war die PCD eine Brücke zwischen der Fotografie auf Film und der digitalen Nutzung der Bilder (Spezifikation im ›Beige Book‹).
Photo CD ist ein System, um auf Film aufgenommene Fotos hochwertig zu digitalisieren und im dazu eingeführten Kodak-PhotoYCC-Farbmodell auf archivtaugliche Multi-Session-CD-ROMs zu speichern (direkt kompatibel mit CD-I). Die Bilder werden im von Kodak definierten ImagePac-Format (.pcd) in fünf bzw. sechs verschiedenen Auflösungen kodiert. Auf eine CD-ROM passen ohne Ton ca. 100 ImagePacs (Photo CD Master) bzw. 25 in der höchsten Auflösung (Kodak Pro Photo CD Master Disc); daneben gab es noch die Versionen Photo CD Portfolio (800 Bilder im Format Base), Catalog Photo CD (3000 Bilder im Format Base/4) und Medical Photo CD (für med. Scans inkl. Patientendaten im ACR-NEMA-↱ Standard [2024-07-27]).
Auflösungen der Photo CD Name Auflösung/Pixel Indexprint 192 × 128 Base/16 Kontakt 384 × 256 Base/4 CRT/TV 768 × 512 Base HDTV 1536 × 1024 4 Base Fotoqualität 3072 × 2048 16 Base Profiqualität 6144 × 4096; nur Pro Photo CD Master 64 Base Photo CD in den CD-I-faq: ↱ icdia.co.uk/faq/cdifaq5.html#5.9 [2024-02-16]
Liste aller Photo-CD-Player: ↱ icdia.co.uk/related/photocd/pcdplayers.html [2024-02-16]
Ted Felix: Ted’s Unofficial Kodak Photo CD Homepage: ↱ tedfelix.com/PhotoCD/ [2024-02-16]
Dan Wood erklärt in seinem Video Oddware: Kodak Photo CD (Failed Format from 1992) vom 07.02.2020, wie man zur Photo CD kompatible CD-ROMs erstellt: ↱ youtube.com/watch?v=ouIEFhn_l40 [2024-02-16]
Lit.:
Announcing Kodak Photo CD ; The Future Of Memories. Firmenschrift Kodak. 1990.
Ascherl, Albert [Kodak]: Wird die Photo-CD zu einer Gefahr oder Chance für Reprobetriebe? In: Deutscher Drucker (1992), Nr. 36, S. w16; w21–w26
Die zur photokina 90 von Kodak vorgestellte Foto-CD ist auch für EBV-Anwender interessant. In: Deutscher Drucker (1990), Nr. 36, S. w37–w38; w45
Hunt (1995), S. 572–576 [⭬ Literatur]
Kraus, Helmut: Scannen ; Mit Desktop-Scannern zum perfekten Bild. 1. korr. Nachdruck. Bonn, Paris u. a.: Addison-Wesley, 1996; dort: »Die Alternative: Kodak Photo CD« (S. 104–111)
Steinbrink, Bernd: Bilderspuren ; Aufzeichnungs- und Grafikformate der Photo-CD. In: c’t (1993), Nr. 4, S. 236–245
s. a. ⭬ hybrider Workflow
Photographie
Alternative Schreibweise für Fotografie; lt. Wörterbuchredaktion des Duden möglich, aber nicht empfohlen; eine gemischte Schreibung ist ›falsch‹.
Die Bestandteile des Wortes Fotografie sind zwar dem Griechischen entlehnt: τὸ φῶς (Gen. φωτός) und ἡ γράφή, sinngemäß also Lichtbild. Üblich ist im Deutschen, bei griech. Wörter aus der Antike das Φ/φ als Ph/ph zu transkribieren – das trifft hier jedoch nicht zu, da die Fotografie erst im frühen 19. Jahrhundert entwickelt und benannt wurde.
Wer F. demonstrativ mit Ph/ph schreibt, will damit wohl diffus auf die Tradition der ⭬ emulsionsbasierten Fotografie verweisen und sich von der ›Fotografie nach der Fotografie‹ (vulgo: Digitalfotografie) distanzieren.
engl.: photography; franz.: la photographie f.; griech.: η φωτογραφία f.; ital.: la fotografia f.; russ: фотография f. (Ф/ф wird als F/f übertragen); span.: la fotografía f.; ukr.: фотографії f.
Pigmentdruckverfahren
Pinregistrierung
Methode, mehrere Lagen Film oder Papier exakt (übereinander) auszurichten, z. B. beim Maskieren, Kopieren, Druckplatten belichten usw.
Die Halterung (register plate) besitzt zwei kleine Stifte (pins). Das Material wird mit einer passenden Stanze (punch) gelocht, so dass es in die Halterung passt.
Pinregistrierte Dias befinden sich exakt zwischen acht Perforationslöchern.
Pinhole camera
Planfilm
Filmformate für die ⭬ Großformat-Fotografie (schmale Seite > 6 cm) werden i. d. R. nicht gerollt, sondern als Blattware verwendet (für die Luftbildfotografie werden diese allerdings auch gerollt). Typische Planfilmformate sind 4 × 5 ″ und 8 × 10 ″. Für die Nutzung in ⭬ Fachkameras werden Planfilme vor dem Belichten in Kassetten geladen.
s. a. ⭬ Kerben-Code
engl.: sheet film
Plastiskop
Betrachter für Miniaturdias ohne eingebaute Lichtquelle.
Die kleinen Dias sind auf einer Scheibe montiert, die durch eine Mechanik per Knopfdruck gedreht wird. Das Gerät wird gegen eine Lichtquelle gehalten, um die Dias durch die eingebaute Lupe zu betrachten.
Website des Herstellers: ↱ plastiskop.de [2025-12-28]
s. a. ⭬ Diabetrachter
Platindruck, Platin/
palladiumdruck Negativ-Positiv-Prozess; ⭬ vegan
Der P. ist kein Druckverfahren, sondern ein ⭬ Kontaktkopierverfahren zur Herstellung von Einzelblättern; er wird den kunstfotografischen ⭬ Edeldruckverfahren zugeordnet.
Der Platindruck wurde 1873 erfunden. Es gibt drei leicht unterschiedliche Vorgehensweisen, das Prinzip ist jedoch einfach. Aus Kostengründen werden heute allerdings nur noch selten reine Platinprints hergestellt, sondern das Platin wird ganz oder teilweise durch das chemisch ähnliche Palladium ersetzt.
Im ersten Schritt wird ein Blatt Papier sensibilisiert, also lichtempfindlich beschichtet. Als lichtempfindliche Substanzen werden beim Platindruck Eisenverbindungen genutzt. Je nach Verfahren kommt das Platin/
Palladium entweder schon hier aufs Papier (⭬ Auskopierverfahren) oder erst in den nachfolgenden Bädern. Die Wahl des Papiers ist eine künstlerische Entscheidung, häufig wird hochwertiges Aquarellpapier verwendet. Ist das Blatt getrocknet, wird es durch ein Negativ mit UV-Licht belichtet; dadurch entsteht auf dem Papier schon ein schwaches Bild, das in anschließenden Bädern verstärkt wird.
Das Bild entsteht letztlich aus Platin/
Palladium, da sich im Prozess das Metall stufenlos auf dem Papier ablagert. Das Bild ist völlig matt und der Tonwertumfang von Platin-/ Palladiumdrucken kann sehr hoch sein. Außerdem beeindrucken die Prints häufig mit einer grandiosen Tiefenzeichnung. Interessant ist, dass das Bild nicht in einer Kolloidschicht (z.B. Gelatine) eingebettet ist, sondern sich direkt auf der Papierfaser befindet.
Platin und Palladium sind stabilere Edelmetalle als Gold. Daher haben Platin-/
Palladiumdrucke eine Archivfestigkeit, die nur von der Stabilität des Papierträgers abhängt. Ein P. kann im ⭬ Gummidruck-Verfahren mit demselben Negativ überdruckt werden.
engl.: platinotype, platinum print
PMK, Pyro Metol Kodalk
Polarisationsfilter, Polfilter
engl.: polarizing filter
Porträtfilm, Mattfilm (hist.)
Die Trägerseite dieser Filme ist mattiert, damit die Negative z. B. mit einem Bleistift einfach zu retuschieren sind.
Polaroid
Die ursprüngliche Firma Polaroid Corporation (gegr. 1937 von Edwin Herbert Land (1909–1991)) ging 2008 insolvent, dadurch Ende der Produktion von Polaroid-Sofortbildkameras und -filmen; Übernahme der ehem. Polaroid-Filmfabrik in Enschede (NL) durch The Impossible Project (Florian Kaps u. a.), 2017 umbenannt in Polaroid Originals seit 2020 wieder Polaroid
Zu Zeiten von Original-Polaroid gab es eine große Bandbreite an Materialien und Kameras (eine Auswahl an hist. Datenblättern gibt es hier: ↱ 125px.com/docs/film/polaroid/ [2023-05-20]).
Aktuell (2024) gibt es fünf verschiedenen Filmtypen (alles ⭬ Integralfilme, ⭬ spektral sensibilisiert für ⭬ Tageslicht)¹:
SX-70 600² Go i-Type 8 × 10³ Batterie im Filmpack ja ja nein nein nein Bildgröße (mm) 79 × 77 79 × 77 47 × 46 79 × 77 ⭬ Seitenverhältnis ≈ 1:1 ≈ 1:1 ≈ 1:1 ≈ 2:3 Blattgröße (mm; jeweils Hochformat) 107 × 88 107 × 88 67 × 54 103 × 101 ⭬ Filmempfindlichkeit (ISO) 160/23° 640/29° 640/29° 640/29° ≈ 640/29° Bilder pro Pack⁴ 8 8 8 8 10 1) Leider gibt es keine Datenblätter.
2) Mit ⭬ Graufilter (Dichte 0.6) auch in SX-70-Kameras nutzbar
3) ⚠ Bilder erscheinen seitenverkehrt; passender Filmhalter und -prozessor nötig (siehe ↱ support.polaroid.com/hc/en-us/articles/360012376180-8x10-what-material-is-needed [2024-05-20]; Anleitung: ↱ fotoimpex.de/shop/images/products/media/58320_4_PDF-Datenblatt.pdf [2024-05-20])
4) Die originalen Polaroid-Filmpacks enthielten zehn Bilder, worauf die Bildzähler der hist. Polaroidkameras abgestimmt sind; diese zeigen also mit den neuen Filmpacks immer zwei Aufnahmen zu viel an. Zur Bedeutung des auf die einzelnen Bilder der neuen Filmpacks verso gedruckten Codes: ↱ support.polaroid.com/hc/en-us/articles/115012554408-What-is-the-number-on-the-back-of-the-photo [2024-05-20]Website des Herstellers: ↱ polaroid.com/ [2024-05-20]
Arbeiten von mir, die mit einer Polaroidkamera entstanden sind:
「Verblassende Erinnerung」 (2012)
Lit.:
Frech, Martin: »Sofortbild-Simulation, aber nicht sofort«. In: Notizen zur Fotografie. 7. Nov. 2008. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2008-11-07/Sofortbild-Simulation.html [2024-06-09]
Meurer, Jens: An Impossible Project. [Film] Deutschland, Österreich: Instant Film, Mischief Films, ARRI Media. 2020.
Online verfügbar via YouTube: ↱ youtube.com/watch?v=hV17iwAKnxk [2024-09-15]
s. a. ⭬ Instax
Portfolio
Eine kohärente Zusammenstellung von Bildern (üblicherweise mit einem verbindendem Merkmal), die gemeinsam veröffentlicht werden.
Prägestempel, Prägezange
Durch Prägen wird ein Bild irreversibel gekennzeichnet – im Gegensatz zu einem Stempelabdruck subtiler und garantiert ⭬ archivfest.
Mit Prägezangen können Pappen bis etwa 250 g/m² geprägt werden, soll das Motiv in stärkere Papiere, z. B. ⭬ Passepartoutkartons, geprägt werden, benötigt man eine Presse für mehr Druck (oder man nutzt einen Handschlagstempel/
In die Prägezange sind zwei Prägeplatten eingesetzt; die untere zeigt das Motiv erhaben, die obere ›versenkt‹ (Patrize und Matrize). Durch das Prägen wird das Motiv als dreidimensionale Blindprägung (farblos) ins Papier gedrückt.
engl.: embossing
engl. Bezeichnung für eine ausgearbeitete Fotografie (photographic print); diese ist zwar kein ›Druck‹ (außer bei manchen ⭬ Edeldruckverfahren), dennoch wird dieser Begriff häufig auch im Deutschen verwendet. Präziser sind die Begriffe ⭬ Vergrößerung bzw. ⭬ Kontaktkopie. Nicht selten wird print auch in Fachtexten missverständlich als ›Druck‹ übersetzt; das sollte man m. E. nicht tun.
s. a. ⭬ Fotopapier
print grain index, PGI
Wert für die wahrgenommene ›Körnigkeit‹ (⭬ Filmkorn) einer mind. 10 × 15 cm (4 × 6 ″) großen optisch hergestellten FarbVergrößerung von einem Farbnegativ bei einem Betrachtungsabstand von ca. 36 cm (14 ″); als Wahrnehmungsschwelle für Filmkorn gilt ein PGI von 25.
Der PGI eignet sich dazu, Farbnegativfilme hinsichtlich ihrer ›Körnigkeit‹ zu vergleichen.
s. a. ⭬ RMS-Wert
Lit.:
Print Grain Index ; Firmenschrift Kodak E-58. Juli 2000. Online: ↱ 125px.com/docs/techpubs/kodak/e58-2000_07.pdf [2022-10-28]
Probestreifen, Belichtungsprobe
Mit dem P. wird materialsparend die richtige Belichtungszeit für das ⭬ Fotopapier in der ⭬ Dunkelkammer ermittelt (⭬ Vergrößerung/
Vorgehen:
Plazieren Sie den P. auf dem ⭬ Vergrößerungsrahmen unter Rotlicht an einer bildwichtigen Stelle.
Belichten Sie den gesamten Streifen, bspw. mit 3 s.
Bedecken Sie etwa ein Fünftel des Streifens mit einem auf die Papieroberfläche gelegten Stück Karton (dieser muss lichtdicht sein!).
Machen Sie eine weitere Belichtung mit 3 s.
Ziehen Sie den Karton weiter, bis das nächste Fünftel des Fotopapierstreifens bedeckt ist und belichten Sie wieder 3 s.
Wiederholen Sie den Vorgang für die gesamte Länge des P.
Da sich die Belichtungen addieren, ist das hellste Feld jetzt mit 3 s belichtet, das dunkelste mit 15 s.
Entwickeln Sie den Streifen.
Evaluieren Sie den getrockneten P. bei hellem Licht. Ein Feld sollte halbwegs passend aussehen – die entsprechende Belichtungszeit ist der Startpunkt für die weitere Ausarbeitung.
Zeigt der Streifen nur falsch belichtete Ausschnitte, wiederholen Sie den Vorgang mit anderen Zeiten.
Die 3 s sind nur beispielhaft; die konkrete Zeit ist von den konkreten Lichtbedingungen abhängig.
Wählen Sie als Ausschnitt für den P. einen wichtigen Teil des Bildes, der idealerweise dunkle und helle Bereiche aufweist; bei großen Endformaten können auch mehrere P. an verschiedenen Stellen nötig sein.
Wichtig:
Es gibt für richtig belichtete Negative eine kürzeste Papier-Belichtungszeit (die Standardbelichtungszeit), die das nahezu maximale Schwarz auf dem Fotopapier ergibt. Diese Zeit hängt von der Dichte des unbelichteten Films (und dem Vergrößerungsmaßstab) ab.
Die Schattenpartien werden durch die Belichtungszeit allein definiert – die Lichter werden zusätzlich durch die ⭬ Papiergradation beeinflusst.
engl.: test strip, exposure test
Projektion, Bildwurf
Übertragung eines Bildes auf eine Abbildungsfläche, z. B.:
Verkleinernde Abbildung: Das Objektiv in einer Kamera erzeugt eine Projektion des Motivs auf die fotogr. Schicht.
Vergrößernde Abbildung: Projektion eines Films oder eines ⭬ Dias auf eine Leinwand (⭬ Diaprojektion).
engl.: projection
Lit.:
zur Bedeutung der Diaprojektion für das Studium der Kunstgeschichte:
Männig, Maria: »Bruno Meyer and the Invention of Art Historical Slide Projection«. In: Photo-Objects: On the Materiality of Photographs and Photo Archives. Hg. Bärnighausen, Julia, Caraffa, Costanza, Klamm, Stefanie, Schneider, Franka and Wodtke, Petra. Berlin: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 2019. DOI: 10.34663/9783945561409-17. Online: ↱ mprl-series.mpg.de/studies/12/17/index.html [2023-01-06]
Protectan (Tetenal; hist.)
Gas zum Schutz fotografischer Lösungen vor Oxidation; enthält 10 – 20 % Isobutan, 20 – 30 % Propan und 50 – 70 % Butan
Push-/Pull-Prozess
git fetch
in unserem Kontext:
Filmentwicklung mit einer deutlich längeren (push) oder kürzeren (pull) Entwicklungszeit als bei der Normalentwicklung mit dem Ziel, den Kontrast zu beeinflussen. Die geänderte Zeit kompensiert eine Über- oder Unterbelichtung der fotogr. ⭬ Schicht – bei Negativfilmen ändert sich deren Empfindlichkeit dadurch jedoch nicht.
s. a. ⭬ Zonensystem
Q
Q 60-Target (Kodak)
Kodak-Bezeichnung für das ⭬ IT 8-Target
Quinol
Kodak-Name für ⭬ Hydrochinon ⚠
R
RA-4-Prozess
von Kodak definierter chromogener Negativ-Positiv-Prozess zur Entwicklung von ⭬ Color-Fotopapier (Nachfolger für EP-2); der kompatible Prozess von Agfa hieß AP-94; für konsistente Ergebnisse nur in Entwicklungsmaschinen nutzbar
Randnummern
s. a. ⭬ Keykode
Rapid-Filmpatrone (Agfa; hist.)
1964 Agfas Antwort auf Kodaks Instamatic (Kodak ⭬ Film-Typ 126); 35 mm-Film in Patrone; Aufnahmeformate 24 × 24 mm, ⭬ Halbformat sowie das übliche 24 × 36 mm; funktioniert wie das ältere ⭬ Karat-System und ist zu diesem kompatibel (auch max. zwölf Aufnahmen); im Gegensatz zu jenem ist die ⭬ Filmempfindlichkeit in der Patrone kodiert (dies wird jedoch nicht von allen Kameras ausgewertet); wird nicht mehr hergestellt, vorhandene Patronen können jedoch mit Kleinbildfilm selbst geladen werden (max. 60 cm).
s. a. ⭬ SL-Cassette
Raster, Druckraster
engl.: halftone screen
s. a. ⭬ Halbtonbild; ⭬ Strichfilm
Rasterfilm
s. a. ⭬ Halbtonbild; ⭬ Strichfilm
Redscale
Aufnahmen, für die der Film umgekehrt in die Patrone konfektioniert wurde. In der Kamera zeigt die Schichtseite daher zur Rückwand und wird durch den Träger belichtet – mit der Folge, dass die üblicherweise vorne liegende blau-empfindliche Schicht unbelichtet bleibt, da das blaue Licht vom Gelbfilter absorbiert wird. Bei der Entwicklung wird daher kein gelbes Bild gebildet. Wenn man beim Vergrößern nun die Grautöne neutral filtert, bekommt das Positiv eine rot-braune Anmutung.
Lit.:
Frech, Martin: »Film: Rollei Redbird 400 (redscale)«. In: Notizen zur Fotografie. 1. Sep. 2009. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2009-09-01/Film_Rollei-Redbird-400_redscale.html [2022-06-10]
Schaack, Lena E. M.: A Systematic Redscale Review ; deutsche Auflage. o. O.: [Privatdruck], 2022
Rem-jet
Reproduktionsfotografie, Reprofotografie
engl.: reproduction photography
Riefelbild
engl.: tabula scalata
Risographie
Lit.:
Tillack, Sven: Exploriso: Low-tech Fine Art. Leipzig: Spector, 2020. ISBN 978-3-95905-304-4
RMS-Wert der Granularität (Root Mean Square; Standardabweichung)
Standardabweichung zufälliger Dichteschwankungen für einen bestimmten Film.
Der R. ist ein Maß für die Granularität/
| RMS-Wert | Klassifizierung |
|---|---|
| 45, 50, 55 | sehr grob |
| 33, 36, 39, 42 | grob |
| 26, 28, 30 | mäßig grob |
| 21, 22, 24 | mittel |
| 16, 17, 18, 19, 20 | fein |
| 11, 12, 13, 14, 15 | sehr fein |
| 6, 7, 8, 9, 10 | extrem fein |
| < 5,5 | mikrofein |
s. a. ⭬ print grain index
Lit.:
The Essential Reference Guide for Filmmakers. Firmenschrift Kodak H-845. 2007. Online: ↱ kodak.com/content/products-brochures/Film/kodak-essential-reference-guide-for-filmmakers.pdf [2023-08-06]
engl.: RMS granularity
Robot (Kamera)
Name für die Federwerk-Kameras der Firma Robot (erfunden von Heinz Kilfitt, gebaut in der Firma von Hans Heinrich Berning, Düsseldorf; heute: Jenoptik Robot GmbH, Monheim); Aufnahmeformat: meist 24 × 24 mm.
Lit.:
- Kross, Walter: Robot ; die filmende Kleinbildkamera. 2. Aufl. Düsseldorf: Knapp, 1950 [Robot II, IIa, Star]
Rodinal (urspr. Agfa)
proprietärer ⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm (nicht verwechseln mit ›Rodinal Spezial‹!); 1891 entwickelt und patentiert von Dr. Momme Andresen (1857–1951) für Agfa; sehr, sehr, sehr lange haltbares Flüssig-Konzentrat für hohe ⭬ Verdünnungen (üblich sind 1 + 25, 1 + 50, 1 + 100)
⭬ Entwicklersubstanz ist Para-Aminophenol (= p-Aminophenol bzw. 4-Aminophenol); vergleichbare Produkte sind Adonal (Adox); Fomadon R09 (Foma); Paranol S (Tetenal); R-09 (Calbe)
Die Original-Rezeptur war ein Agfa-Geheimnis bis Offiziere der britischen Armee 1945 die Filmfabrik in Wolfen durchsuchten und die Mitarbeiter befragten (der Bericht ist online verfügbar: ↱ cdvandt.org/CIOS-XXX-15.pdf [2024-07-27], die Rodinal-Rezeptur ist auf S. 18).
PaRodinal
PaRodinal ist ein Rodinal-Nachbau auf der Basis des schmerzlindernden und fiebersenkenden Arzneistoffs Acetaminophen/
| PaRodinal nach Donald Qualls | |
|---|---|
| Menge | Substanz |
| 200 ml | demineralisiertes Wasser |
| 50 g | Natriumsulfit (Na₂SO₃) Die Menge geht erst später vollständig in Lösung. |
| 20 g | Natriumhydroxid (NaOH) Exotherme Reaktion: Die Lösung wird warm. |
| 15 g | Paracetamol Das sind 30 Tabletten à 500 mg; |
| Auf 250 ml mit demineralisiertem Wasser auffüllen. | |
Vor Verwendung etwa 3 Tage stehen lassen; | |
Lit.:
Bishop-Thorpe, Alex: »Film Developer Recipe: PaRodinal«. In: The Analogue Laboratory. 18. Feb. 2017. Online: ↱ analoguelab.com.au/film-developer-recipe-parodinal [2023-12-29]
- Datenblatt Rodinal: ↱ fotoimpex.de/shop/images/products/media/56415_4_PDF-Datenblatt.pdf [2023-12-29]
- Finger, Ehrhard: Momme Andresen – Pionier der Fotografie. Erfurt: Desotron, 2007.
- »Rodinal« in: Cassell’s cyclopædia of photography. Hg. Bernard E. Jones. London, New York usw.: Cassell and Co., 1911. S. 463
↱ Online via Internet Archive [2024-07-27] Troop/
Anchell (2020), S. 77 f. [⭬ Literatur]
s. a. ⭬ Standentwicklung
Rollfilm
I. w. S. auf Spule konfektionierter fotografischer Film
I. e. S. nichtperforierter ⭬ Mittelformat-Film, der eng auf eine offene Spule aufgewickelt ist. Der Lichtschutz ist durch zwei Flansche gewährleistet, sowie durch Papierstreifen an beiden Enden.
Der Film wird in der Kamera auf die Aufwickelspule umgerollt und zum Entnehmen nicht zurückgespult – die bisherige Filmspule wird die neue Aufwickelspule.
In der Fototechnik-Geschichte gab es eine ganze Reihe von Rollfilm-Typen. Gebräuchlich ist nur noch der ⭬ Typ 120. Die Typen 220, 127 und 620 werden noch manufakturähnlich konfektioniert.
Rollfilm ⭬ Typ 120
Der Standard-⭬ Rollfilm für ⭬ Mittelformat-Fotografie liegt auf einem durchgehenden opaken Papierträger. Verbreitete Aufnahmeformate sind 4,5 × 6 cm (15/16 Bilder/
Länge: min. 820 mm, max. 850 mm (ISO 732:2003-09)
Für den Filmtransport gibt es zwei Varianten:
Durch Drehen der Aufwickelspule: Auf den Papierträger sind Bildnummern aufgedruckt, die durch ein Fensterchen in der Rückwand der Kamera sichtbar sind. Die Aufwickelspule wird so lange gedreht, bis die nächste Nummer erscheint.
Durch eine geeignete Mechanik per Filmtransporthebel.
Rollfilm ⭬ Typ 127
Rollfilm ⭬ Typ 220
220er Rollfilm nutzt die gleiche Spule wie Typ 120, ist jedoch doppelt so lang und besitzt keinen Papierträger – dadurch sind mit geeigneten Kameras (s. u.) doppelt so viele Aufnahmen pro Film möglich. Damit der Film beim Ein- und Auslegen lichtgeschützt ist, ist an die Enden je eine Allonge aus opakem Papier angeklebt.
Länge: min. 1651 mm, max. 1700 mm (ISO 732:2003-09)
Die Produktion von 220er-Rollfilm wurde von den großen Filmherstellern ca. 2015 eingestellt. Seit 2020 wird er wieder konfektioniert – allerdings nur als 21° DIN-Schwarzweißfilm von FilmoTec/
DIY-Anleitung zum selbst konfektionieren von 220er-Rollfilm: ↱ youtube.com/watch?v=kU2JPDuVp4M [2024-07-07].
Da der 220er-Rollfilm kein Lichtschutzpapier hat, kann dieser nicht in allen Rollfilmkameras verwendet werden:
Bei Kameras mit Fensterchen für die Bildnummern würde der Film unkontrolliert belichtet werden. Kameras für 220er-Rollfilm benötigen daher einen ausgefeilten Mechanismus für den Filmtransport.
Der Film ist ohne das Schutzpapier deutlich dünner: Bei unveränderter Position der Andruckplatte wäre die Planlage nicht gewährleistet. Kameras für beide Filmtypen haben eine umschaltbare Andruckplatte.
Rollfilm ⭬ Typ 620
Beim 620er unterscheidet sich nur die Spule vom 620er-Rollfilm, die Maße des Films sind dieselben.
Will man 620er-Rollfilm nutzen (⭬ Kodak Brownie, ganz alte Rolleiflex usw.), kauft man sich einen der Boutique-Filme (wenig Auswahl; siehe Tabelle beim Stichwort ⭬ Film-Typ) oder rollt selbst einen 120er-Film um auf eine 620er-Spule (manche Kameras akzeptieren sogar 120er-Spulen auf der Aufwickelseite); es gibt Vorrichtungen, die das Umrollen erleichtern.
Rückentwicklung
Erneutes Entwickeln eines ⭬ Prints nach dem ⭬ Bleichen; kann im Hellen erfolgen
S
Sabattier-Effekt (auch: Pseudo-Solarisation)
Die Tonwerte einer anentwickelten fotogr. ⭬ Schicht werden teilweise oder vollständig umgekehrt, wenn sie während der weiteren Entwicklung mit weißem Licht diffus nachbelichtet wird. Benannt nach Armand Sabbatier (1834–1910).
s. a. ⭬ Solarisation
Salzdruck
Negativ-Positiv-⭬ Auskopierverfahren; geht zurück auf das von William Henry Fox Talbot (1800–1877) 1834 entwickelte Verfahren der fotogenischen Zeichnung, das er 1840 zur ⭬ Kalotypie verfeinerte.
Der P. ist kein Druckverfahren, sondern ein ⭬ Kontaktkopierverfahren zur Herstellung von Einzelblättern von Negativen; die Negative sollten kontrastreich sein und hohe Dichten aufweisen.
Papier salzen:
Das (geleimte) Papier wird in einer 2 %-Salzlösung (20 g Salz auf 1 l demin. Wasser) gebadet und getrocknet.Sensibilisieren:
10 g Silbernitrat in 42 ml demin. Wasser lösen
5 g Zitronensäure in 42 ml demin. Wasser lösen
beide Lösungen mischen
damit das gesalzene Papier bestreichen, bei Raumtemperatur im dunkeln trocknen lassen
Das Papier im Kontakt mit dem Negativ unter UV-Licht belichten, evtl. eine dünne Folie zum Schutz des Negativs dazwischen legen.
ausgiebig Wässern um das restliche Silbernitrat zu entfernen
Wenn gut gewässert wurde, ist das nicht nötig, zur Sicherheit kann jedoch fixiert werden (kein Schnellfixierer).
evtl. ⭬ Tonen
engl.: salt print
Satzobjektiv
Objektiv aus einzelnen Baugruppen, die einzeln oder kombiniert verwendet werden zur Änderung der Brennweite.
engl.: convertible lens; combinable lens
Scala (Agfa; hist.)
Agfa Scala 200x war ein ⭬ Schwarzweißdiafilm zur Entwicklung in einem proprietären Hochtemperatur-Prozess (der in D nur von sechs lizenzierten ⭬ Fachlaboren angeboten wurde); er konnte jedoch auch zum Negativ entwickelt werden (Zeiten des Agfa APX 100).
Agfa Scala war ein außergewöhnlicher Film, es gab kein vergleichbares Produkt: nutzbarer ⭬ E I von ISO 100/21° (dann geringerer Kontrast, gut zum Duplizieren von Schwarzweißnegativen und Scala-Dias) bis ISO 1600/33°; feinkörnig, sehr scharf, besonders brillant, fein modulierte Grauwerte, satte Tiefen. Die ⭬ Gradation war so abgestimmt, dass sie dem Farbdiafilm Agfachrome RSX II 100 entsprach; verfügbar als ⭬ Kleinbild- ⭬ Roll- und ⭬ 4 × 5 ″-Planfilm.

Die Scala-Kleinbild-Patronen haben keinen aufgedruckten ⭬ DX-Code.
Die später von Adox angebotenen Produkte Adox Scala 50 BW (= HR 50) und 160 BW (Filme) sowie das Adox Scala Umkehrkit (Chemie zum ⭬ umkehrentwickeln von Schwarzweißnegativfilmen) gleichen den entsprechenden Agfa-Produkten nur dem Namen nach.
Lit.:
Agfa Scala 200x ; Technical Data. 8. Aufl. Firmenschrift Agfa F-SW12-E8. Okt. 2001.
Scala, the B&W reversal kit. Firmenschrift Adox. 2021. Online: ↱ fotoimpex.de/shop/images/products/media/66896_5_PDF-Datasheet.pdf [2024-07-06]
Technische Beschreibung: Adox HR-50 Hochauflösungsfilm. Firmenschrift Adox. 20. Nov. 2018. Online: ↱ fotoimpex.de/shop/images/products/media/63360_4_PDF-Datenblatt.pdf [2024-07-06]
Schalenentwicklung
s. a. ⭬ Tankentwicklung
engl.: tray development
Schärfentiefe, Tiefenschärfe
engl.: depth of field (DOF)
Schicht, fotografische (auch: Emulsion)
Eine erstarrte Suspension der lichtempfindlichen Silberhalogenidkristalle (Silberchlorid/
Aufbau des fotogr. Materials:
----- 1. transparente Schutzschicht
XXXXX 2. lichtempfindliche Schicht
(meist aus mehreren sehr dünnen Schichten)
----- 3. Substrat
XXXXX 4. Träger (s. u.)
----- 5. evtl. ⭬ Lichthofschutzschicht Trägermaterialien
| Vorteile | Nachteile | |
| Glas | nicht entflammbar; lange Haltbarkeit; dimensionsstabil | hohes Gewicht; unflexibel; zerbrechlich; braucht mehr Platz im Lager |
| Papier | ⭬ Fotopapier (auch auf Polyethylen) wird für Film nur experimentell genutzt, z. B. Film Washi | |
| Polyester (PET) | flexibel; schwer entflammbar; lange Haltbarkeit (chemisch inert); mechanisch sehr stabil | lightpiping; kann nur trocken mit Klebeband geklebt werden; kann sich leicht statisch aufladen; mechanisch sehr stabil (kann bei Problemen Transportmechaniken zerstören) |
| Celluloseacetat (Cellulosedi- und triacetat) | flexibel; schwer entflammbar (⭬ Sicherheitsfilm); flexibel; kann nass mit Filmkleber (Filmzement) geklebt werden | kann reißen; Haltbarkeit sehr von Lagerbedingungen abhängig (⭬ Essigsäure-Syndrom) |
| ⭬ Zelluloid, Nitrocellulose | flexibel; lange Haltbarkeit | ⚠ leicht entzündlich; verbrennt selbstbeschleunigend |
Die Träger Celluloseacetat und Zelluloid zweifelsfrei zu unterscheiden, ist aufwendig.
Erste Hinweise geben Kennzeichnungen am Filmrand (›safety‹ kennzeichnet z. B. einen ⭬ Sicherheits-/
Acetatfilm ), die jedoch auch kopiert sein könnten (bspw. von einem ⭬ Zwischennegativ).Wenn man einen Schnipsel anzündet (⚠) und dieser schnell lichterloh und nahezu rückstandsfrei verbrennt, handelt es sich um ⭬ Zelluloidfilm.
Polyesterfilm lässt sich kaum zerreißen.
Wenn man einen Schnipsel in ein Gefäß mit Trichlorethen ⚠ gibt, schwimmt Acetatfilm oben, Zelluloidfilm sinkt an den Boden und Polyesterfilm schwebt ungefähr in der Mitte.
Lit.:
A Guide to Identifying Year of Manufacture for KODAK Motion Picture Films. Firmenschrift Kodak TI-2660. April 2013. Online: ↱ kodak.com/content/products-brochures/Film/Guide-to-Identifying-Year-of-Manufacture-for-KODAK-Motion-Picture-Films.pdf [2024-07-25]
Netzwerk Cellulosenitrat ; Die Plattform für den Austausch von Informationen zum Kunststoff Cellulosenitrat (CN) in Kulturerbe-Sammlungen. Website: ↱ netzwerk-cn.de [2024-07-25]
Walther, Werner: Fotografische Verfahren mit Silberhalogeniden. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1983
s. a. ⭬ Sensibilisierung
Schichtseite
Fotografisches Material hat zwei Seiten: den Träger und die fotogr. ⭬ Schicht, in der das Bild entsteht. Die S. zeigt zum Objektiv und ist bei Filmen meist matt, die Trägerseite glänzend (⚠: nicht jedoch bei ⭬ Porträtfilm); bei ⭬ Planfilmen schaut man auf die S., wenn der ⭬ Kerbcode rechts oben ist; bei ⭬ Fotopapier ist die S. fühlbar glatter.
engl.: emulsion side
Schieber, Magazin-Schieber
s. a. ⭬ Hilfsverschluss
Lit.:
Heymann, Stefan: Wie der Hasselblad Magazin-Schieber funktioniert. Private Webseite. 9. März 2008. Online: ↱ stefanheymann.de/501cm/magazinschieber.htm [2024-03-08]
engl.: darkslide
Schleier
engl.: fog
Schleiertest
Prüfverfahren, ob die Beleuchtung der ⭬ Dunkelkammer (⭬ Dunkelkammerlampe; ⭬ Dunkelkammerleuchte) das ⭬ Fotopapier schwärzt:
- Im Dunkeln: Die linke Hälfte eines Bogens Fotopapier unter dem ⭬ Vergrößerer zu einem leichten Grau vorbelichten.
- Dieses Papier an eine Stelle legen, an der üblicherweise mit Fotopapier hantiert wird.
- Nun die vorbelichtete linke Hälfte abdecken und die rechte Hälfte streifenweise mit der Dunkelkammerbeleuchtung »belichten«: Wie beim Anfertigen eines ⭬ Probestreifens vorgehen, nur in längeren Intervallen (2 min, 4 min und 8 min).
- Im Dunkeln das Papier wieder unter den Vergrößerer legen und die rechte Hälfte mit den gleichen Parametern wie im 1. Schritt belichten.
- Im Dunkeln entwickeln.
Idealerweise sind beide Hälften des Fotopapiers nahezu gleich grau. Wenn nicht, sollte Fotopapier nicht länger der Dunkelkammerbeleuchtung ausgesetzt werden, als die Zeit, bei der sich der Grauton beim Test geändert hat.
Den S. sollte man jährlich wiederholen, auf jeden Fall nach einem Wechsel der Dunkelkammerlampe bzw. des Leuchtenfilters und wenn man einen neuen Typ Fotopapier verarbeitet.
engl.: safelight test
Schlitzverschluss
Variante eines ⭬ Kameraverschlusses
Der S. befindet sich meist fest eingebaut im Kameragehäuse, direkt vor dem Film/
Nach dem Auslösen öffnet der S., indem sich der erste Vorhang bewegt; am Ende der Belichtungszeit folgt der zweite Vorhang und schließt den Verschluss. Bei kurzen Belichtungszeiten bewegt sich also ein Schlitz über die Filmfläche und Teile des Films werden nacheinander belichtet; das kann bei bewegten Motiven zu Verzerrungen führen (Rolling-Shutter-Effekt).
Der größte Nachteil gegenüber dem ⭬ Zentralverschluss ist jedoch die vergleichsweise lange minimale Blitzsynchronzeit, da für eine gleichmäßige Belichtung beim Blitzen der Verschluss für die Dauer des Blitzes komplett geöffnet sein muss. Beim S. liegt diese Offenzeit, bevor der zweite Vorhang losläuft, meist zwischen ¹⁄₂₀₀ s und ¹⁄₆₀ s; bei manchen älteren Kameras sogar noch darunter. Das ist vor allem dann problematisch, wenn der Blitz zum Aufhellen von Schattenpartien bei Sonnenlicht eingesetzt werden soll, der ⭬ Blendenwert aus bildgestalterischen Erwägungen jedoch nicht allzu groß werden soll.
Vorteile gegenüber dem ⭬ Zentralverschluss:
Mit dem S. sind sehr kurze Belichtungszeiten möglich: ¹⁄₈₀₀₀ s bei der Nikon F-801, F100 und F6 und sogar ¹⁄₁₂ ₀₀₀ s bei der Minolta Dynax 9xi.
Für Kameras mit Wechselobjektiven ist der S. Standard: Es ist kein ⭬ Hilfsverschluss nötig, um den Film beim Objektivwechsel abzudecken – außerdem muss nicht in jedes Objektiv des jeweiligen Systems ein eigener Verschluss eingebaut werden.
engl.: focal-plane shutter
Schmalfilm
Kinefilmformate, die schmaler als 35 mm sind.
9,5 mm-Film
s. a. ⭬ 35 mm-Film
Schutzgas für fotogr. Lösungen
z. B. ⭬ Protectan
engl.: protective gas; shielding gas
Schwarzschildeffekt
Die Schwärzung einer fotogr. ⭬ Schicht ergibt sich aus dem Produkt Belichtungszeit mal Lichtintensität. Für eine gewünschte Dichte ist es im Prinzip egal, ob mit mehr Licht kürzer belichtet wird, oder eine längere Belichtung mit weniger Licht erfolgt (Reziprozitätsgesetz). In der Praxis verhalten sich Schichten bei langen (und extrem kurzen) Belichtungszeiten jedoch nichtlinear – bei Belichtungszeiten länger als eine Sekunde muss zunehmend länger belichtet werden; bei Farbmaterial muss zusätzlich gefiltert werden. Details verraten die Datenblätter der Filmhersteller (Ilfords HP5+ muss beispielsweise 20 s lang belichtet werden, wenn laut ⭬ Belichtungsmesser 10 s nötig wären).
Findet man keine Angaben zum Verlängerungsfaktor, kann man sich mit der Formel tverl. = t 1,3 behelfen.
engl.: Schwarzschild’s law, reciprocity law failure
Schwärzung
Schwärzungskurve (auch: charakteristische Kurve, Kennlinie)
Mittels ⭬ Sensitometrie ermitteltes Diagramm, in dem die entstehende Schwärzung der fotogr. ⭬ Schicht gegen den Logarithmus der Belichtungsstärke abgetragen ist. Die S. zeigt den Zusammenhang zwischen der von einer Schicht absorbierten Strahlungsenergie auf der Abszissen- und der sich daraus ergebenden Schwärzung auf der Ordinatenachse.
engl.: characteristic curve; H & D curve (nach Ferdinand Hurter (1844–1898) und Vero Charles Driffield (1848–1915))
Schwarzweißdiapositiv
Positiv-Positiv-Schwarzweißprozess
Schwarzweißentwicklung
Sektorenblende, Umlaufblende, Umlaufverschluss
Seitenverhältnis
↱ Peter Forrets Aspect ratio calculator [2024-07-27]
engl.: aspect ratio
Sensibilisierung, spektrale
Eine reine Silberchlorid-⭬ Schicht absorbiert Lichtenergie bis ca. 450 nm, eine reine Silberbromid-Schicht bis ca. 500 nm; längerwelliges Licht hat keine fotochemische Wirkung. Durch Zugabe von Polymethinfarbstoffen (Cyanine, Merocyanine; funktionelle Farbstoffe) zu einer Silbersalz-Emulsion wird diese für längerwelliges Licht empfindlich: Die Farbstoffe übertragen die absorbierte Lichtenergie auf das Silberalogenid (durch Energieübertragung oder Elektronentransfer, wer weiß?). Da das Absorptionsspektrum des Farbstoffs dem Sensibilisierungsspektrum entspricht, kann eine Schicht gezielt für bestimmte Spektralbereiche sensibilisiert werden.
⭬ orthochromatisch
⭬ orthopanchromatisch
⭬ panchromatisch
⭬ superpanchromatisch
⭬ Falschfarbenfilm
⭬ Infrarotfotografie
Wilhelm Vogel entdeckte die s. S. 1873 zufällig während er an einem ⭬ Lichthofschutz für Fotoplatten forschte. Seine 1884 herausgebrachte Azalinplatte war ein Meilenstein auf dem Weg zur panchromatischen Schicht.
Sensitometrie
Mittels S. wird die Reaktion der fotogr. ⭬ Schicht auf Belichtung und Entwicklung untersucht. So ermitteln die Hersteller beispielsweise die ⭬ Schwärzungskurve und damit ⭬ Filmempfindlichkeit einer fotogr. Schicht sowie die Parameter zu deren Entwicklung. Diese Erkenntnisse werden in Datenblättern und Verarbeitungshinweisen publiziert. Für die eigene Arbeit sind das jedoch nur Anhaltspunkte: Die sensitometrischen Befunde entstehen unter kontrollierten Laborbedingungen – diese unterscheiden sich jedoch wohl immer von den konkreten Arbeitsbedingungen vor Ort. Es ist daher sinnvoll, das fotogr. Material mit seiner eigenen Prozesskette einzutesten (s. a. ⭬ Zonensystem).
engl.: sensitometry
Lit.:
Basic Photographic Sensitometry Workbook. A self-teaching guide. Firmenschrift Kodak H-740. Nov. 2006. Online: ↱ kodak.com/content/products-brochures/Film/Basic-Photographic-Sensitometry-Workbook.pdf [2022-07-21]
Sicherheitsfilm
fotogr. Film auf einem Träger aus Celluloseacetat (CA) oder Polyester; schwer entflammbarer Nachfolger des ⭬ Zelluloidfilms
engl.: safety film; cellulose acetate film
Siemensstern
Kreis mit abwechselnd schwarzen und weißen Sektoren als Testmuster zur Prüfung der Abbildungsleistung von Objektiven und anderen optischen Systemen.
Theoretisch berühren sich die Sektoren nur im Kreismittelpunkt; praktisch kann das Muster nicht perfekt wiedergegeben werden. Die Qualität der Wiedergabe des Musters durch das Testsystem lässt Rückschlüsse auf dessen Auflösungsvermögen zu.
Im Videobereich wird der S. auch zur Schärfekontrolle verwendet.
↱ Generator für Siemenssterne [2024-07-27] der ags an der TU Braunschweig
engl.: Siemens star; spoke target
s. a. ⭬ Testtafel
Sigma-Kristall-Film (Fujifilm)
Fujifilms Typ-Bezeichnung für deren ⭬ Flachkristallfilm (Neopan 100 Acros II).
Silber
engl.: silver
Single 8
Skylightfilter
⭬ UV-Sperrfilter, zusätzlich zart hell-beige (Typ 1 A) oder sehr zart rosa (Typ 1 B) eingefärbt.
Zur Wirkung des ⭬ UV-Sperrfilters: siehe dort
Die Färbung des S. sorgt für eine leicht wärmere Farbwiedergabe.
s. a. ⭬ Farbfilter
SL-Cassette/Penti-Cassette
SL: Schnellade/
s. a. ⭬ Karat-Filmpatrone
Slow photography
Sofortbild-Fotografie
Das Aufnahmematerial enthält die Chemie zur Bilderzeugung, die von der Kamera nach der Aufnahme aktiviert wird, sodass das Bild kurze Zeit danach fertig ist; Filme von ⭬ Polaroid und Fuji (⭬ Instax).
engl.: instant photography
Solarigraphy (auch: Solargraphy)
Variante des ⭬ Lumen printing zur Aufnahme der Sonnenbahn mit einer ⭬ Lochkamera; Belichtungszeit meist mehrere Monate.
Solarisation
Einer der frühesten beschriebenen fotogr. Effekte: Eine extreme Überbelichtung der fotogr. ⭬ Schicht kann zu einer Tonwertumkehr führen. Der Effekt fällt oft auf in der Landschaftsfotografie, wenn die Sonne im Positiv dunkel erscheint – daher der Name; man findet ihn aber auch häufig in Nachtaufnahmen (Straßenlampen). Populär sind Ansel Adams (1902–1984): »The Black Sun, Owens Valley, California«, 1939 und Minor White (1908–1976): »The Black Sun«, 1955). Zeitgenössische Beispiele dieses Effekts finden wir z. B. in Bildern von Chris McCaw (* 1971) und Hans-Christian Schink (* 1961).
s. a. ⭬ Sabattiereffekt
engl.: solarization
Spielfilm, Fotografie im
Titel orig | Titel de | Jahr | Regie | Hauptrolle | FSK | Stichwort |
|---|---|---|---|---|---|---|
The Bang-Bang Club | 2010 | Steven Silver | Ryan Phillippe | 12 | Apartheid ; Autobiographie ; Pressefotografie ; Südafrika | |
The Bikeriders | 2023 | Jeff Nichols | Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy | 12 | Kriminalität ; Danny Lyon ; Motorrad | |
Blow Up | 1966 | Michelangelo Antonioni | David Hemmings | 16 | David Bailey ; Michael Cooper ; London ; Modefotografie | |
Boyhood | Kindheit | 2014 | Richard Linklater | Ellar Coltrane | 6 | Coming-of-Age ; Kindheit ; Langzeitstudie |
The Bridges of Madison County | Die Brücken am Fluß | 1995 | Clint Eastwood | Clint Eastwood | 12 | Fotoreportage ; Magazinfotografie ; National Geographic |
Cidade de Deus | City of God | 2002 | Fernando Meirelles | Alexandre Rodrigues | 16 | Pressefotografie ; Rio de Janeiro ; Zeitung |
Civil War | 2024 | Alex Garland | Kirsten Dunst, Cailee Spaeny | 16 | Bürgerkrieg ; Kriegsfotografie (analog! vs. digital) ; Pressefotografie ; Roadtrip ; USA | |
Closer | Hautnah | 2004 | Mike Nichols | Julia Roberts | 12 | |
Delirious | Blitzlichtgewitter | 2006 | Tom DiCillo | Steve Buscemi | 12 | Paparazzo ; Satire |
Eyes of Laura Mars | Die Augen der Laura Mars | 1978 | Irvin Kershner | Faye Dunaway | 16 | Modefotografie ; Helmut Newton ; Psycho |
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus | Fell – Eine Liebesgeschichte | 2006 | Steven Shainberg | Nicole Kidman | 12 | Diane Arbus ; Wolfsmensch |
High Art | 1998 | Lisa Cholodenko | Radha Mitchell | 16 | Kunst ; Nan Goldin | |
L’Homme qui voulait vivre sa vie | Nachtblende | 2010 | Éric Lartigau | Romain Duris | 12 | Amateur ; Beziehung |
L’Important c’est d’aimer | Nachtblende | 1975 | Andrzej Żuławski | Romy Schneider | 18 | Mafia ; Porno |
La dolce vita | Das süße Leben | 1960 | Federico Fellini | Marcello Mastroianni, Anita Ekberg | 12 | Boulevard ; Fotoreporter ; Paparazzo |
The Killing Fields | The Killing Fields – Schreiendes Land | 1984 | Roland Joffé | Sam Waterston | 16 | Fotoreporter ; Kambodscha ; Rote Khmer |
Kodachrome | 2017 | Mark Raso | Ed Harris | 16 | Vater-Sohn-Beziehung ; Kodak ⭬ Kodachrome | |
Life | 2015 | Anton Corbijn | Robert Pattinson | 0 | James Dean ; Dennis Stock | |
Lost in Translation | Lost in Translation – Zwischen den Welten | 2003 | Sofia Coppola | Bill Murray, Scarlett Johansson | 6 | Großstadt ; Melancholie ; Tokio |
Maria Larssons eviga ögonblick | Die ewigen Momente der Maria Larsson | 2008 | Jan Troell | Maria Heiskanen | 12 | Emanzipation ; Schweden |
Minamata |
| 2020 | Andrew Levitas | Johnny Depp | N. N. | W. Eugene Smith ; Japan ; Umwelt |
Nightcrawler | Nightcrawler – Jede Nacht hat ihren Preis | 2014 | Dan Gilroy | Jake Gyllenhaal | 16 | Fotoreporter ; Polizei |
Palermo Shooting | 2008 | Wim Wenders | Campino | 12 | Palermo ; Musik ; Sinn | |
Pecker | Der Pecker | 1998 | John Waters | Edward Furlong | 12 | Amateur ; Galerie ; Kunstbetrieb ; Museum |
The Public Eye | Der Reporter | 1992 | Howard Franklin | Joe Pesci | 12 | Fotoreporter ; Polizei ; Weegee |
Rear Window | Das Fenster zum Hof | 1954 | Alfred Hitchcock | James Stewart | 12 | Fotoreporter |
Road to Perdition | 2002 | Sam Mendes | Tom Hanks | 16 | Comic ; Gangster ; Killer ; Oscar ; Polizeifotografie | |
| Sabrina Remake von Sabrina (Billy Wilder, 1954) | 1995 | Sydney Pollack | Julia Ormond | 6 | Komödie ; Modefotografie ; Vogue | |
| The Secret Life of Walter Mitty Remake von The Secret Life of Walter Mitty/Das Doppelleben des Herrn Mitty (Norman Z. McLeod, 1947) | Das erstaunliche Leben des Walter Mitty | 2013 | Ben Stiller | Ben Stiller | 6 | Fotoarchiv ; Liebe ; Life Magazine ; Komödie |
Smoke | Smoke – Raucher unter sich | 1995 | Wayne Wang | Harvey Keitel | 12 | Amateur ; New York ; seriell |
Spider-Man (Franchise) | ab 2002 | Sam Raimi | Tobey Maguire | 12 | Comic ; Freelancer ; Pressefotografie ; Marvel ; Superheld ; Zeitung | |
Triage | 2009 | Danis Tanovic | Colin Farrell | 16 | Kriegsfotografie ; Moral | |
Under Fire | Unter Feuer | 1983 | Roger Spottiswoode | Nick Nolte | 16 | Fotoreporter ; Nicaragua ; Politik |
We'll Take Manhattan | 2012 | John McKay | Aneurin Barnard, Karen Gillan | David Bailey ; Modefotografie ; Vogue | ||
The Year of Living Dangerously | Ein Jahr in der Hölle | 1982 | Peter Weir | Mel Gibson | 16 | Fotoreporter ; Indonesien ; Politik |
Splitgrade-Printing
Kopierverfahren für kontrastreiche Negative mit ⭬ kontrastvariablem Fotopapier zur optimalen Kontraststeuerung: Das Fotopapier wird additiv belichtet, einmal mit dem Gradationsfilter für die hellen Töne und ein zweites Mal mit dem Filter für die Schattenpartien.
Wähle den Filter für ⭬ Gradation 00.
Ermittle mittels ⭬ Probestreifen die Belichtungszeit für die dichtesten Partien des Nagativs, die eine gute Lichterzeichnung in der grünempfindlichen ›weichen‹ Schicht ergibt.
Belichte das Papier mit dieser Zeit und belasse es im ⭬ Vergrößerungsrahmen.
Wähle den Filter für ⭬ Gradation 5.
Belichte über die Erstbelichtung eine Testreihe für die Zweitbelichtung auf die blauempfindliche ›harte‹Schicht; beurteile die Schattenpartien.
Die richtige Belichtungszeit für die Zweitbelichtung ist die, bei der das dunkelste Schwarz erscheint.
Fertige den ersten Arbeitsprint mit den ermittelten Zeiten an.
Wenn der Kontrast insgesamt nicht passt, können auch andere Filterkombinationen verwendet werden, z. B. 0 Y/5 M, 2 Y/5 M, 2 Y/4 M …
Nachbelichten/
Abhalten nach Geschmack
alternatives Vorgehen: ↱ Anleitung von Ilford [2024-07-27] (Dr. Dave Butcher)
s. a. ⭬ kontrastvariables Fotopapier; ⭬ Kontrastfilter (für kontrastvariables Fotopapier)
Stain
Nebendichte aus Farbstoff; wird von ⭬ Entwicklern auf Basis Pyrogallol bzw. Brenzcatechin parallel zum Bildsilber erzeugt (gerbende Entwickler; z. B. ⭬ Tanol)
Lit.:
[Moersch, Wolfgang]: Tanol & Co ; Über die Eigenschaften »stainender Entwickler«. o. D. Online: ↱ moersch-photochemie.de/wp-content/uploads/2023/02/TanolundCo.pdf [2024-01-23]
Standentwicklung
Entwicklungsmethode für Fotoplatten aus dem späten 19. Jahrhundert (Frederick Wratten/
Besser funktioniert die Semi-Standentwicklung; hier eine Rezeptur von Andrew Sanderson via Ilford (↱ ilfordphoto.ca/uprating-hp5-semi-stand-development/ [2024-07-27]):
verdünne ⭬ Ilford ID-11 1+3 @ 20 °C
30 s kontinuierlich kippen
während der nächsten 10 Minuten: alle 30 s dreimal kippen
stehen lassen für 50 Minuten
während der letzten 10 Minuten: minütlich dreimal kippen
Wer sich für ungewöhnliche Entwicklungszeiten interessiert, sollte sich mit den Texten von William Mortensen (1897–1965) beschäftigen (guter Start: Buffaloe, Mortensen Revisited).
Lit.:
Buffaloe, Ed: Mortensen Revisited ; An Analysis of Mortensen’s 7-Derivative Technique. o. D. Online: ↱ unblinkingeye.com/Articles/Mortensen/mortensen.html [2022-12-16]
»Development, Stand« in: Cassell’s cyclopædia of photography. Hg. Bernard E. Jones. London, New York usw.: Cassell and Co., 1911. S. 175 f.
↱ Online via Internet Archive [2024-07-27]
engl.: stand development
Stativgewinde
Buchse mit Schraubgewinde am Boden von Kameras und an Halterungen langer Objektive zur Montage auf einem Stativ; in unserem Kontext sind zwei Größen üblich:
-
leichtere Kameras:
¼″, 20 Gang (amerik. UNC, coarse)
⌀ außen: 6,35 mm; ⌀ Kernloch: 5,35 mm; Steigung 1,27 mm -
schwere Kameras und Stativköpfe:
⅜″; 16 Gang (auch amerik. UNC, coarse)
⌀ außen: 9,52 mm; ⌀ Kernloch: 8,25 mm; Steigung 1,5875 mm
Früher™ wurden Gewinde nach dem britischen Standard (BSW) genutzt, die man bei älteren Geräten gelegentlich antrifft. Beide Standards unterscheiden sich nur geringfügig durch den Flankenwinkel (BSW: 55°; UNC: 60°) – Durchmesser und Steigung sind gleich. Das passt also, wenns sein muss.
Für die Montage von Kameras mit ⅜″-Gewinde auf Stative mit ¼″-Anschluss gibt es Adapter zum Einschrauben in das Kameragewinde; man sollte jedoch darauf achten, diese nicht zu sehr zu belasten.
Lit.:
ISO 1222:2010, Photography – Tripod connections. Ed. 4. 2010. Online verfügbar: ↱ iso.org/standard/55918.html [2024-05-26]
engl.: tripod socket
Stereo-Bildpaar
Zwei per ⭬ Stereofotografie angefertigte Aufnahmen, je ein Bild für das linke und das rechte Auge. Das S. wird auf-, neben- oder übereinander angeordnet zur Betrachtung mit einem ⭬ Stereoskop.
engl.: stereoscopic pair of images
Stereofotografie, Raumbild-Fotografie, Stereoskopie
Es werden zwei Aufnahmen simultan anfertigt (ein ⭬ Stereo-Bildpaar), wobei die Objektive um etwa den Augenabstand (ca. 65 mm) versetzt sind.
engl.: stereo photography

Zwei kombinierte Kleinbildkameras zur Aufnahme eines ⭬ Stereo-Bildpaars.
Stereoskop
Vorrichtung zum Betrachten von ⭬ Stereo-Bildpaaren, die jedem Auge nur das entsprechende Bild zeigt; so entsteht ein räumlicher Bildeindruck. Je nach Verfahren: (Linsen-)
engl.: stereoscope
s. a. ⭬ Anaglyphenbild; ⭬ Stereo-Bildpaar; ⭬ Stereofotografie
Streulichtblende, Gegenlichtblende
engl.: lens hood, lens shade
Strichbild
Aufgerastertes Bild, das nur noch aus opaken Rasterpunkten besteht; bei Betrachtung aus genügender Entfernung ›verschwimmen‹ die Rasterpunkte zu einem quasi kontinuierlichen Halbtonbild.
engl.: halftone (⚠: Fauxami)
s. a. ⭬ Raster; ⭬ Strichfilm
Strichfilm, Linefilm, Lithfilm, Hard-Dot-Film
⭬ Technischer Film, dessen fotogr. ⭬ Schicht sehr kontrastreich abbildet (steile ⭬ Gradation, kaum oder keine Graustufen). S. werden z. B. zur Reproduktion von Zeichnungen, zur Herstellung von Vortragsdias oder zu graphischen Zwecken (»Strichumsetzung«) verwendet. Während man mit Linefilmen noch ein paar Graustufen abbilden kann, bilden Lithfilme nur binär ab, d. h., transparent oder opak. Lithfilme werden zum Herstellen von ⭬ Strichbildern (Aufrastern; Druckvorstufe) verwendet, damit der einzelne Rasterpunkt scharf umrandet und einheitlich deckend wird.
S. sind sehr feinkörnig, hochauflösend, geringempfindlich und erreichen hohe Dichten. Die Eigenschaften können variiert werden durch die Zusammensetzung des ⭬ Entwicklers.

Kodalith ortho (hist.) eignet sich z. B. zur Reproduktion von Strichvorlagen oder zur Herstellung von Masken; bei angepasster Entwicklung erscheinen aber durchaus auch ⭬ Halbtöne.
s. a. ⭬ Strichbild; ⭬ Raster; ⭬ Dokumentenfilm
Sunny-16-Regel
Faustregel zur Schätzung der Belichtungsparameter wenn kein ⭬ Belichtungsmesser vorhanden ist: Stelle bei direkter Sonnenbeleuchtung die Blende auf f/16 und nutze ca. [1/Filmempfindlichkeit in ISO] als Belichtungszeit. Das funktioniert wenn die Sonne hoch steht (exakt bei einer Lichtintensität von 50.000 lx); nutzt man Negativfilm, ist es meist besser, f/11 oder sogar f/8 zu wählen.
Weitere Sprüche, die allerdings nicht so akkurate Bildergebnisse liefern:
- Sonne lacht: Blende 8.
bzw. Die Sonne scheint, der Himmel lacht, a Hundertstel und Blende Acht
Der Klassiker, entspricht der Sunny-16-Regel; stammt allerdings aus einer Zeit, als die meisten Filme noch deutlich weniger empfindlich waren als heutzutage.
Bl. 8, ¹⁄₁₀₀ funktioniert für Außenaufnahmen aber noch immer, da Negativfilme Überbelichtungen gut verkraften. So sind ja auch die ⭬ Wegwerfkameras eingestellt. - f/8 and be there (wird Arthur ›Weegee‹ Fellig zugeschrieben)
- Blende vier im Zimmer stimmt immer.
- Fast schon Nacht, Blende 2.8.
- Scheint keine Sonne durch die Ritzen – musst du blitzen.
Vorlage für eine DIY-Belichtungsscheibe, die das Anwenden der Sunny-16-Regel vereinfacht und auch für die Arbeit mit ⭬ Lochkameras nutzbar macht: ↱ harmantechnology.com/amfile/file/download/file/1924/product/591/ [2024-07-27]
engl.: sunny 16 rule
s. a. ⭬ ULC
Super 8
Super 16
s. a. ⭬ Hi 16
superpanchromatisch (lat. super: über; griech. πᾶν: alles)
⭬ panchromatische Schicht mit höherer Rotempfindlichkeit (bis 740 nm beim Ilford SFX 200). Mit entsprechenden Rotfiltern (⭬ Farbfilter) kann man mit diesen Schichten ⭬ IR-Fotografie simulieren.
z. B. Ilford SFX 200 (↱ Datenblatt); Rollei Superpan 200 (↱ Datenblatt)
s. a. ⭬ orthochromatisch; ⭬ panchromatisch; ⭬ orthopanchromatisch
Superslide
T
T-Kristall-Film, T-Grain-Film, Tabular-Grain-Film (Kodak)
Kodaks Typ-Bezeichnung für deren ⭬ Flachkristallfilme (Farbfilme sowie T-MAX 100, T-MAX 400, T-MAX P3200).
T-Zahl
Angabe der Blendenzahl bei Kine-Objektiven; keine errechnete Zahl. Die T-Zahl beschreibt stattdessen die tatsächliche Lichtdurchlässigkeit, die immer kleiner ist als der errechnete Blendenwert.
Das ist wichtig beim Wechseln der Objektive während einer Szene, damit keine Lichtsprünge auftreten.
engl.: t-stop
s. a. ⭬ Blende
Tageslicht
engl.: daylight
Tageslichtentwicklungsdose
🗎 Anleitung für die Filmentwicklung mit der T. von Kaiser
engl.: daylight film developing tank
Tageslichtfilm
Film, dessen fotogr. ⭬ Schicht spektral so sensibilisiert ist (⭬ Sensibilisierung), dass Motive ohne Filterung bei einem Aufnahmelicht mit einer ⭬ Farbtemperatur von 5500 K farbrichtig wiedergegeben werden.
Um bei anderen Farbtemperaturen farbrichtige Abbildungen zu erhalten, müssen Farbkonversions-, Farbkorrektur- oder Farbausgleichsfilter (⭬ Farbfilter) verwendet werden.
Alle Filme, die neu für die Stehbildfotografie hergestellt werden, sind Tageslichtfilme.
s. a. ⭬ Farbtemperatur; ⭬ Farbfilter; ⭬ Sensibilisierung; ⭬ Kunstlichtfilm
engl.: daylight film
Tankentwicklung
s. a. ⭬ Schalenentwicklung
engl.: tank development
Tanol (Moersch)
⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm; ⭬ Stain-bildend
Lit.:
[Moersch, Wolfgang]: Tanol & Co ; Über die Eigenschaften »stainender Entwickler«. o. D. Online: ↱ moersch-photochemie.de/wp-content/uploads/2023/02/TanolundCo.pdf [2024-01-23]
Technische Filme
s. a. ⭬ Strichfilm
Temperatur
T. misst makroskopisch die im System enthaltene Energie. Die T. beeinflusst sowohl physikalische als auch chemische Prozesse.
In unserem Kontext ist es vor allem bei der Filmentwicklung wichtig, die genaue Temperatur zu kennen. Die Datenblätter geben die Entwicklungszeiten üblicherweise für 20 °C an, bei höheren Temperaturen sind die Zeiten deutlich zu verkürzen.
Die drei verbreitetsten Maße für die T. sind K (Kelvin), °C (Grad Celsius) und °F (Grad Fahrenheit).
Teststreifen
Testtafel
Vorlage zum Abfotografieren, um bestimmte Eigenschaften des abbildenden Systems zu prüfen; Motiv je nach Prüfaufgabe.
Anbieter (Auswahl):
↱ Applied Image [2024-07-27]
↱ Image Engineering [2024-07-27]
Beispiele:

Testnegativ zur Justierung des ⭬ Vergößerungsgeräts (Hama)
s. a. ⭬ USAF-Chart; ⭬ Farbkontrollkarte; ⭬ IT 8-Target; ⭬ Siemensstern
Texoprintverfahren
Tiefenschärfe
TMX, 100 Tmax (Kodak)
TMY, 400 Tmax (Kodak)
TMZ, p3200 Tmax (Kodak)
TRI-X (Kodak)
Schwarzweißfilm – ein Klassiker | |
|---|---|
Hersteller | Kodak |
Produktname | TRI-X |
Kürzel | 400TX (⭬ Rollfilme) und |
Kennung am Filmrand | |
Typ | Schwarzweiß-Negativfilm |
Kristallstruktur | klassisch/ |
400/27° bzw. 320/26° | |
Rollfilme: Celluloseacetat | |
vorgesehener Entwicklungsprozess | |
Datenblatt | Kodak Professional TRI-X 320 and 400 Films. Feb. 2016. Firmenschrift Kodak alaris F-4017. Online: ↱ business.kodakmoments.com/sites/default/files/files/resources/f4017_TriX.pdf [2024-07-27] |
Bildbeispiele | |
sonstiges | auch als ⭬ 8- und ⭬ 16 mm-Kinefilm-Umkehrmaterial: |
2025 in Produktion | |
vergleichbares Material | |
Tonung und Färbung (Virage)
-
Färben (Viragieren; v. a. im Stummfilm): Die Gelatine und das Papier werden eingefärbt (das ist in den Schatten kaum sichtbar); für ›warme‹ Brauntöne kann mit Tee (oder Kaffee) gefärbt werden – wie das beispielsweise Tom Baril gemacht hat (Botanica, 1999).
Werden ⭬ Cyanotypien in Tee gebadet, verschiebt das den blauen Bildton in Richtung Schwarz.
-
Tonen: Das Bildsilber wird entweder durch farbige Metalle ersetzt, oder es werden farbige Metallverbindungen am Silber angelagert. Tonen ist in den Lichtern kaum sichtbar, da dort wenig Silber vorhanden ist. Getonte Abzüge sind besonders haltbar, da die Silberverbindungen durch Umwelteinflüsse kaum verändert werden.
direkt
Das fertig fixierte Bild wird in einem Bad getont, drei Methoden:
Das Bildsilber wird in Silberselenid (Ag₂Se) umgewandelt, z. B. Selentonung.
Eine anorganische Verbindung wird an das Bildsilber gebunden, z. B. Goldtonung (↱ Bildbeispiele von Wolfgang Moersch [2024-07-27]).
Das Bildsilber wird durch ein anderes Metall ersetzt, z. B. Kupfer- oder Eisentonung.
indirekt
Das Bild wird gebleicht (⭬ Bleichen) und anschließend neu aufgebaut, indem das Bildsilber in eine andersfarbige Silberverbindung umgewandelt wird – bei der Sepia-Tonung beispielsweise in Silbersulfid.
Tonungen können kombiniert werden (dazwischen gut wässern), beispielsweise ergibt die kombinierte Schwefel-/
Goldtonung einen Rötelton.
Lit.:
Anchell (2016), S. 113 ff. [⭬ Literatur]
Rudman, Tim: Toning: Workflow, Pitfalls, Choices and Preferences. In: Anchell (2016), S. 122 f. [⭬ Literatur]
»Toning«, in: Encyclopedia of Practical Photography, Bd. 6, Garden City (NY): 1978, S. 2456 – 2468
engl.: toning; tinting (für Virage); staining
Toy Camera
Sammelbezeichnung für einfachst ausgestattete Kameras, die dadurch besondere Bildergebnisse liefern. Trotz der eher despektierlichen Benennung kann mit diesen Kameras durchaus ernsthaft gearbeitet werden.
Typische Kennzeichen von T. sind:
nur ein oder zwei Blendeneinstellungen; häufig ca. f/11
Kunststoffgehäuse, häufig nicht zuverlässig lichtdicht
einfache ⭬ Verschlusskonstruktion; meist ohne Doppelbelichtungssperre; häufig nur eine fixe Verschlusszeit von ca. ¹⁄₅₀ s oder ¹⁄₁₀₀ s
einfache Objektivkonstruktion aus Kunststofflinsen; häufig nur eine ⭬ Meniskuslinse; oft nur Fixfokus-Einstellung; oft vignettierend
Klassische Vertreter dieser Kameragattung:
Diana
Lomo Fisheye und so manche andere Lomo-Kamera, nicht jedoch die LC-A (Lomo Kompact Automat)
Lubitel
Ich zähle auch folgende Kameras zu dieser Gattung:
⭬ Boxkameras, z. B. ⭬ Box 44 (Agfa) oder eine der ⭬ Brownies (Kodak)
Arbeiten von mir, die mit T. entstanden sind:
「Verblassende Erinnerung」 (2012)
「Mauergedenken」 (2007)
Lit.:
Bates, Michelle: Plastic Cameras ; Toying with Creativity. 2. Aufl. Burlington (MA, USA), Oxford (UK): Focal Press (Elsevier), 2011. ISBN 978-0-240-81421-6
Frech, Martin: »Toy camera: Debonair (Diana-Klon)«. In: Notizen zur Fotografie. 15. Juli 2009. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2009-07-15/Toy-camera_Debonair.html [2022-06-09]
Gustavson, Todd: »Toy Cameras«. In: Gustavson (2009, S. 162 ff.) [⭬ Literatur]
s. a. ⭬ Boxkamera; ⭬ Lomografie; ⭬ Low-fi Fotografie; ⭬ Wegwerfkamera
Träger, Filmträger
engl.: film base
Trennbildfilm (hist.)
Variante eines ⭬ Sofortbildfilms, bei dem Negativ und Positiv nach der Entwicklung getrennt werden. Das Negativ wurde zwar meist verworfen, kann aber bei manchen T. durchaus geklärt und separat verwendet werden (reclaiming the negative).
s. a. ⭬ Integralfilm
engl.: peel-apart film
Trichromie
engl.: trichromy
Trockenpresse
engl.: drying press
Tropen, fotogr. Material in den
Tropenklima unterscheidet sich vom Klima in den gemäßigten Klimazonen vor allem durch eine höhere Temperatur und eine größere Luftfeuchtigkeit; für Filmmaterial kann Letzteres problematisch sein (verkleben der Filme, Schäden an der Gelatine durch Pilze und Bakterien).
Eine kompakte Behandlung des Themas findet sich in der angegebenen Literatur.
›Früher‹, in Zeiten vor dem Klimatisierungswahn, gab es Rezepturen für sog. Tropenentwickler (z. B. Kodak DK-15) zur Verwendung bei Badtemperaturen von deutlich über 24 °C bzw. die Empfehlung, dem Entwickler ein Anti-Schleiermittel sowie Natriumsulfat (Na₂SO₄; härtet die Emulsion) zuzusetzen bzw. die Emulsion vorzuhärten (⭬ Härtebad).
Lit.:
Agfa: Photographieren in den Tropen. Leverkusen: Firmenschrift Agfa-Gevaert. o. D.
- Sieg, Paul: Fotografie in den Tropen. Berlin: Union, 1934. Online: ↱ https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/497625/1 [2025-05-22]
Spörl, Hans: Fotografisches Rezeptbuch. 14. – 16. Aufl., vollst. neu bearb. von Hanns Neumann. Düsseldorf: Wilhelm Knapp, 1951. S. 59 f.
»Tropical Development«. In: Eastman Professional Films. Kodak-Firmenschrift. 1936. S. 17–19
»Tropical Photography«, in: Encyclopedia of Practical Photography, Bd. 14, Garden City (NY): 1978, S. 2483 ff
engl.: photographic material in the tropics
U
überlagerter Film
Auf die Verpackung von Filmen ist ein Datum aufgedruckt, bis zu dem der Hersteller bei sachgemäßer Lagerung die zugesagte Qualität garantiert.
Mit zunehmendem Alter verändern sich Eigenschaften des Materials: u. a. wird die Empfindlichkeit geringer und der Grundschleier nimmt zu. Da die Effekte bei Farbfilmen in den einzelnen Farbschichten unterschiedlich auftreten können, ergeben sich möglicherweise nicht ausfilterbare Farbverschiebungen.
Wenns drauf ankommt, besser frischen Film nehmen.
Niederempfindliche Filme altern besser als hochempfindliche; Schwarzweißfilme besser als Farbfilme. Wurde der Film seit der Produktion kühl – oder besser: gefroren – gelagert, passiert nicht viel; lag er jahrzehntelang in Schubladen, werden die Bilder wohl nicht mehr frisch aussehen (⚠: ⭬ Sofortbild-Material nie einfrieren!). Wie sich die Emulsion verhält, ist jedoch nicht vorhersehbar – das macht ja auch den Reiz aus für ⭬ ›Lomographen‹, überlagerte Filme zu verwenden.
Das Belichten wenig überlagerter Filme ist i. d. R. unkritisch: Ist der Film noch nicht lange ›abgelaufen‹ (< 10 Jahre), belichten Sie mit ⭬ Nennempfindlichkeit; ist der Film deutlich älter, gibt es die Faustregel, die ISO-Zahl pro Dekade zu halbieren. Entwickelt wird normal nach Standard. (Grundsätzlich schadet es auch frischem Negativfilm nicht, reichlicher belichtet zu werden.)
Aber prüfen Sie bei sehr alten Farbnegativfilmen, ob der Film im ⭬ C-41/
Kommerzielles Fotolabor, das auf die Verarbeitung historischer Materialien spezialisiert ist: Film Rescue International™ (↱ filmrescue.com [2024-07-27]).
Lit.:
Frech, Martin: »Kodak Kodacolor VR, abgelaufen 07/1988 vs. Kodak Portra 160.« In: Notizen zur Fotografie. 30. Juni 2017. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2017-06-30/Kodak-Kodacolor_VR_abgelaufen-07-1988_vs_Kodak-Portra-160.html [2023-07-29]
Frech, Martin: »Anmerkungen zu Mike Crawfords Projekt ›Obsolete and Discontinued‹«. In: Notizen zur Fotografie. 5. Feb. 2017. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2017-02-05/Obsolete-and-Discontinued.html [2023-07-29]
Kodak Color Films: The Differences Between Professional Films and Films for General Picture-Taking. Firmenschrift Kodak E-6. Dez. 2002. Online: ↱ 125px.com/docs/techpubs/kodak/e6-2002_12.pdf [2023-07-29]
Storage and Care of Kodak Photographic Materials Before and After Processing. Firmenschrift Kodak CIS-2017-1. Feb. 2017. Online: ↱ 125px.com/docs/techpubs/kodak/cis_e30-2017.pdf [2023-07-29]
Ultra Large Format (ULF)
⭬ Planfilm-Formate größer als 8 × 10 ″; sind standardmäßig bei den einschlägigen Anbietern nicht lieferbar; manche Hersteller konfektionieren diese jedoch für Sammelbestellungen (Ilford: ↱ ilfordphoto.com/ulf [2024-07-27]; Kodak via Canham: ↱ canhamcameras.com/kodakfilm.html [2024-07-27])
Umentwicklung
Ist ein Negativ nach der Entwicklung zu dicht oder zu dünn, kann es nach einem ⭬ Bleichbad und Nachbelichten noch einmal entwickelt werden. Zuvor zu dichte Negative werden in einem weich arbeitenden ⭬ Entwickler nach Sicht erneut bis zur gewünschten Schwärzung rückentwickelt. Zuvor zu dünne Negative werden nach dem Bleichen unter Zugabe von Silbernitrat ebenfalls nach Sicht zweit-/
Umkehrentwicklung
Schwarzweiß-Fotopapier
ähnlich wie in klassischen ⭬ Fotoautomaten
belichten; ⭬ EI austesten (ca. 2–6)
Entwickeln, idealerweise in einem weich arbeitenden ⭬ Entwickler; ergibt ein Papiernegativ.
Entwicklung stoppen (⭬ Unterbrecherbad)
zwischenwässern, nicht fixieren!
⭬ Bleichen
Bitte kein Kaliumdichromat ⚠ (K₂Cr₂O₇) nutzen. Wasserstoffperoxid (H₂O₂, ca. 20 %; blöd nur, dass man so ohne weiteres nur 12 %iges bekommt)/Zitronensäure (C₆H₈O₇) oder Kaliumpermanganat (KMnO₄)/ Schwefelsäure (H₂SO₄) funktionieren auch gut.
⚠: Gesichtsschutz/Schutzhandschuhe/ Laborkittel nutzen Klärbad (Natriumsulfit, Na₂SO₃)
zwischenwässern
Zweitbelichtung
nochmals entwickeln
zwischenwässern
⭬ Fixieren ist eigentlich nicht nötig, da kein lichtempfindliches Silbersalz mehr vorhanden sein sollte; schadet aber auch nicht.
Schlusswässserung
Das Ergebnis ist ein seitenverkehrtes Positiv.
RA-4-Papier
- E.I.-Startwert: ISO 3 (ohne Korrektur für Filter)
- Basisfilterung für Tageslicht:
85/85B-Filter (⭬ Farbfilter | Farbkonversionsfilter und Farbkorrekturfilter)
(evtl. zusätzlich ⭬ UV- und IR-Sperrfilter) - plus Filterung zum Ausgleich der fehlenden orangen Maskierung des Farbnegativfilms (mit Farbausgleichsfilter(n) (⭬ Farbfilter | Farbausgleichsfilter)).
- plus Grundfilterung des Fotopapiers (mit Farbausgleichsfilter(n) (⭬ Farbfilter | Farbausgleichsfilter)).
- im Dunkeln: Erstentwicklung mit Positiv-Schwarzweißentwickler in Standard-Verdünnung 1 bis 3 min.; anschließend Stopbad
- etwa 1 min. Zweitbelichtung (im Wasserbad) mit diffusem weißem Licht
(Dieses Farbpositiv wird quasi maskiert durch das erst-entwickelte Schwarzweiß-Negativ.) - Entwicklung im ⭬ RA-4-Prozess; kann auch bei Raumtemperatur erfolgen, dann Filterung anpassen
Farbnegativfilm
Erstentwicklung mit einem Schwarzweißentwickler
Zweitbelichtung
Schwarzweißnegativfilm
ausführlich in Frech (2007).
Lit.:
Anchell (2016), S. 143 ff. [⭬ Literatur]
Frech, Martin: »Der Weg zum Schwarzweiß-Dia«. In: Notizen zur Fotografie. 24. März 2007. Online: ↱ nzf.medienfrech.de/NzF/2007-03-24/Schwarzweiss-Dia.html [2022-08-07]
Universal Light Code (ULC)
System von Jim Lehman zur Ermittlung der richtigen Belichtungsparameter für ein gegebenes Motiv ohne ⭬ Belichtungsmesser: Den Buchstaben A bis Z sind Szenen in definierten Lichtsituationen zugeordnet, z. B. ›City skyline: just after sunset (G)‹, ›Christmas tree: inside bright room (I)‹ oder ›Fog: with dim lights at night (R)‹; (B) entspricht der Belichtung nach der ⭬ Sunny-16-Regel, zwischen jeder Kategorie ist ein Beleuchtungsunterschied von einer Blende. Dazu gibt es eine Einstellscheibe auf der der zur fotografierenden Szene passende Buchstabe und die Filmempfindlichkeit kombiniert werden, um die Zeit-Blenden-Kombination für eine korrekte Belichtung zu ermitteln (der ⭬ Schwarzschildeffekt ist berücksichtigt).
ULC-faq: ↱ sites.google.com/view/black-cat-photo-products/ulc-faq [2023-12-02]
Unschärfe
engl.: blur
Unterbrecherbad, Stoppbad
Entwicklungsstoppendes Zwischenbad (ca. 30 s) im ⭬ Entwicklungsprozess fotogr. ⭬ Schichten; sorgt für Prozess-Sicherheit indem es die Entwicklung sofort stoppt und saure ⭬ Fixierbäder vor Neutralisierung schützt. Daher den pH-Wert regelmäßig mit Indikatorpapier prüfen, wenn es alkalisch wird, das Bad ersetzen.
| Unterbrecherbad (Agfa-Rezeptur 200) | |
|---|---|
| Menge | Substanz |
| 20 ml | Eisessig (C₂H₄O₂) mit Wasser auffüllen auf 1 l |
| Alternative: | |
| 40 g | Kaliumdisulfit (K₂S₂O₅; E 224) in 1 l Wasser lösen |
Alternativ nutzt man ein konfektioniertes U. mit zugesetztem Indikator, der durch Farbumschlag auf ein erschöpftes U. hinweist (z. B. Adostop, Fomacitro, Ilfostop, Indicet).
Bei Verwendung ⭬ Stain-bildender Entwickler muss Wasser statt eines U. verwendet werden
Troop/
engl.: stop bath
USAF-Chart, USAF 1951 3-Bar Resolving Power Test Chart
⭬ Testtafel mit verschieden großen horizontalen und vertikalen Linienblöcken; dient zur gleichzeitigen horizontalen und vertikalen Auflösungsprüfung bei definierten Linienpaaren pro mm.
s. a. ⭬ Testtafel
UV-Filter (≠ ⭬ UV-Sperrfilter)
Filter für ⭬ UV-Fotografie; sperrt Licht ab ca. 400 nm: opak für sichtbares Licht
engl.: UV filter
UV-Sperrfilter, Dunst-Filter
Filter, der Licht bis ca. 400 nm sperrt.
Die üblichen fotogr. ⭬ Schichten sind für UV-Licht empfindlich, die Objektive jedoch nur für sichtbares Licht korrigiert. Theoretisch könnte ein hoher UV-Anteil im Licht daher zu unerwünschten Nebendichten führen und zu Unschärfen durch chromatische Aberrationen des UV-Lichtanteils. Ob das in der Praxis eine Rolle spielt, hängt von der Zusammensetzung des vorhandenen Lichts, dem Objektiv und dem Filmmaterial ab. Meist bestehen Objektive aus mehreren Linsen, die schon einiges UV blockieren (darauf sollte man sich jedoch nicht verlassen). Viele Filme sind zudem mit einer UV-Sperrschicht ausgestattet (Info-Material der Hersteller konsultieren). Agfa schrieb beispielsweise 2003: »Bei allen Agfa Professional-Farbfilmen ist dies [die Verwendung eines UV-Sperrfilters] nicht erforderlich, weil eine UV-Sperrschicht bereits in der Emulsionsschicht eingelagert ist.« (Technische Daten Agfa Professional Filmsortiment. Technisches Datenblatt F-PF-D4. 4. Aufl. Agfa, 07/2003.)
Dunst (Trübung der Atmosphäre) streut kurzwelliges Licht besser als langwelliges. Daher wirkt ein UV-Sperrfilter bei Dunst und hohem UV-Anteil kontraststeigernd; die Wirkung ist allerdings subtil, da ja das sichtbare blaue Licht weiterhin durchkommt.
s. a. ⭬ Farbfilter; ⭬ Skylightfilter
engl.: UV filter, haze filter
UV-Fotografie, Ultraviolettfotografie
engl.: ultraviolet photography
Lit.:
Spitzing, Günter: Moderne Infrarot- und UV-Fotografie. 3. Aufl. Augsburg: Augustus, 1992
V
Variobrom WA (Tetenal; hist.)
proprietärer ⭬ Entwickler für ⭬ Silbergelatine-Fotopapier; ruft einen ⭬ warmen Bildton hervor.
enthält ⭬ Hydrochinon ⚠
Veganismus und Fotografie
⭬ Gelatine ist ein nicht-ersetzbarer Bestandteil von Filmen und ›modernen‹ ⭬ Fotopapieren. V. und Fotografie vertragen sich dennoch, da es einige fotografische Prozesse gibt, deren Material ohne Gelatine auskommt: ⭬ Cyanotypie (solange der Träger vegan beschichtet wird), Daguerreotypie, Kalotypie, ⭬ Kollodium-Nassplatten-Prozess u. a. sowie einige der ⭬ Edeldruckverfahren.
Auch Kleber enthalten oft tierliche Inhaltsstoffe, wenn sie auf Glutin oder Kasein basieren. Alternativen auf Stärke- oder Erdölbasis sind jedoch einfach zu finden.
Pinsel sind wegen der Verwendung von Tierhaaren oft nicht vegan; solche aus synthetischen Materialien sind jedoch einfach zu bekommen.
btw: Die Verpackungen von ›offiziell‹ als vegan gelabelten Produkten können dennoch tierliche Bestandteile enthalten (siehe ↱ v-label.com/de/faqs/ [2024-07-27]).
engl.: veganism
Verdünnung und Mischung
Bei der Angabe von Verhältnissen, beispielsweise 1∶31, wird zwischen Verdünnen und Mischen unterschieden:
Eine Verdünnung von 1∶31 (Konzentrat zu Wasser) bedeutet, die Konzentration in der Arbeitslösung auf ¹⁄₃₁ zu bringen: Die End-Menge beträgt das 31-fache der Ausgangsmenge.
Bei einer Mischung dagegen werden die Verhältnisse der Komponenten untereinander angegeben, 1∶31 heißt also, dass es 1+31 = 32 End-Anteile gibt.
In unserem Kontext wird in dieser Hinsicht oft schlampig formuliert und die Angabe ›verdünne 1∶3‹ auch ’mal als Mischung 1+3 interpretiert.
Eigentlich ist das ja auch egal, solange man mit den Bildergebnissen zufrieden ist; Ausprobieren hilft.
Erste Anlaufstelle bei Unklarheiten ist das jeweilige Datenblatt des Herstellers:
Kodak führt beispielsweise im Datenblatt zu HC-110 in der Tabelle für die Verdünnungen aus, dass 1∶31 das Ratio of Concentrate to Water ist und gibt passende Zahlenbeispiele an. (Firmenschrift Kodak J-24 vom Dez. 2017)
Würden Sie die Angabe 1∶31 dagegen als Mischungsverhältnis auffassen, würden Sie z. B. für 250 ml Endvolumen 250 ml ÷ 32 = 7,8 ml Konzentrat statt der vorgeschriebenen 8 ml verwenden – sehr wahrscheinlich, ohne einen Unterschied im Bildergebnis zu erkennen.
Agfa dagegen gibt für Rodinal die möglichen Verdünnungen (sic!) als 1+25 oder 1+50 an, schreibt aber im Beipackzettel zu Rodinal auch explizit: Ansatz: 1 Teil Konzentrat + 25 oder + 50 Teile Wasser …
Ilford wiederum schreibt in der Anleitung zu Ilfosol 3 (Juni 2019): Dilution 1+9 und gibt im Beispiel für 500 ml Endvolumen vor, 50 ml Entwicklerkonzentrat mit 450 ml zu mischen. Auch die Angabe für den Papierentwickler – MULTIGRADE can be used at a dilution of either 1+9 or 1+14 – rechnet sich leichter, wenn man sie als Mischungsvorschrift interpretiert. (Ilford Technical Information B & W Paper Developers, Juli 2010)
engl.: dilution
Vergrößerung, analoge (auch: ⭬ Print)
Die meisten Kamera-Aufnahmeformate sind klein – eine ⭬ Kontaktkopie ergäbe ein entsprechend kleines Bild. Daher werden Negative (seltener ⭬ Diapositive) während der Ausarbeitung zum Bild üblicherweise mit dem ⭬ Vergößerungsgerät vergrößert, indem sie auf das ⭬ Fotopapier projiziert werden.
engl.: photographic print
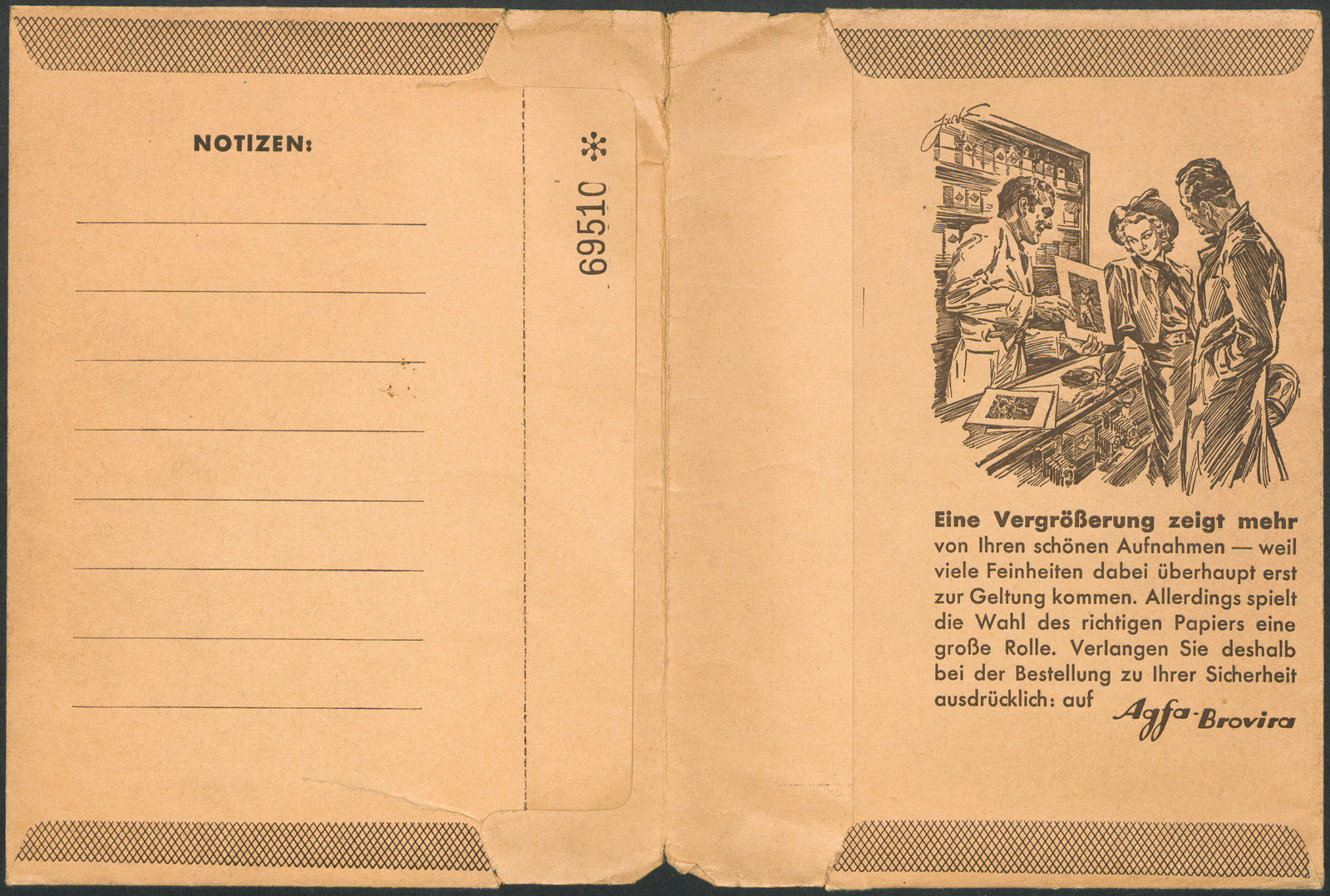
Auftragstasche eines ⭬ Fotolabors mit Werbung für Vergrößerungen auf Agfa Brovira ⭬ Fotopapier
Vergrößerungsgerät, Vergrößerer
engl.: enlarger
Vergrößerungsrahmen
Ein V. besteht aus einer stabilen Grundplatte mit einer Anlage für das ⭬ Fotopapier und einem Maskierungsrahmen, den man zum Einlegen des Fotopapiers hochklappen kann. Der V. liegt auf dem Grundbrett des ⭬ Vergrößerungsgeräts und hat zwei Funktionen:
Er hält das Fotopapier flach, da der umlaufende Maskierungsrahmen die Ränder des Papiers niederdrückt.
Die Position des V. auf dem Grundbrett und der Ausschnitt des Maskierungsrahmens definieren in Kombination mit dem Abstand des Vergrößererkopfs die Position und Größe des projizierten Bildes auf dem Fotopapier; variable V. ermöglichen ein Verstellen des Maskierungsrahmens, indem mind. die rechte und die untere Schiene verschiebbar sind.
engl.: (adjustable) easel; masking frame
Vericolor Slide Film, Print Film (Kodak; hist.)
Niederempfindlicher, unmaskierter ⭬ Kunstlicht-Farbnegativfilm zur Herstellung von ⭬ Kleinbild-Dias (⭬ Diapositiv) bzw. Overhadfolien von Negativen; Entwicklung im (alten) ⭬ C-41-Prozess
Lit.:
Kodak Vericolor Print und Slide Filme. Firmenschrift Kodak P-D 16. o. D.
Kodak Vericolor Slide Film. Firmenschrift Kodak E-24. Dez. 2002. Online: ↱ 125px.com/docs/film/kodak/e24-Vericolor.pdf [2022-10-22]
Verlängerungsfaktor (Belichtungszeit)
Faktor für die Korrektur der gemessenen Belichtungszeit oder Blende, beispielsweise zur Kompensation für Lichtverluste durch den ⭬ Schwarzschildeffekt, weil ein ⭬ Filter verwendet wird oder wegen der Auszugsverlängerung bei Nahaufnahmen (⭬ Balgengerät, ⭬ Zwischenring).
vernakulare Fotografie
Unscharfer Begriff, meist für von Amateuren im Alltag produzierte Fotografie (›Schnappschüsse‹) – gelegentlich erweitert auf das weite Feld der nicht-künstlerischen Gebrauchsfotografie –, deren Kontext verloren ging; die Bildautorinnen/
Problematisch erscheint mir die Musealisierung dieser Bilder, da diese Dekontextualisierung eher die Überheblichkeit der Museumsleute offenbart, denn fotohistorisch aufklärt.
Lit.:
Batchen, Geoffrey: »Vernakulare Formen der Fotografie, 2000«. Übers. Wilhelm v. Werthern. In: Theorie der Fotografie V ; 1995–2022. Hg. Peter Geimer. München: Schirmer/
Mosel, 2023. ISBN 978-3-8296-0925-8. S. 210–221 Imagining Everyday Life ; Engagements of Vernacular Photography ; The Walther Collection. Göttingen, Steidl, 2020. ISBN 978-3-95829627-5
Zuromskis, Catherine: »Ordinary Pictures and Accidental Masterpieces ; Snapshot Photography in the Modern Art Museum«. In: Art Journal, 67 (2) 2008, S. 104–125. Online: ↱ doi.org/10.1080/00043249.2008.10791307 [2024-10-03]
engl.: vernacular photography
Visitformat
Verschluss
Vorrichtung zur zeitlichen Regelung der Lichtmenge bei der Belichtung: Der V. steuert die Belichtungszeit, also die Dauer, für die die fotogr. ⭬ Schicht dem Licht ausgesetzt wird.
Varianten:
Verschlusskappe/
Hut
s. a. ⭬ Drahtauslöser
engl.: shutter
Verstärken von Negativen
Wird ein Negativfilm zu kurz entwickelt oder in einem zu hoch verdünnten Entwickler, entsteht ein ›dünnes‹ Negativ mit zu geringen Dichteunterschieden zwischen den Schatten- und den Lichterpartien. Wenn beim Kopieren/
Eine simple Methode ist, das Negativ in wenig verdünntem Selentoner zu behandeln; üblich sind die Verdünnungen 1 : 1 bis 1 : 5. Die Gradation wird aber nur etwa eine Stufe steiler.
⚠: Wurde der Film ›⭬ stainend‹ entwickelt (z. B. in ⭬ Tanol oder Pyro), kann der Selentoner den Stain entfernen, das wäre kontraproduktiv. In diesem Fall nutzt man eine Sepiatonung (⭬ Tonung) zur Kontraststeigerung: Silber ausbleichen (ca. 1 h in einer 10 %-Lösung aus Rotem Blutlaugensalz (Kaliumferrizyanid), der Stain bleibt), gründlich wässern und rückentwickeln in einem Sepiatoner (Thioharnstoff/
Wunder sollte man jedoch keine erwarten; das Negativ digitalisieren und digital ausarbeiten ist wohl der bessere Weg, wenn es um die Sicherung der Bildinformation geht (⭬ Hybrider Workflow).
Lit.:
Anchell (2016), S. 127 ff. [⭬ Literatur]
engl.: intensifying negatives
View-Master
⭬ Stereoskop für Stereo-⭬ Diapositive
s. a. ⭬ Stereoskop; ⭬ Diabetrachter
Vintage-Print
Begriff aus dem Kunsthandel: ⭬ Vergrößerung/
Aber:
»Von der photographischen Platte z. B. ist eine Vielheit von Abzügen möglich; die Frage nach dem echten Abzug hat keinen Sinn.« (Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Edition Suhrkamp. Bd. 28. 16. Aufl. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1988, S. 17 – 18)
Aber:
»The vintage print is specified as one made “close to the aesthetic moment” – and thus an object made not only by the photographer himself, but produced, as well, contemporaneously with the taking of the image. This is of course a mechanical view of authorship – …« (Krauss, Rosalind: The Originality of the Avant-Garde: A Postmodernist Repetition. In: October, Bd. 18 (1981), S. 47 – 66, S. 52.)
Aber:
»I think that I’m a better editor of my work now than I was then. Part of it is that I think when you print something very close to the time that you take it, you are often disappointed – you remember all the shots that you didn’t get of the people that you wanted to get. You remember what you didn’t get. You don’t remember what’s in front of you and think: wow that’s really good. Now, looking back 40 years later you don’t remember what you didn’t get, you just see: oh, that’s really kind of an interesting picture. And so I think that I was coming to it with fresh eyes, I was also coming to it looking back at the past – this is about the 1980s –, how people were in the ’80s, and so I’m also looking back and bringing a historical perspective to it as well where I’m seeing maybe what’s interesting about it from today’s perspective. That’s the other thing that I think is helpful.«
(Sage Sohier in einem Interview mit Shane Taylor über die Arbeit an ihrem Buch Passing Time (2023): ↱ youtube.com/watch?v=IdVPCNtDLTI&t=662s [2024-02-29], meine Transkription)
Virage
Viradon (Agfa; hist.)
direkter ⭬ Toner; kombinierte Selen- und Schwefeltonung; stinkt und erzeugt kupferbraune bis violettbraune Töne; ⭬ Gradation bleibt gleich
Die klassische Rezeptur aus den 1930er-Jahren enthält Natrium- oder Kaliumpolysulfid und Selen, das beim ›neuen‹ Viradon (ab ca. 2000) nicht mehr enthalten war.
Vergleichbar mit Kodak Poly-Toner (wird ebenfalls nicht mehr produziert; hier ist Kodaks Anleitung zum Selbermachen: ↱ Mixing and Using a Substitute for Kodak Poly-Toner [2023-12-30])
Ein guter Ersatz für Viradon ist Wolfgang Moerschs MT-4 Schwefeltoner Siena.
Vorbelichtung, unterschwellige
Fotogr. ⭬ Schichten brauchen eine bestimmte Lichtmenge, damit eine Mindestschwärzung auftritt. Die V. belichtet das Material bis exakt an diese Schwelle. Die Lichtenergie der folgenden Belichtung wird dadurch komplett zur Bilderzeugung genutzt. Theoretisch ergibt sich so im Vergleich zur Belichtung ohne V. bei einer kürzeren Belichtungszeit die gleiche Schattenzeichnung, aber eine bessere Differenzierung der Lichter.
V. funktioniert für alle fotogr. Schichten, wird jedoch v. a. beim Belichten von Fotopapier angewandt. Beim V. von ⭬ kontrastvariablem Papier verwendet man die Filterung der Hauptbelichtung.
Lit.:
McLean, Les: Pre and Post Flashing to Control Contrast. In: Anchell (2016), S. 98 f. [⭬ Literatur]
engl.: flashing; pre-exposure
Vorwässerung
Wässern des Films für einige Minuten vor der ⭬ Entwicklung mit der Temperatur des späteren Entwicklungsbads, damit Tank und Film auf die Entwicklungstemperatur vorgewärmt werden. Außerdem kann sich der Entwickler auf der vorgewässerten ⭬ Schicht gleichmäßiger verteilen. Nebenbei werden bei der V. auch wasserlösliche Hilfsschichten (z. B. die ⭬ Lichthofschutzschicht) ausgewaschen (was jedoch auf das Entwicklungsergebnis keinen Einfluss hat), das Vorwässerungs-Wasser hat daher beim Ausgießen je nach Film eine andere Färbung.
»A pre-rinse is not recommended as it can lead to uneven processing.« (Ilford 2018, S. 5)
»Prewetting sheet film may improve tray process uniformity.« (Kodak 2016, S. 4)
»Grundsätzlich gilt: Je größer das Filmformat, desto wichtiger ist das Vorwässern für eine gleichmäßige Entwicklung.« (Jobo 2022, S. 4)
engl.: pre-rinse; pre-wash; pre-soak; prewetting
Lit.:
#9240 JOBO C-41 Farbnegativ-Entwicklungskit. Firmenschrift Jobo. Okt. 2022.
Kodak Professional T-MAX 400 Film. Firmenschrift Kodak alaris. Feb. 2016. Online: ↱ imaging.kodakalaris.com/sites/default/files/files/resources/f4043_TMax_400.pdf [2023-12-09]
Technical Information HP5 Plus. Firmenschrift Harman. Nov. 2018. Online: ↱ ilfordphoto.com/amfile/file/download/file/1903/product/691/ [2023-12-09]
W
Wärmefilter
⭬ Farbfilter, der die ⭬ Farbtemperatur des Aufnahmelichts etwas absenkt und damit einen wärmeren Bildton erzeugt. Im Prinzip ein Farbkorrekturfilter (Kodak Wratten 81 bis 85, KR 2 bis 15; ⭬ Farbfilter), der aus ästhetischen Gründen verwendet wird.
Es gibt auch spezielle Wärmefilter, z. B. von Tiffen den 812 Warming Filter oder von Cokin den Warm 81 Z.
engl.: warming filter
Warmton
Bildbeispiele siehe ⭬ Fomatol PW
engl.: warm image tone
Wässern
- ⭬ Vorwässerung
- Zwischenwässerung:
Bei der Verarbeitung fotogr. ⭬ Schichten wird zwischen den einzelnen Bädern kurz gewässert, um das nachfolgende Bad nicht mit den Substanzen des vorherigen zu belasten. - Schlusswässerung:
Letzter (oder vorletzter) Schritt bei der Verarbeitung fotogr. ⭬ Schichten. Dabei sollen alle noch in der Schicht verbliebenen Substanzen aus den vorherigen Prozessschritten ausgewaschen werden. Eine gründliche S. ist meist eine wichtige Voraussetzung für ⭬ Archivfestigkeit.
s. a. ⭬ Auswässerungshilfe; ⭬ Entwicklungsprozess
engl.: washing
Wechselsack
Wegwerfkamera; Einmalkamera
Einfachst ausgestattete kompakte Sucherkamera für ⭬ Klein- oder ⭬ Kleinstbildfilm, die mit bereits eingelegtem Film verkauft wird. Üblicherweise sind Verschlusszeit und ⭬ Blende fix und es gibt keine Rückspulkurbel; meist jedoch einen eingebauten Blitz.
Frühe W. mussten zum Hersteller zurückgeschickt werden, dieser hat den Film entwickelt und die Bilder zurückgeschickt. Die ›modernen‹ W. konnte man bei jedem Fotolabor abgeben, die erste brachten Fuji (Film with Lens) und dann Kodak (Fling 110) in den 1980er-Jahren auf den Markt, zuerst mit Pocketfilm (⭬ Film Typ 110), später mit Kleinbildfilm (Kodak Stretch 35, später FunSaver; Fuji Quicksnap Flash).
Um den Film zu entnehmen, muss die Kamera aufgebrochen werden – es ist technisch nicht vorgesehen, die Kamera wiederzuverwenden.
Wenn man das Kameragehäuse jedoch vorsichtig im Dunkeln öffnet, ohne dass es in Einzelteile zerfällt, kann man den Film dennoch wechseln – ⚠: aufpassen wegen des Blitzkondensators!
engl.: disposable camera; one-time-use camera; single use camera
s. a. ⭬ Low-fi Fotografie; ⭬ Toy Camera
wet plate
X
XP (Ilford)
XTOL (Kodak)
proprietärer ⭬ Entwickler für Schwarzweiß-Negativfilm; Vertrieb in Pulverform; Stand der Technik: der letzte Entwickler, den ein Team um Silvia Zawadzki (1943–2020) bei Kodak bis 1996 mit hohem Forschungsaufwand von Grund auf neu entwickelt hat.
Xtol ist ein sehr umweltfreundlicher Entwickler (kann in den Ausguss) und ein sehr ökonomischer, vor allem, wenn er verdünnt (bis 1+3, aber: mind. 100 ml Xtol pro Film) oder (mit sich selbst!) regenerierend genutzt wird – dann allerdings nur 1+0.
ohne ⭬ Hydrochinon ⚠
↱ Datenblatt [2022-07-23]
Clone:
- Adox XT-3 (Pulver)
↱ Webseite d. Herstellers [2022-07-23]
Noch umweltfreundlicher als Xtol, da es kein Borax enthält; kann ›offiziell‹ allerdings nicht regeneriert werden. - Bellini Ecofilm (Flüssigkonzentrat)
↱ Webseite d. Herstellers [2023-03-28]
Foma Fomadon Excel (W27; Pulver) (↱ Webseite d. Herstellers [2022-07-23]) gilt als mit Xtol vergleichbar, enthält ebenfalls kein ⭬ Hydrochinon ⚠, basiert jedoch nicht auf Ascorbinsäure (obwohl das oft geschrieben wird, im ↱ MSDS [2025-08-07] steht jedenfalls nichts davon).
Lit.:
Covington, Michael A.: Kodak Xtol Developer ; An Unofficial Resource Page. o. D. Online: ↱ covington
innovations.com/xtol/index.html [2023-12-27]Troop/
Anchell (2020), S. 61 ff. [⭬ Literatur]
Z
Zelluloid, CN
Thermoplastischer Kunststoff aus Cellulosenitrat ⚠ und Campher ⚠ als Weichmacher; Trägermaterial für ⭬ fotogr. Schichten. Z. ist leicht entzündlich und wurde daher ab den 1950er-Jahren durch sog. ⭬ Sicherheitsfilm aus Celluloseacetat ersetzt.
Im Kino: Am Höhepunkt Quentin Tarantinos Inglourious Basterds (2009) wirft auf Shosanna Dreyfus' Order Marcel seine Zigarette in einen Haufen Zelluloidfilm.
engl.: Celluloid
Zentralverschluss
Variante eines ⭬ Kameraverschlusses
Den Z. findet man in jeder Kameragattung, in Spiegelreflexkameras ist er seit den 1970er-Jahren jedoch selten; dort dominiert der ⭬ Schlitzverschluss. Der Z. ist üblicher- aber nicht notwendigerweise ins Objektiv eingebaut (es gibt Hinterlinsenverschlüsse) und besteht aus Lamellen, die angeordnet sind wie in einer Irisblende.
Ein Nachteil des Z. gegenüber dem Schlitzverschluss ist die aus mechanischen Gründen kürzestmögliche Verschlusszeit von ¹⁄₁₀₀₀ s (sehr selten), üblich ist jedoch ¹⁄₅₀₀ s; bei hochlichtstarken Objektiven sogar noch länger.
Vorteile von Zentral- gegenüber Schlitzverschlüssen:
Bei jeder Verschlusszeit kann geblitzt werden, es gibt keine besondere Blitzsynchronzeit.
Der Rolling-Shutter-Effekt kann nicht auftreten.
Sie sind meist leiser als die Schlitzverschlüsse.
Wichtige Hersteller von Z. waren die Firmen Friedrich Deckel in München (›Compur‹) und Alfred Gauthier in Bad Wildbad (Calmbach/
engl.: leaf shutter; central shutter
Zine [ˈziːn]
Persönliche Publikation zu beliebigem Thema; vom zinester selbst gestaltet; üblicherweise in kleiner Auflage fotokopiert/
Die Ursprünge des Genres finden sich wohl in den Science-Fiction-Fangemeinden der 1930er-Jahre (»fanzine« [fan magazine]; vgl. ↱ The Comet [2023-08-05]); in den 1970er-Jahren waren Z. dann sehr verbreitet in den Untergrundmusik-Szenen (vgl. z. B. ↱ Sniffin’ Glue [2023-08-05] oder später ↱ Bikini Kill [2023-08-05]).
Die Verfügbarkeit der Print-on-Demand-Möglichkeiten befeuerte einerseits die Z.-Produktion – veränderte andererseits aber auch die Ästhetik der nun ›digitalen‹ Zines und führte zu einer Verwässerung des Begriffs.
↱ The Sherwood Forest Zine Library [2024-07-27]
↱ ZineWiki [2024-07-27]
Lit.:
Hoffelner, Christian: A Zine ; Aspekte architekturrelevanter Drucksachen: Das Phänomen Eigenverlag in gestaltenden Disziplinen. Leipzig: Spector, 2012. ISBN 978-3-940064-53-0
Nelissen, Elisa: Return to the Tangible? The Photozine in the Digital Age. MA Thesis, Book and Digital Media Studies, Leiden University, 2015. Online: ↱ https://studenttheses.universiteitleiden.nl/access/item:2662415/view [2022-04-07]
Zonenplatte
engl.: zone plate
Zonensystem
Idee:
Systematischer Ansatz zum Kalibrieren des persönlichen Workflows der Schwarzweißfotografie [Aufnahme – Filmentwicklung (⭬ Entwicklungsprozess) – Ausarbeitung des ⭬ Prints (⭬ Kontaktkopie/
Das Z. wurde in den späten 1930er-Jahren von den Fotografen Ansel Adams (1902–1984) und Fred Archer (1889–1963) entwickelt auf der Basis früherer sensitometrischer Erkenntnisse (⭬ Sensitometrie) von Ferdinand Hurter (1844–1898) und Vero Charles Driffield (1848–1915).
Prinzip:
Der Kontrastumfang der fotogr. ⭬ Schicht wird gleichmäßig eingeteilt in elf Zonen, mit jeweils einem Abstand von einem ⭬ Lichtwert: [Zonen 0, I, II, …, IX, X]. Zone 0 entspricht einem unbelichteten Negativ (Filmträger plus ⭬ Schleier) und definiert so das maximale Schwarz im Print; Zone X entspricht im Print dem Papierweiß und wird höchstens für kleine Spitzlichter benötigt. Belichtungsmesser messen ein mittleres Grau, das ist Zone V; Zone I ist gerade so unterscheidbar von reinem Schwarz und Zone IX ist etwas gräulicher als das reine Papierweiß. Somit definiert das Z. die tonalen Eckpfeiler eines perfekten Prints.
Anwendung:
Vor jeder Aufnahme wird der Motivkontrast ausgemessen und den entsprechenden Zonen zugeordnet. Passt der Motivkontrast nicht zum Kontrastumfang der Schicht, wird diese mit einem anderen ⭬ E I belichtet und kürzer oder länger entwickelt (Kontraststeuerung durch N+- oder N−-Entwicklung bzw. expandieren/
Zone I ergibt sich aus der realen ⭬ Filmempfindlichkeit, Zone IX aus der Entwicklungszeit. Daher wird die eigene Prozesskette für jede Film-Entwickler-Kombination eingetestet, indem man zuerst die reale Filmempfindlichkeit ermittelt und in einem zweiten Schritt die Dauer der Filmentwicklung (= Normalentwicklung). Beide Parameter unterscheiden sich sehr wahrscheinlich von den Herstellerangaben.
Kurzversion:
Den Ansatz des Z. kann man auch ohne das sensitometrische Instrumentarium (⭬ Sensitometrie) für sich nutzbar machen:
- Fertige zwei Aufnahmen einer gleichmäßig mit ⭬ Tageslicht beleuchteten neutralen Fläche an, die erste 4 Blenden unterbelichtet (≙ Zone I), die zweite 4 Blenden überbelichtet (≙ Zone IX).
- Entwickeln usw.
- Ermittle die kürzeste Belichtungszeit, die das ⭬ Fotopapier mit diesem Film maximal schwärzt: Die Belichtungszeit eines unbelichteten Filmabschnitts dieses (!) Films wird so lange erhöht, bis die Vergrößerung nicht mehr schwärzer wird.
- Vergrößere beide Bilder mit dieser Belichtungszeit auf Papier der Gradation 2.
- Das dunkle Bild (des ›dünnen‹ Negativs) sollte sich gerade noch vom maximalen Schwarz unterscheiden. Ist es zu grau, war der gewählte ⭬ E I zu niedrig, lässt es sich nicht vom Maximalschwarz unterscheiden, war er zu hoch.
- Das helle Bild (des ›dichten‹ Negativs) sollte sich gerade noch vom Papierweiß unterscheiden. Wenn es deutlich grau ist, war die Entwicklungszeit zu kurz; wenn es sich nicht vom Papierweiß unterscheidet, war sie zu lang.
- s. a. ⭬ Faustregel 1
Nutzen des Z.:
Erst mit dem Wissen um die tatsächliche Filmempfindlichkeit und der Sicherheit, dass die Hochlichter auch im Print abgebildet werden, kann man sinnvoll die Belichtung messen (idealerweise mit einem Spot-⭬ Belichtungsmesser) und entscheiden, wie das jeweilige Motiv im Print repräsentiert werden soll.
Aber: keine Panik – achtzig Jahre nach St. Ansels Zeiten profitieren wir in dieser Hinsicht mächtig vom fotochemischen Fortschritt: Unsere Materialien haben eine höhere Verarbeitungstoleranz. Und: Wir haben ⭬ kontrastvariable Fotopapiere. Also: Die Schicht im Zweifel überbelichten und etwas kürzer entwickeln.
engl.: zone system
Zweibadentwickler, Zweistufen-Entwickler
Viele ⭬ Entwickler lassen sich als Z. formulieren, indem die Bestandteile des Entwicklers auf zwei Bäder aufgeteilt werden, denen der Film nacheinander ausgesetzt wird. Das erste Bad enthält die ⭬ Entwicklersubstanz, das zweite den Beschleuniger.
Im ersten Bad wird die Emulsion mit Entwickler gesättigt, ohne dass die Entwicklung startet (zumindest bei ›echten‹ Z., wenn das erste Bad kein Alkali enthält) – das geschieht erst nach der Überführung des Films ins zweite Bad. Aufgrund der begrenzten Entwicklermenge in der Emulsion erschöpft sich der Entwickler in stark belichteten Bereichen schnell, wodurch eine Überentwicklung der Lichter begrenzt wird, und entwickelt die Schattenbereiche weiter, wo mehr Entwickler verfügbar ist als benötigt wird. Dieser kompensierende Effekt sorgt für eine gute Tontrennung in den Schatten, ohne dass die Lichter zu dicht werden.
Neben dem kompensierenden Effekt ist ein Vorteil von Z., dass Temperatur und Entwicklungszeit unkritisch sind, auch ist eine Überentwicklung quasi unmöglich.
populäre Z.: ⭬ Diafine (BKA), Emofin (Tetenal, hist.), MZB (Moersch), Barry Thornton Two Bath, Divided ⭬ D-23, Divided ⭬ D-76
Lit.:
Troop/
Anchell (2020), S. 113 ff. [⭬ Literatur]
engl.: two bath developer, divided developer
Zweischalenentwicklung, Zweibadentwicklung
engl.: two bath development
Zwischennegativ (Internegativ)
Negativ-Duplikat eines ⭬ Diapositivs, um von diesem Abzüge in Negativ-Positiv-Prozessen herzustellen. Ein Z. wird auf speziellen Internegativ-Film mit flacher ⭬ Gradation angefertigt, um den hohen Kontrast des Dias zu bewältigen (Dia-Material war nie ausgelegt für das Anfertigen von Positivkopien).
Zwar konnte man Dias mit ⭬ Cibachrome und mit anderen Verfahren (z. B. ⭬ Ektachrome-22-Farbumkehrpapier) direkt zu Papier bringen, doch das war teuer und eher nicht praktikabel für viele Exemplare. Mit einem Zwischennegativ kann man günstige ⭬ C-Prints indirekt vom Dia anfertigen, und dabei en passant Kontrast und Farbigkeit anpassen.
Da keine farbigen Positiv-Positiv-Materialien mehr hergestellt werden, ist das aktuell auch der einzige Weg, analog ⭬ Vergrößerungen von Dias herzustellen.
engl.: internegative
s. a. ⭬ Duplikatfilm
Zwischenring
Hilfsmittel für die Makrofotografie
s. a. ⭬ Balgengerät; ⭬ Nahlinse
engl.: extension tube

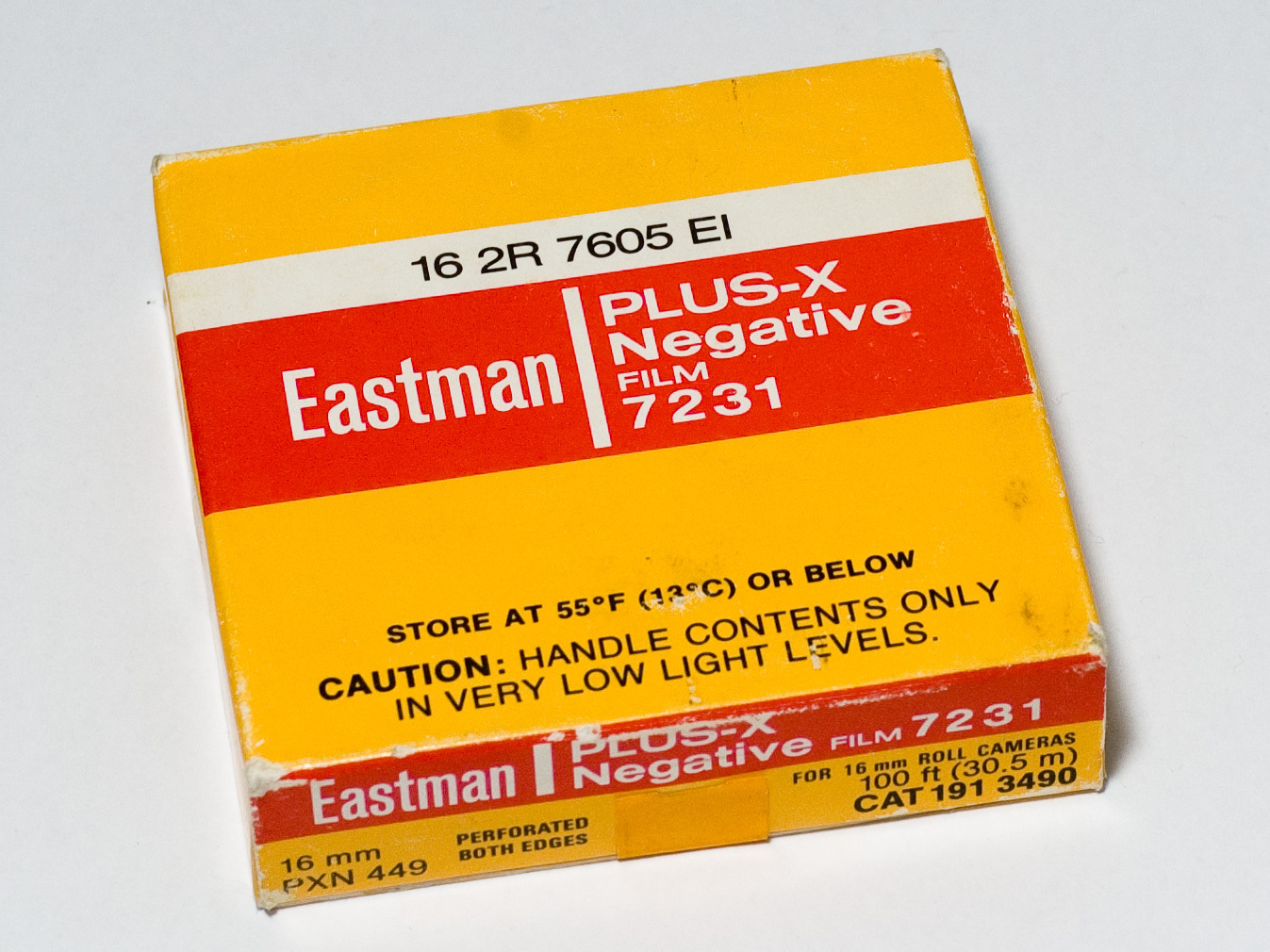






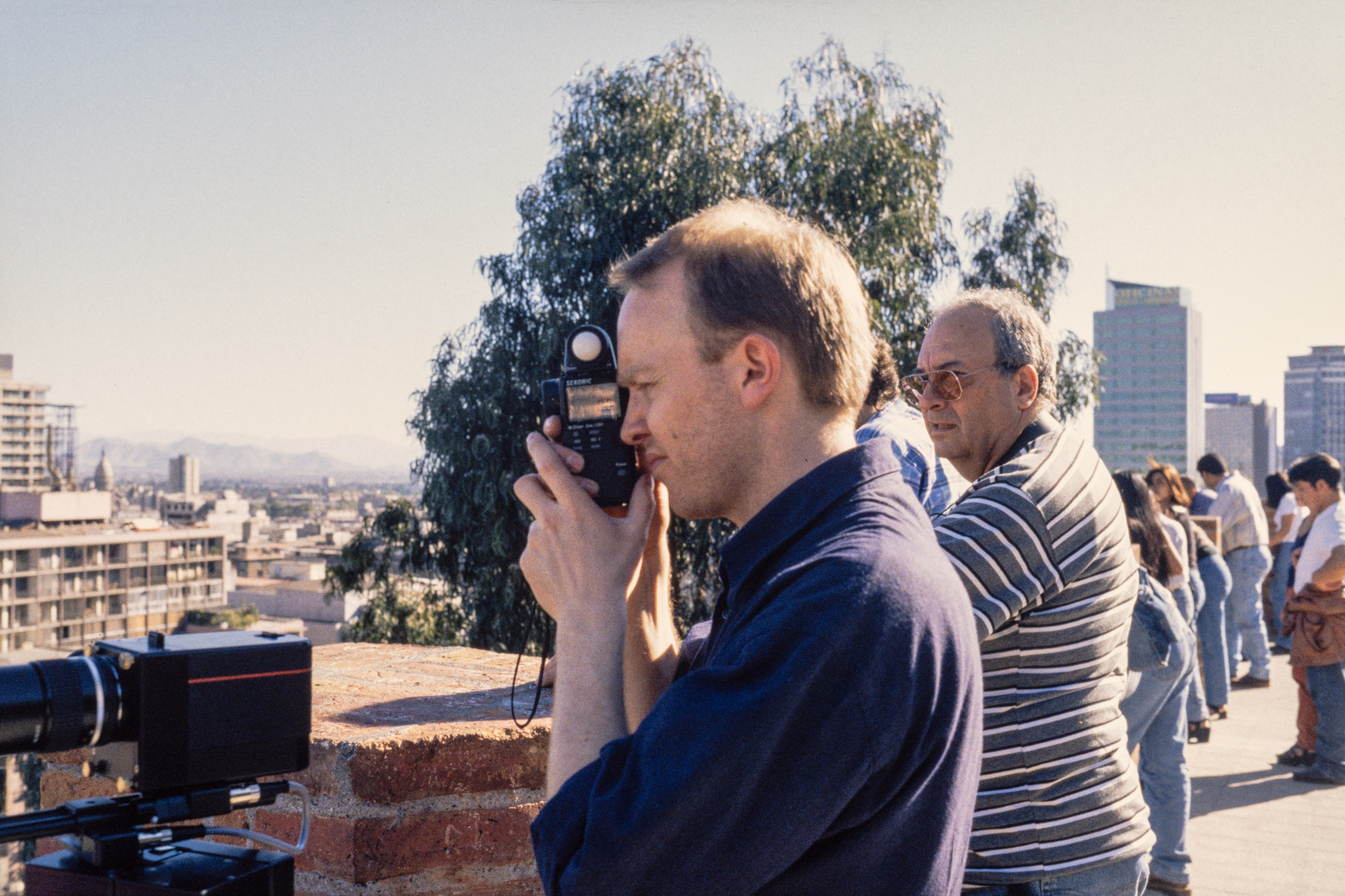





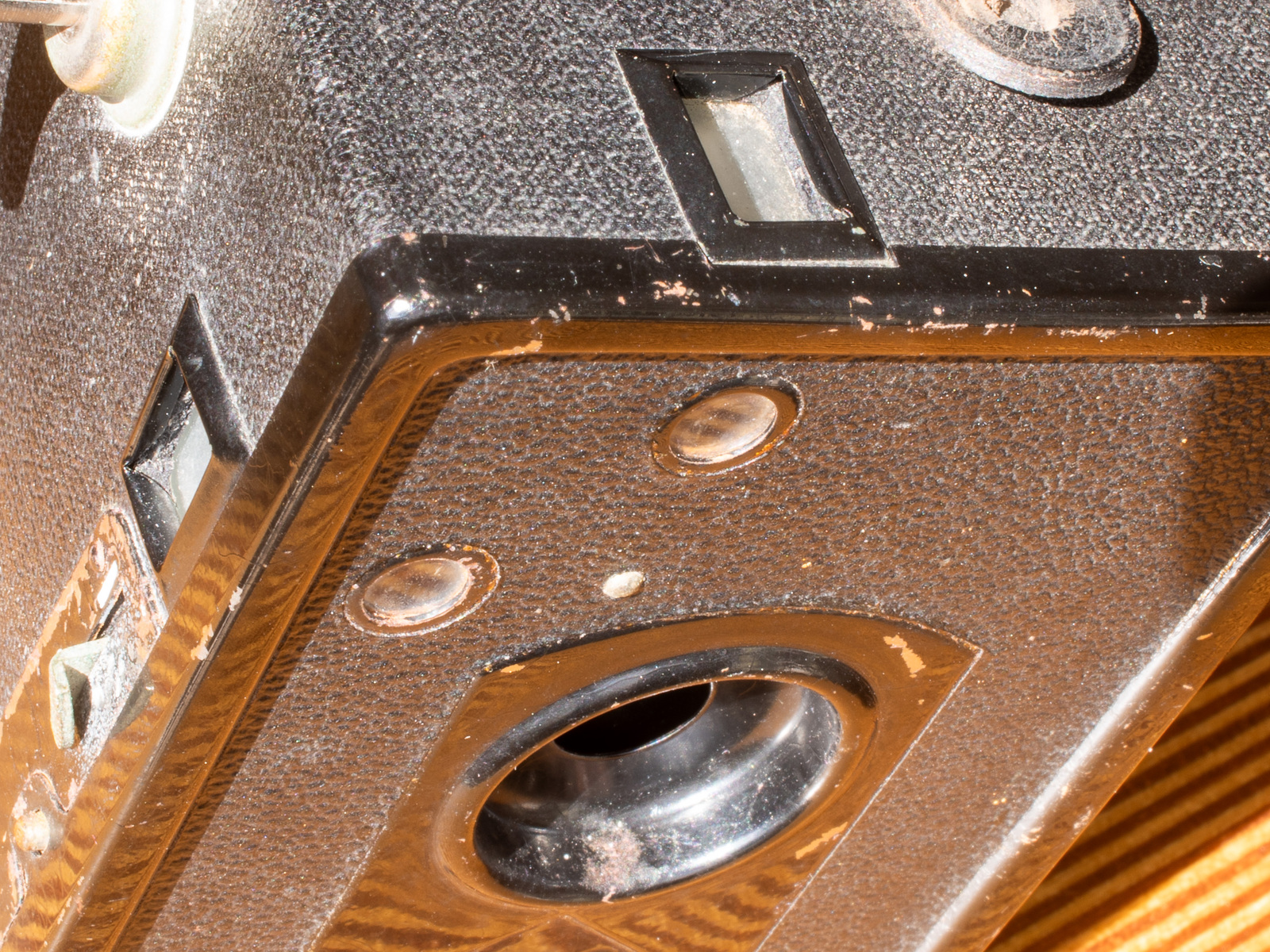












![© Martin Frech: Werbung für Entwicklersubstanzen und andere Fotochemikalien Werbung für die Entwicklersubstanzen Pyrogallol und Hydrochinon, für Fixiersalz und andere Fotochemikalien auf der Rückseite einer Verpackung von Trockenplatten der Fa. Hauff, Stuttgart-Feuerbach [frühes 20. Jahrhundert] (Foto: © Martin Frech, 9/2025)](https://dpfs.api.medienfrech.de/5aaf2498cf783e8a.best.jpg)




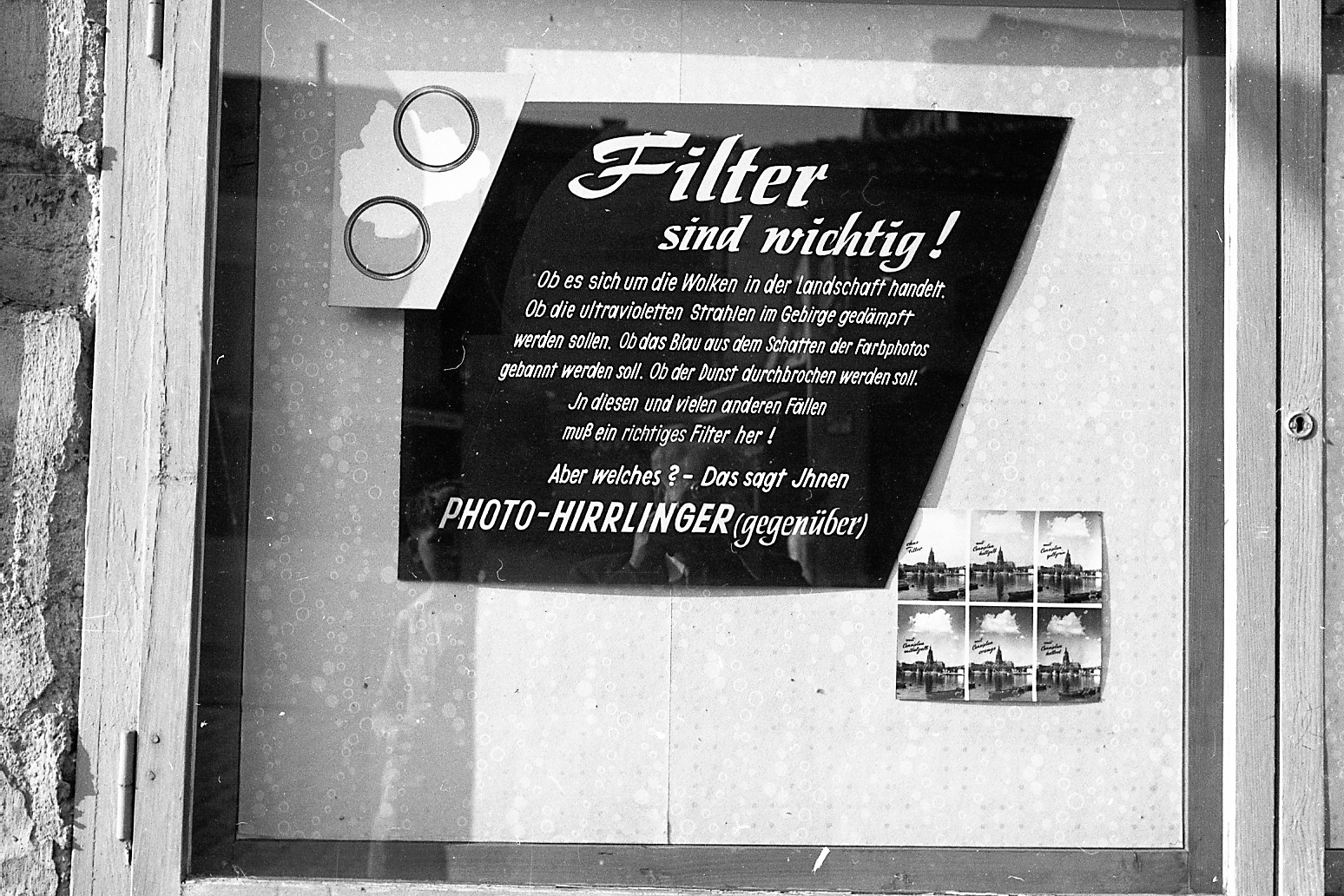
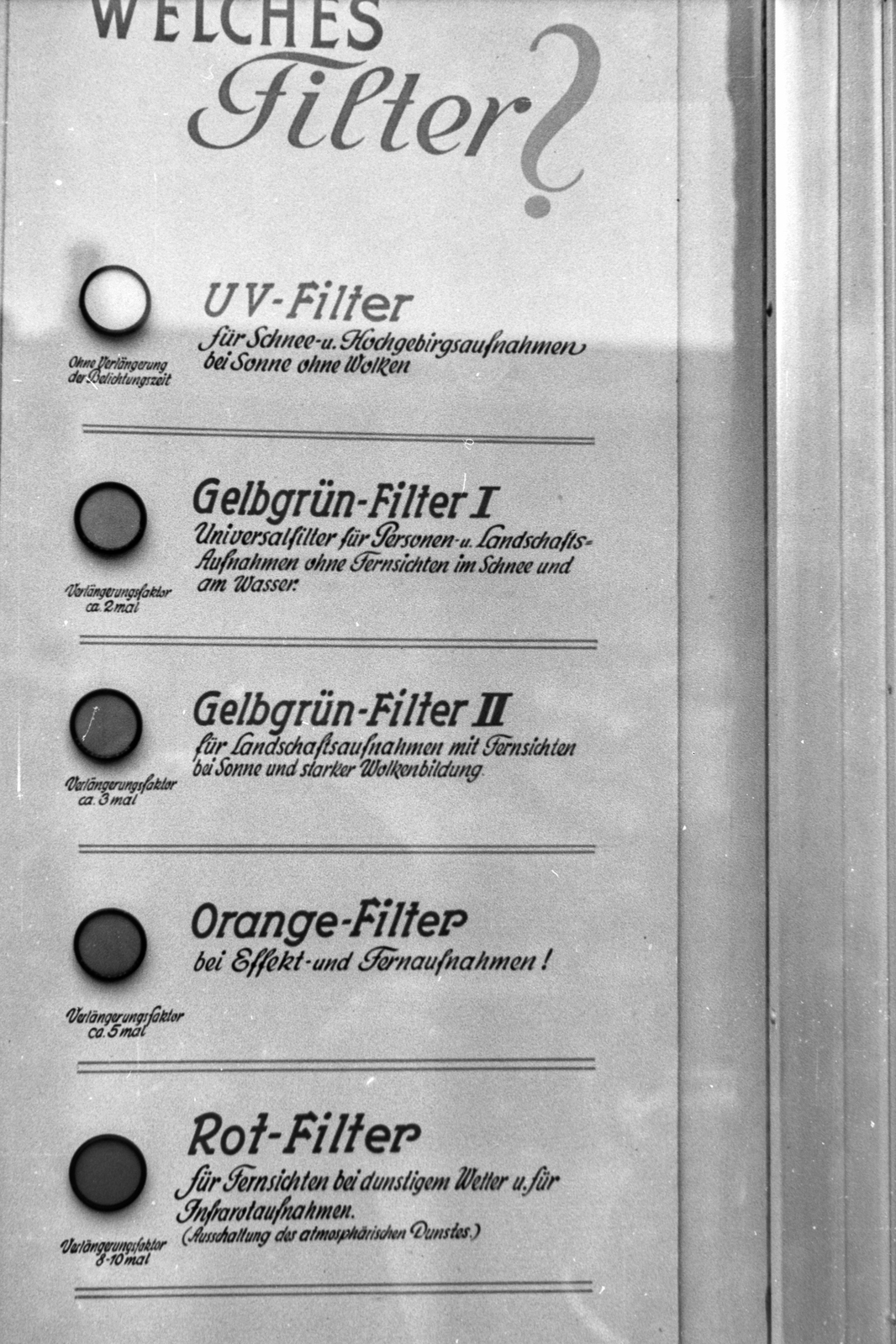
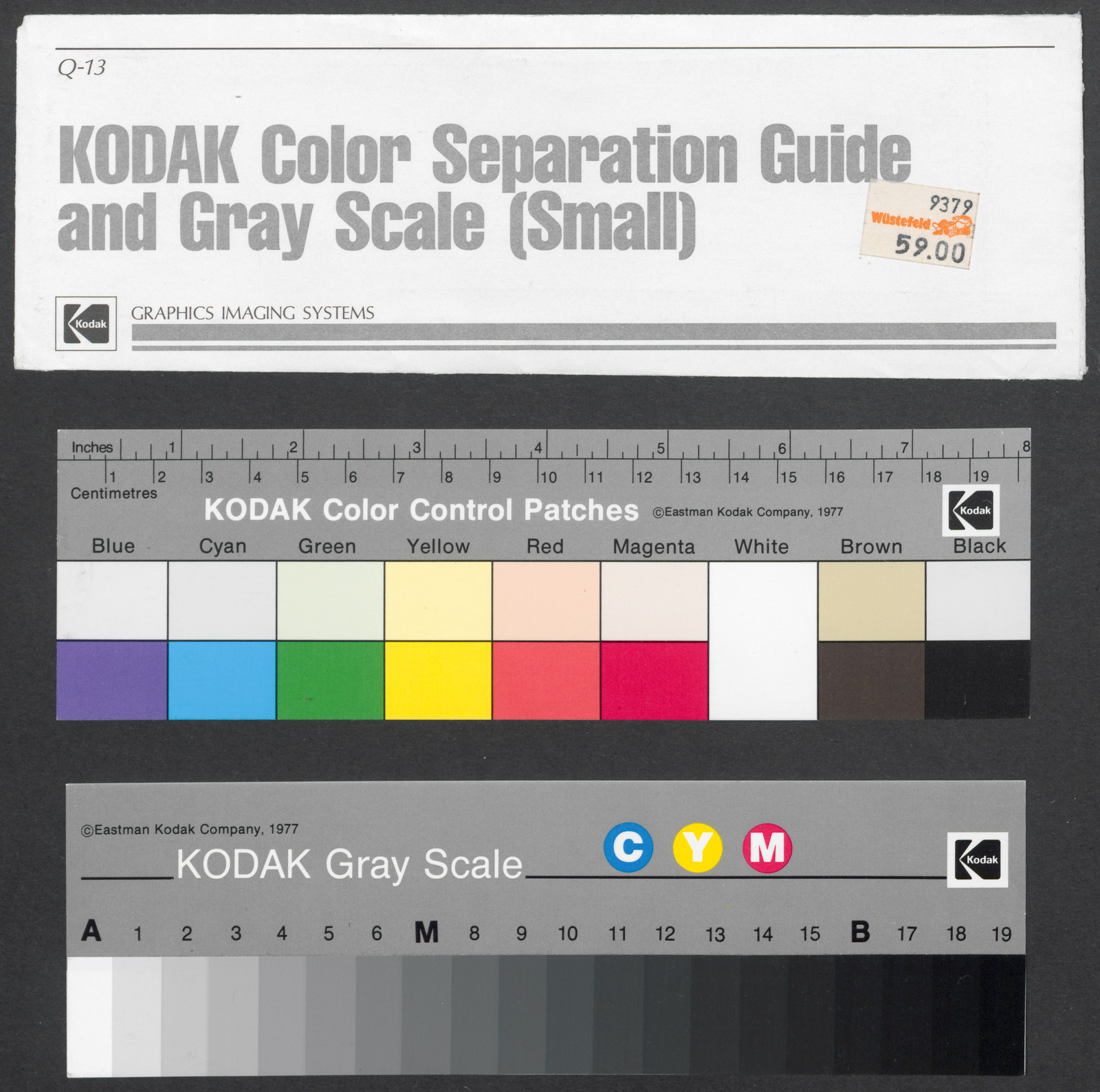
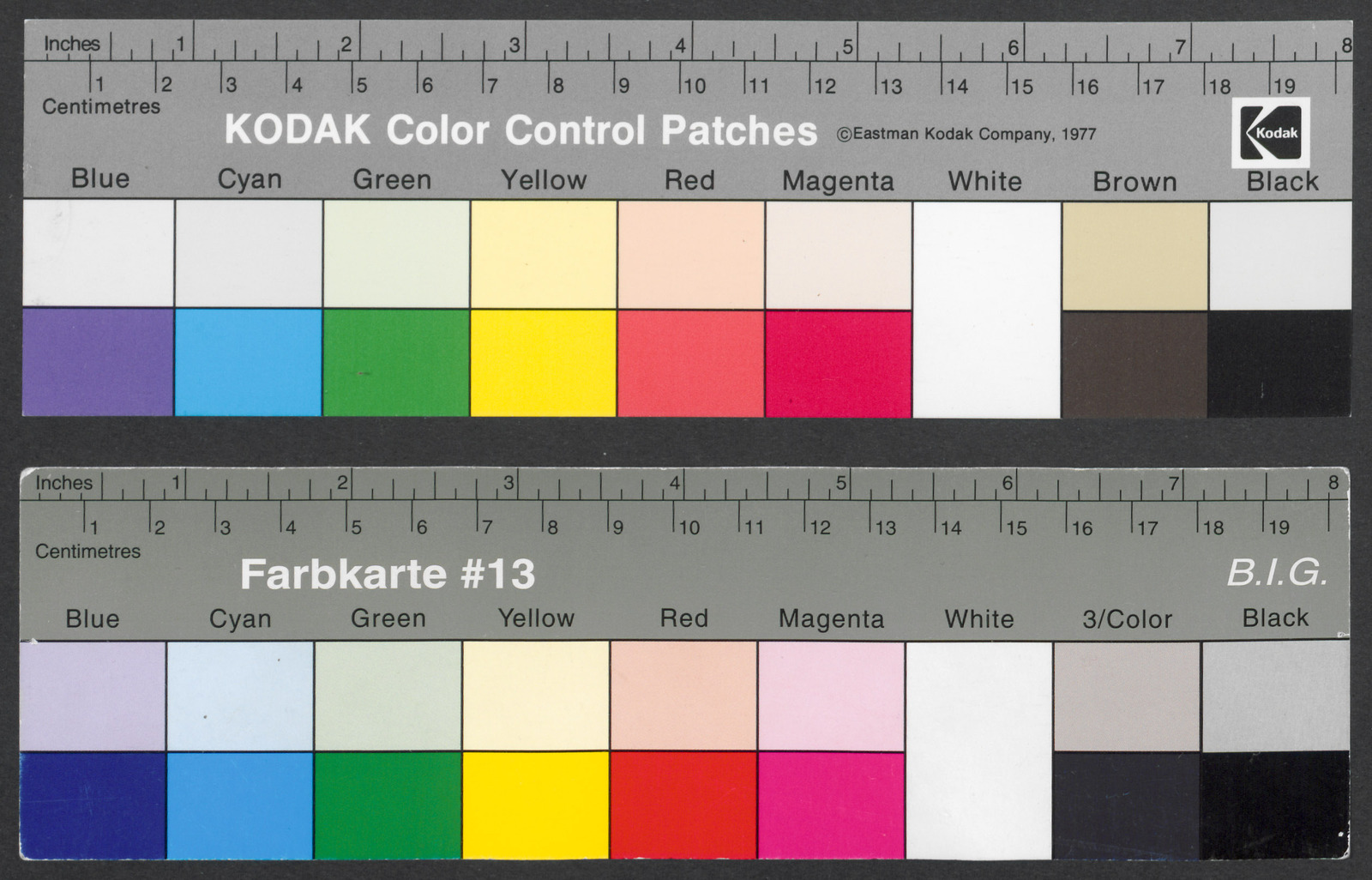
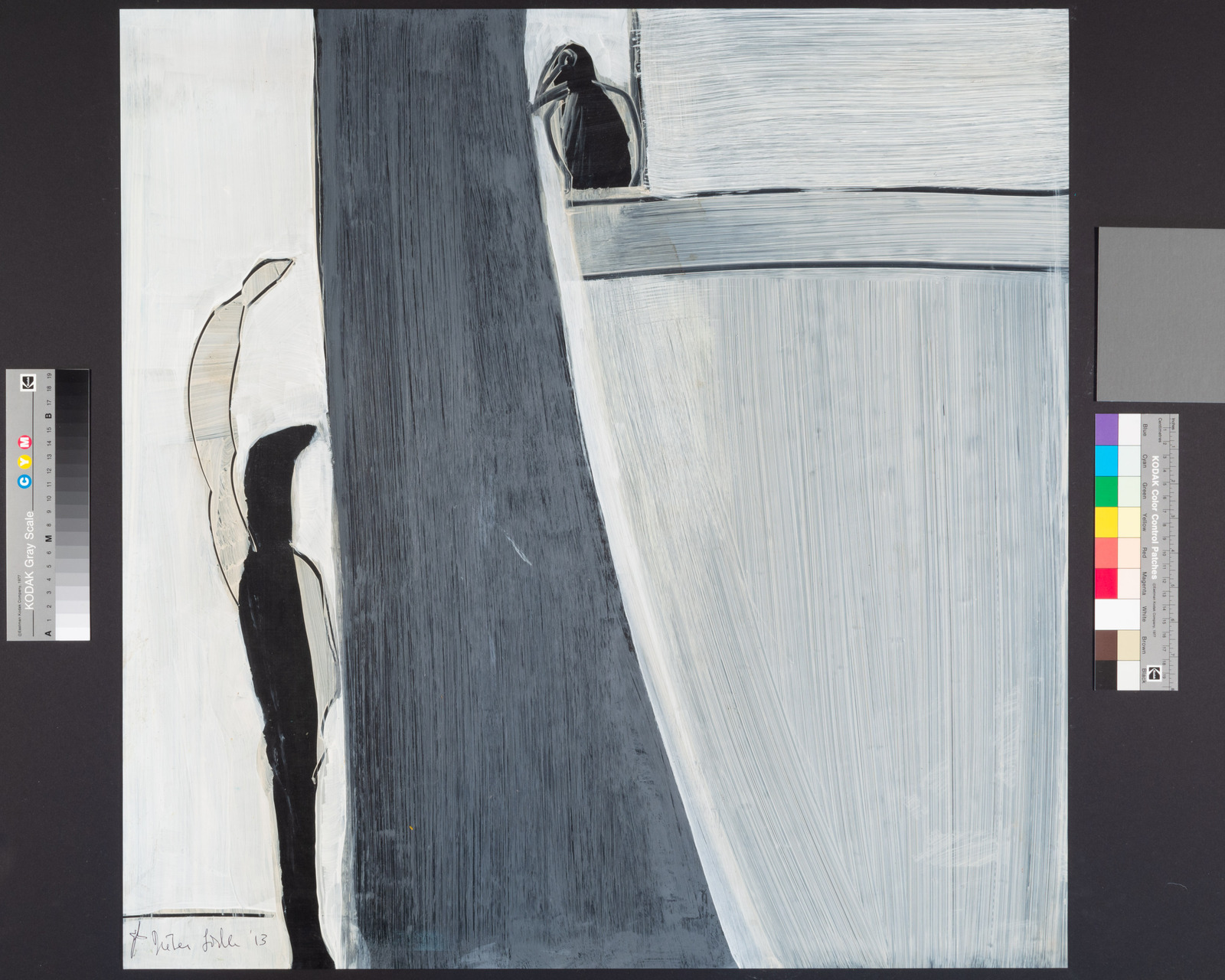

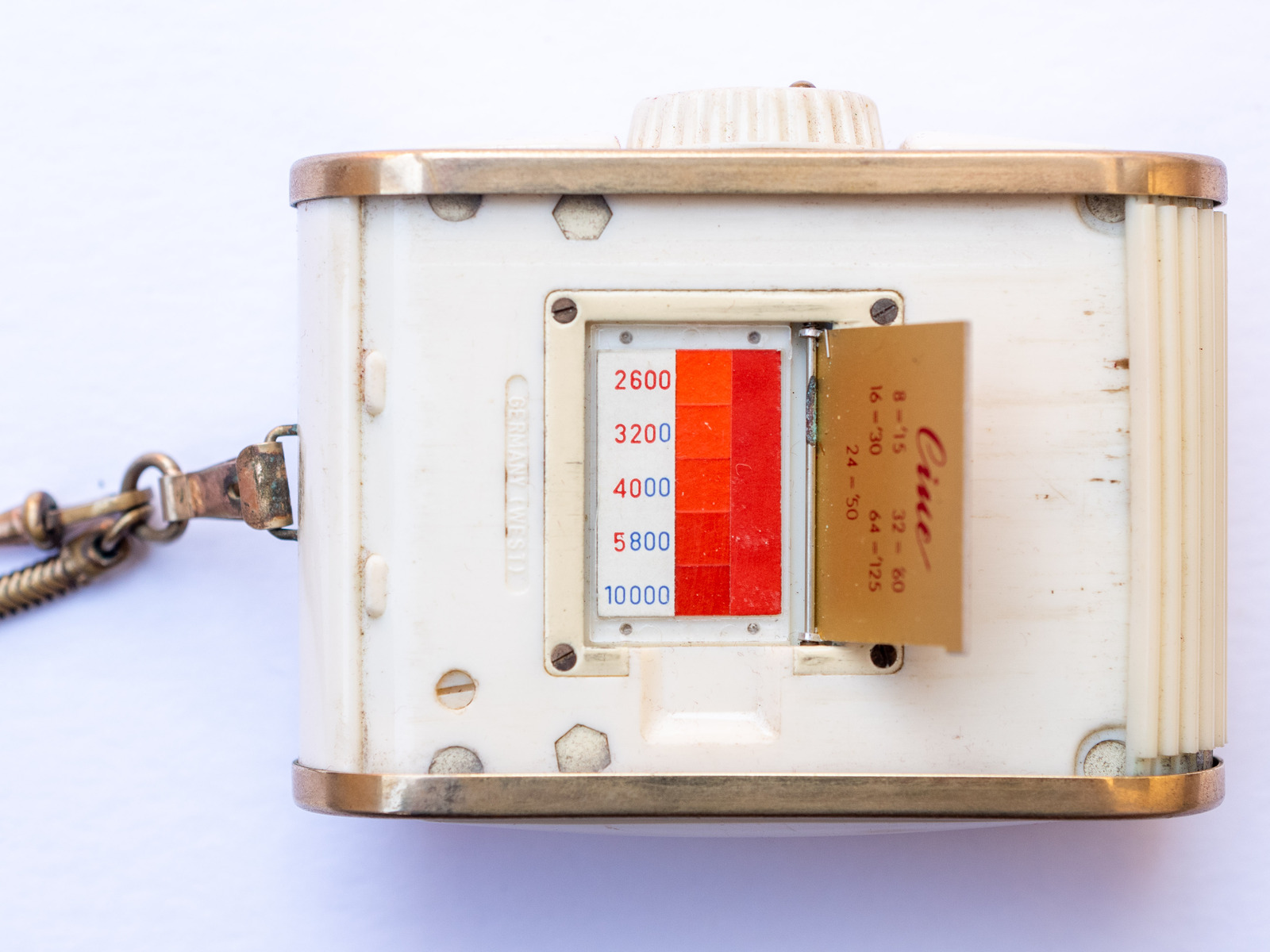

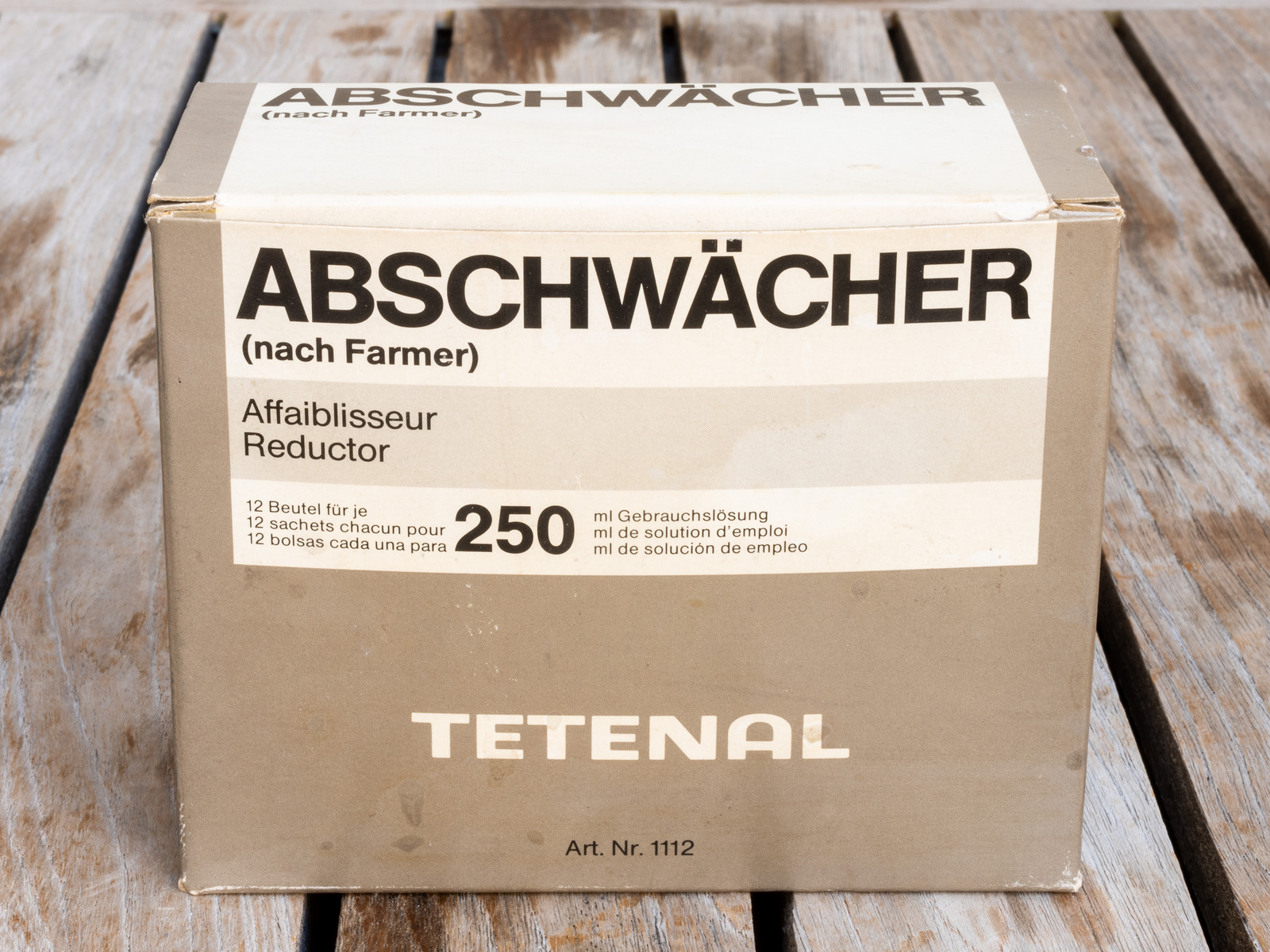
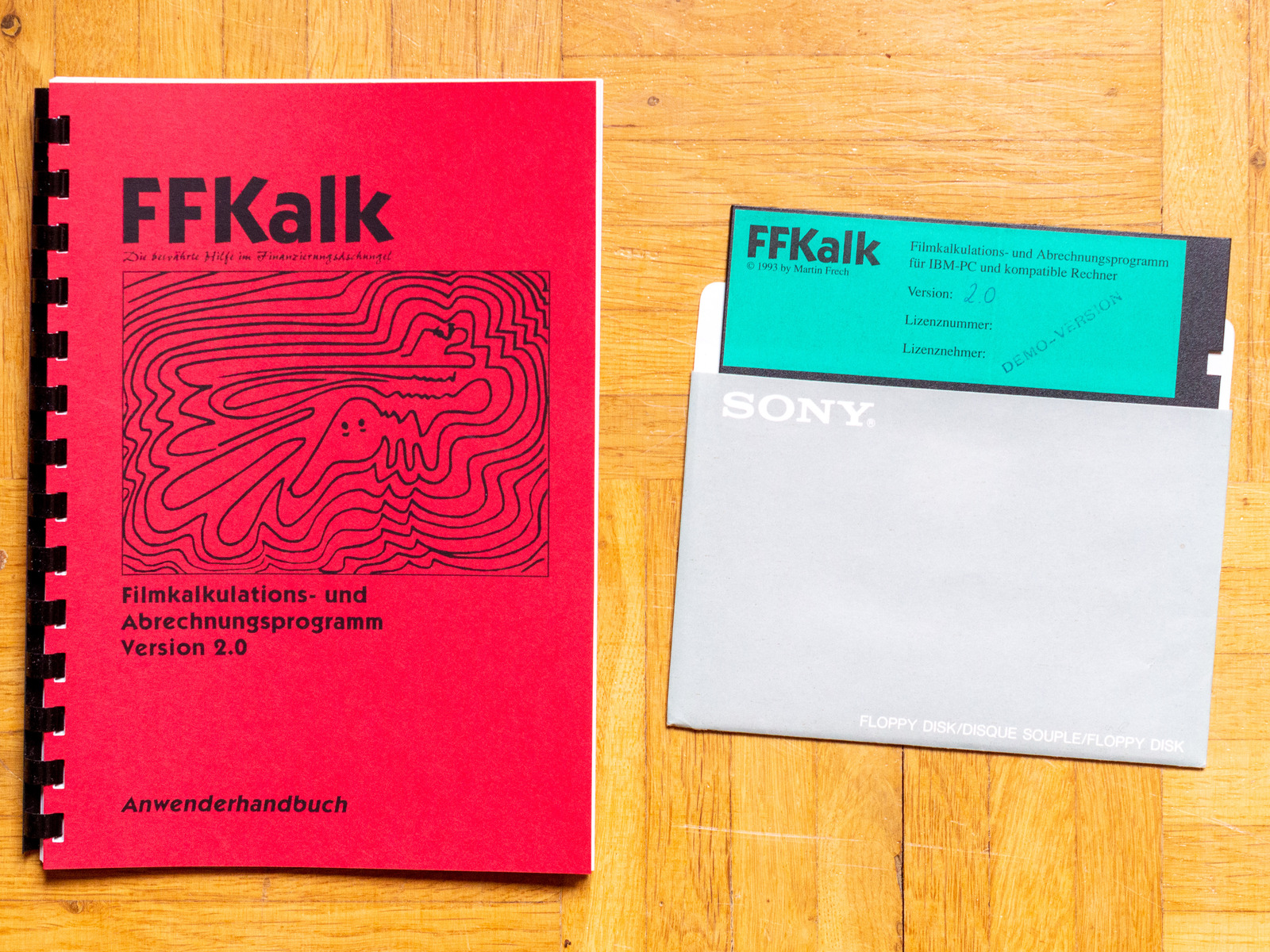
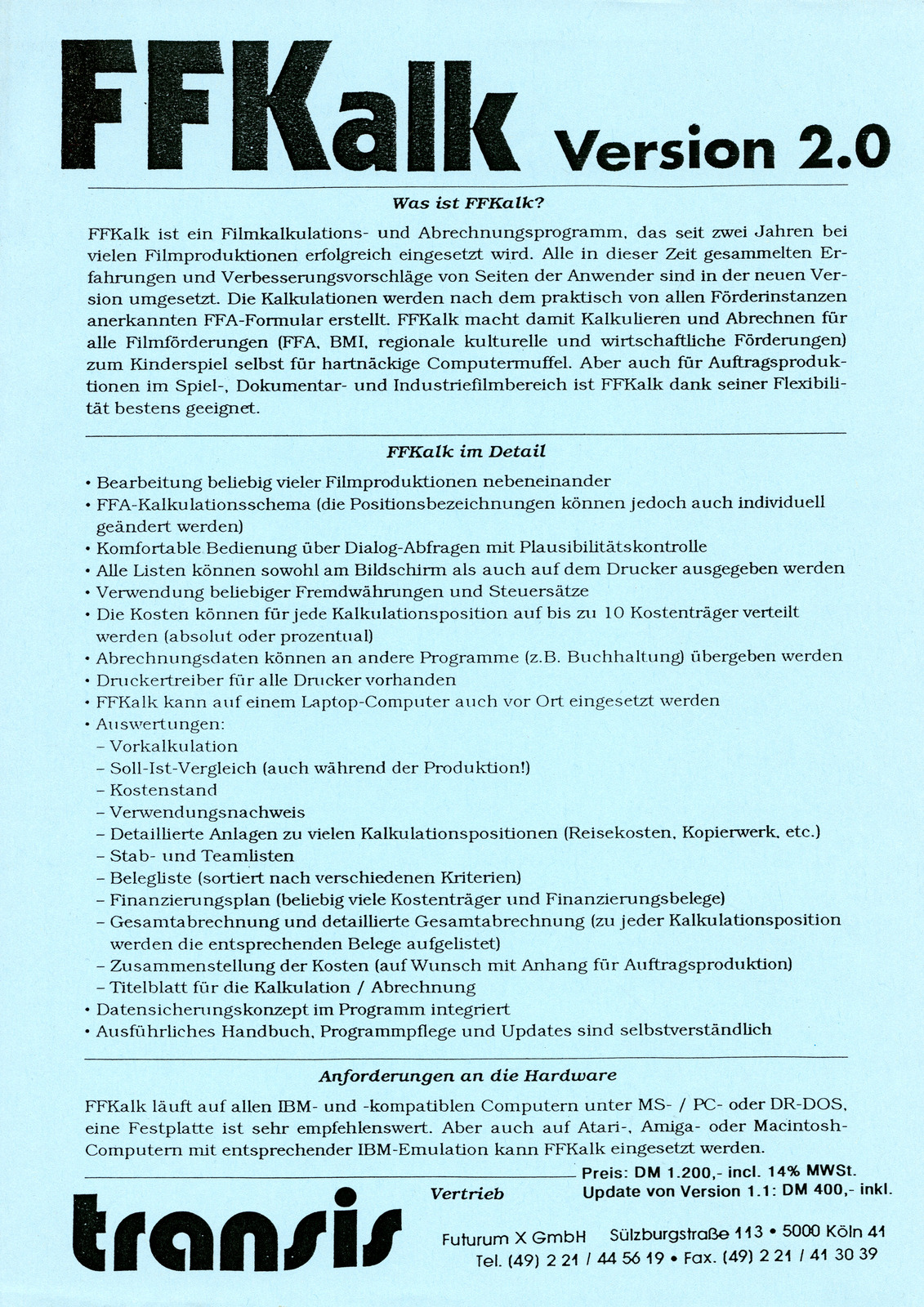

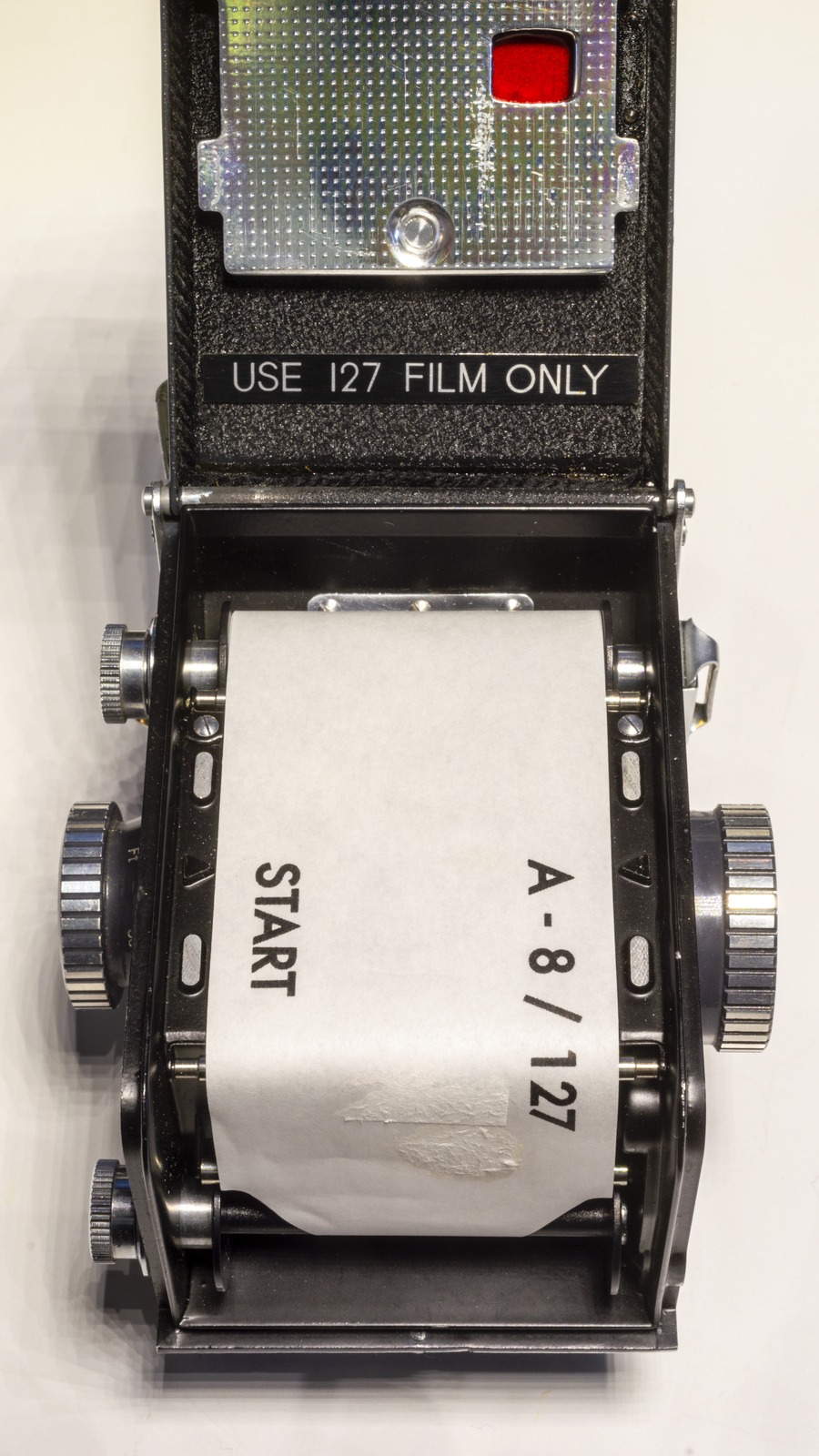




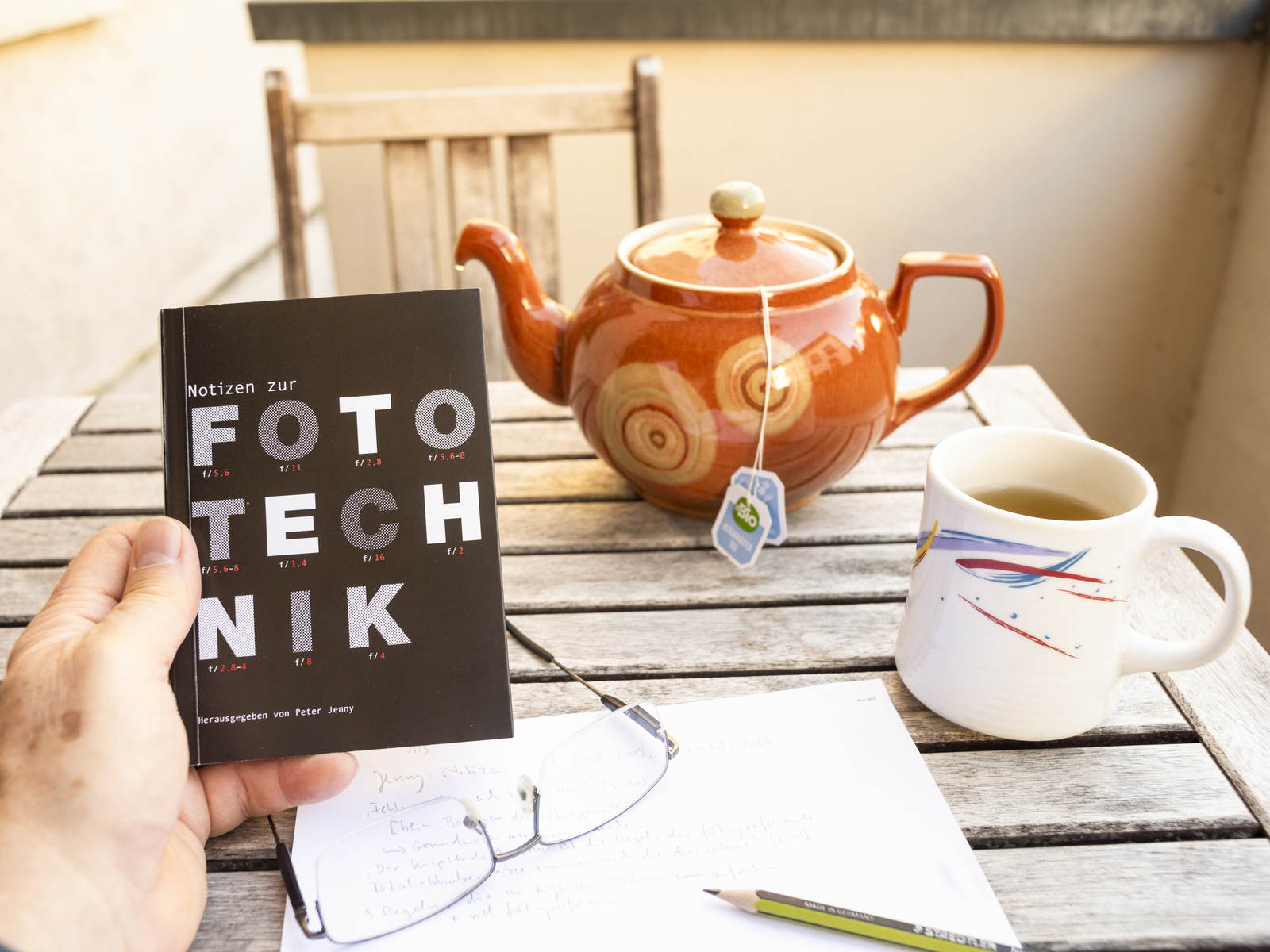




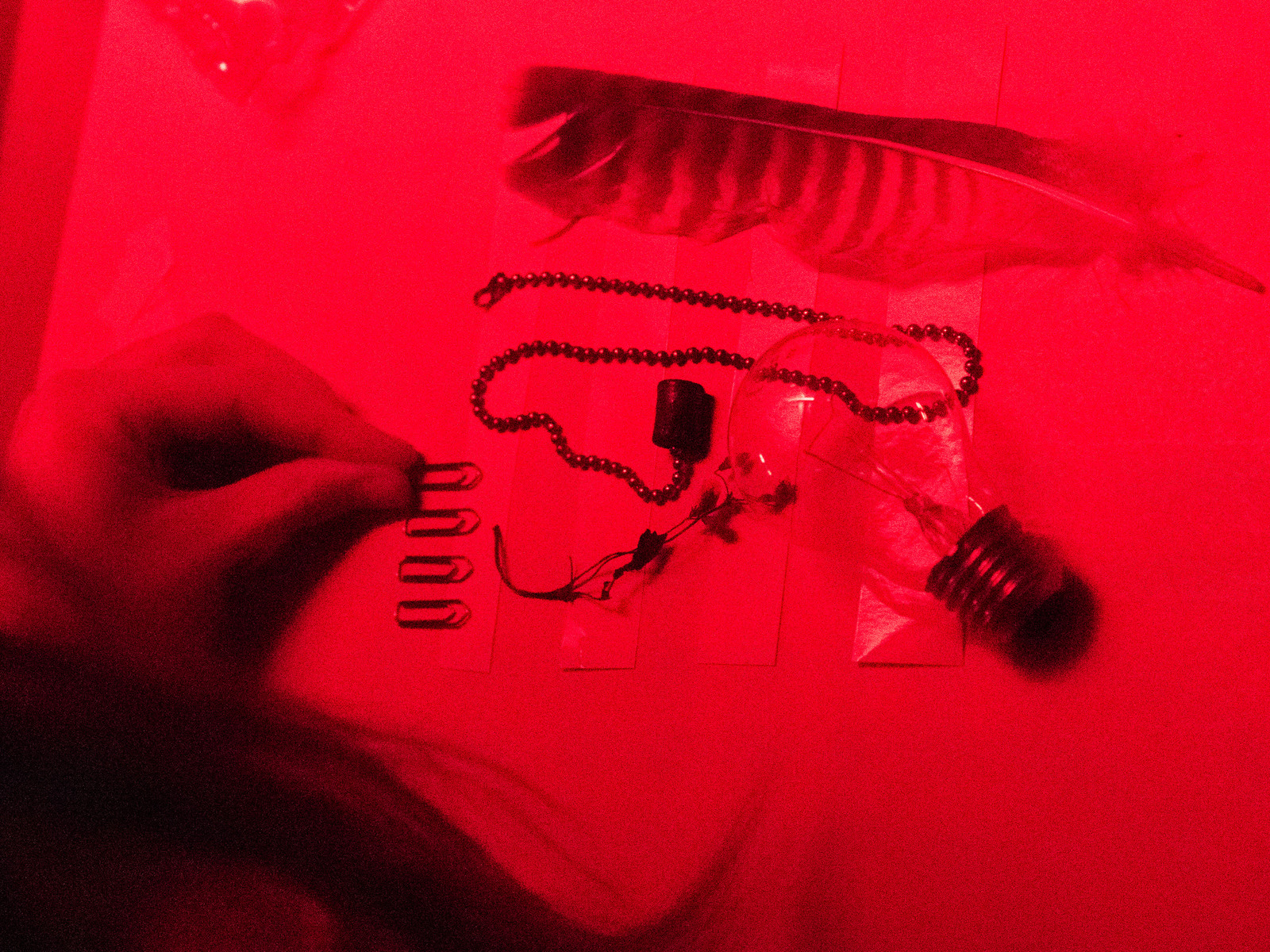

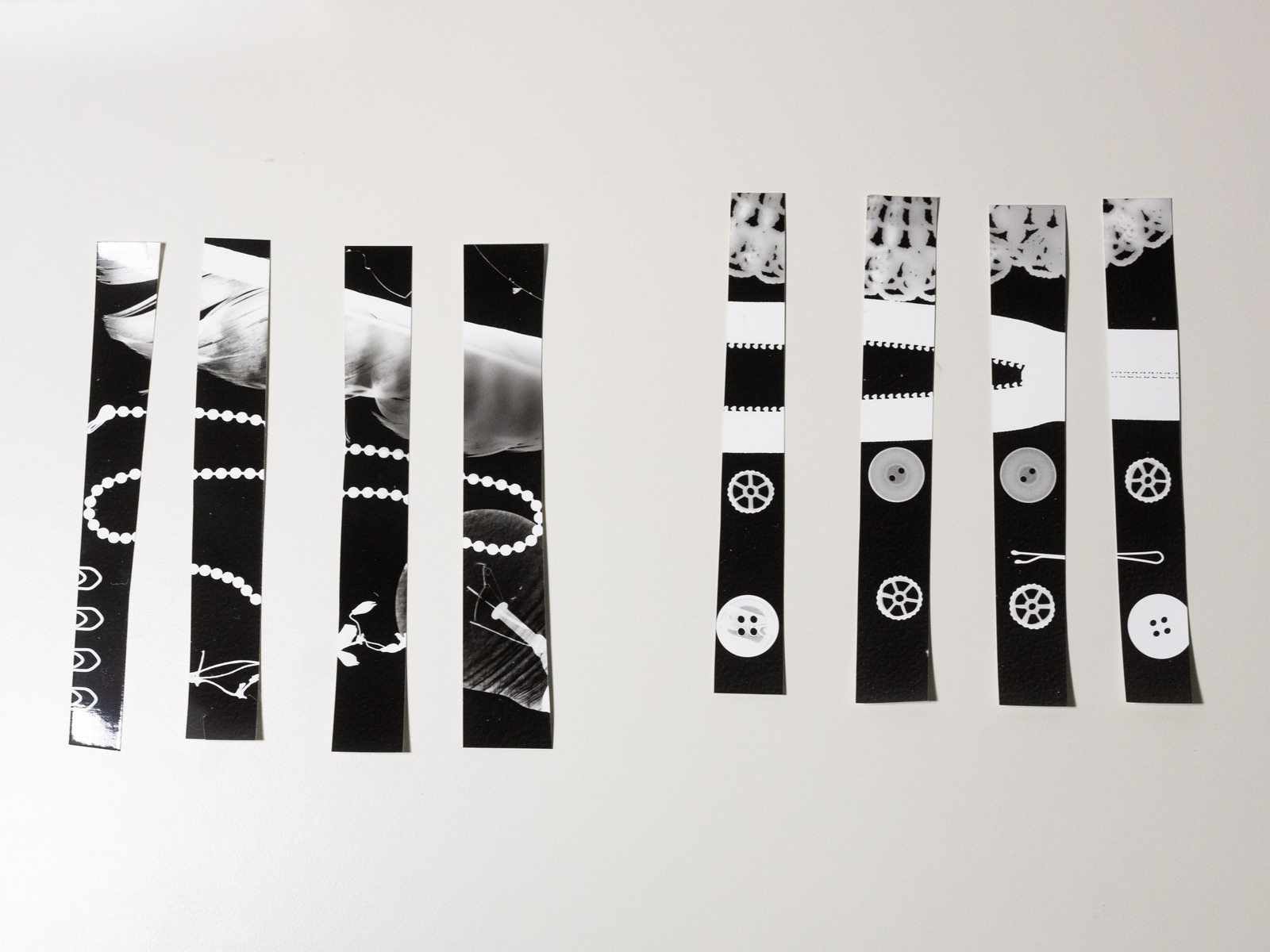
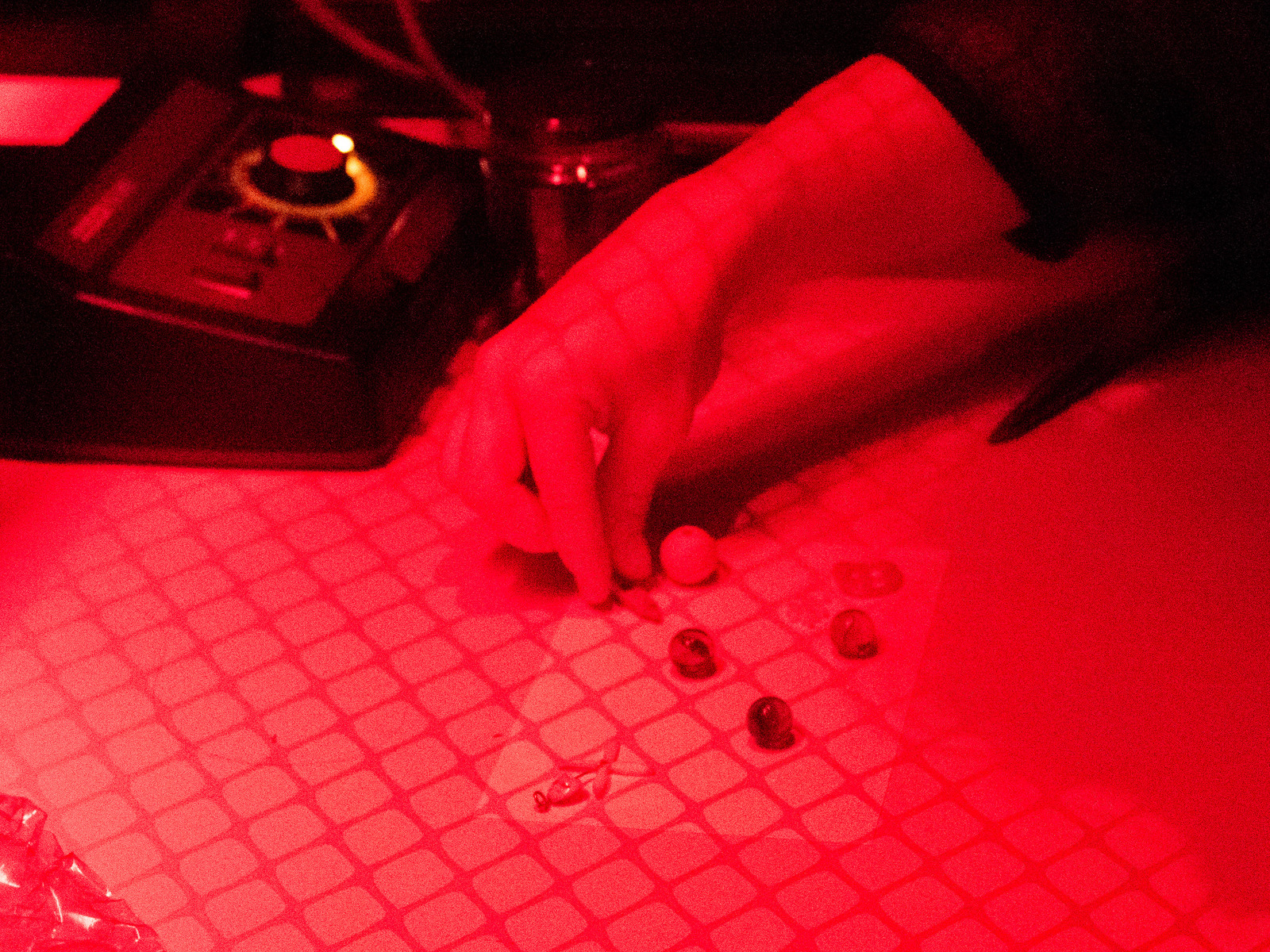
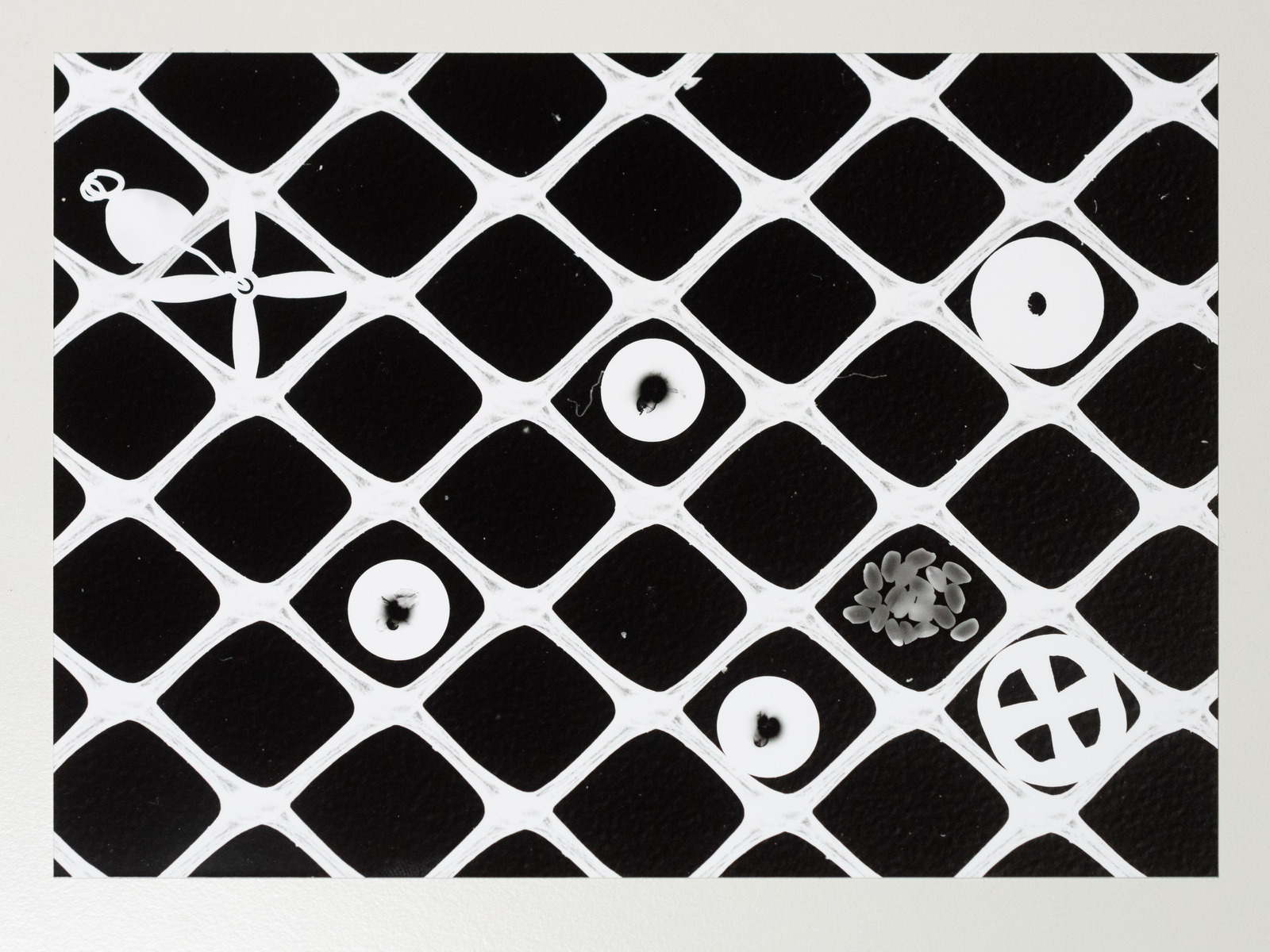
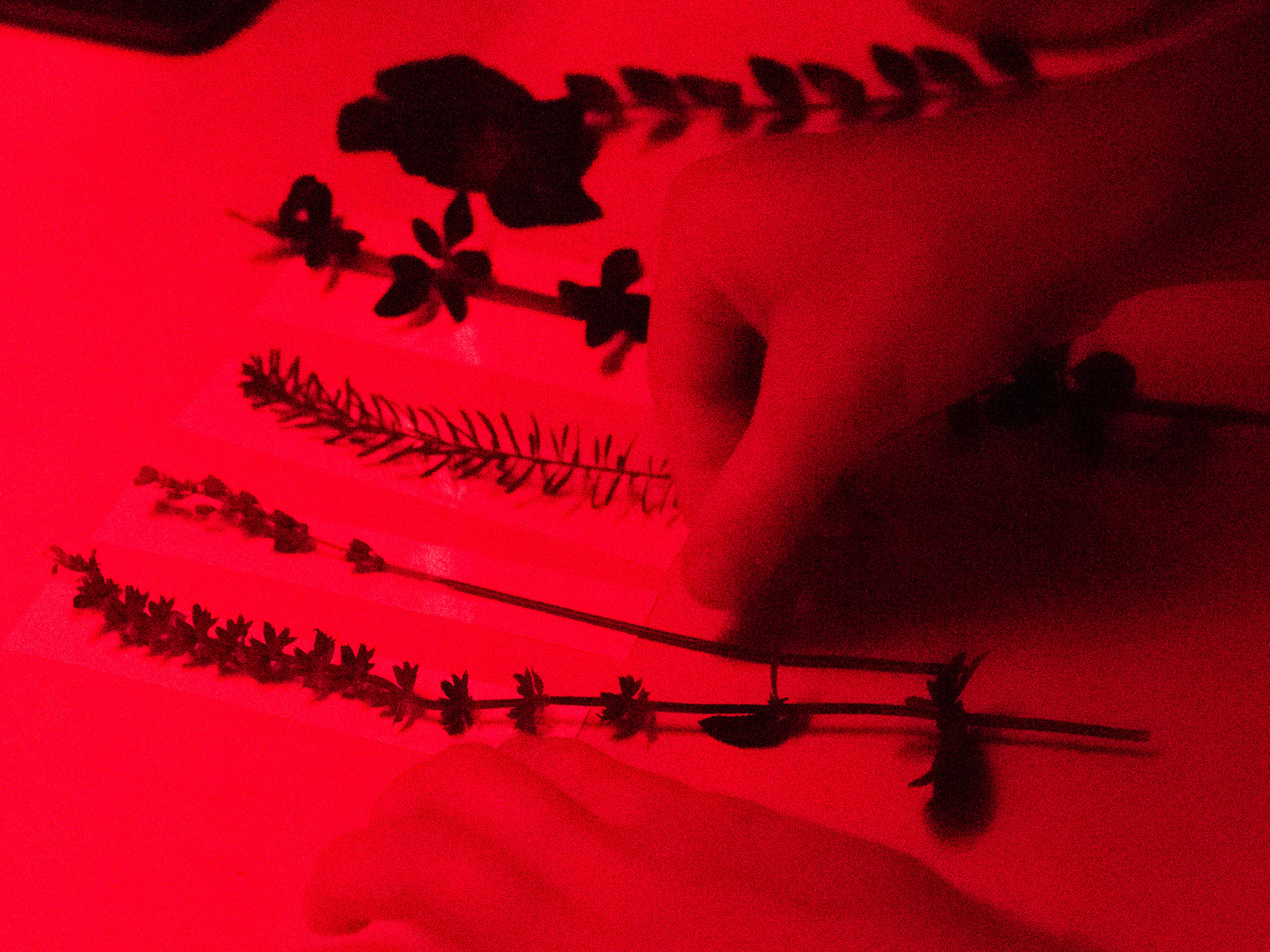



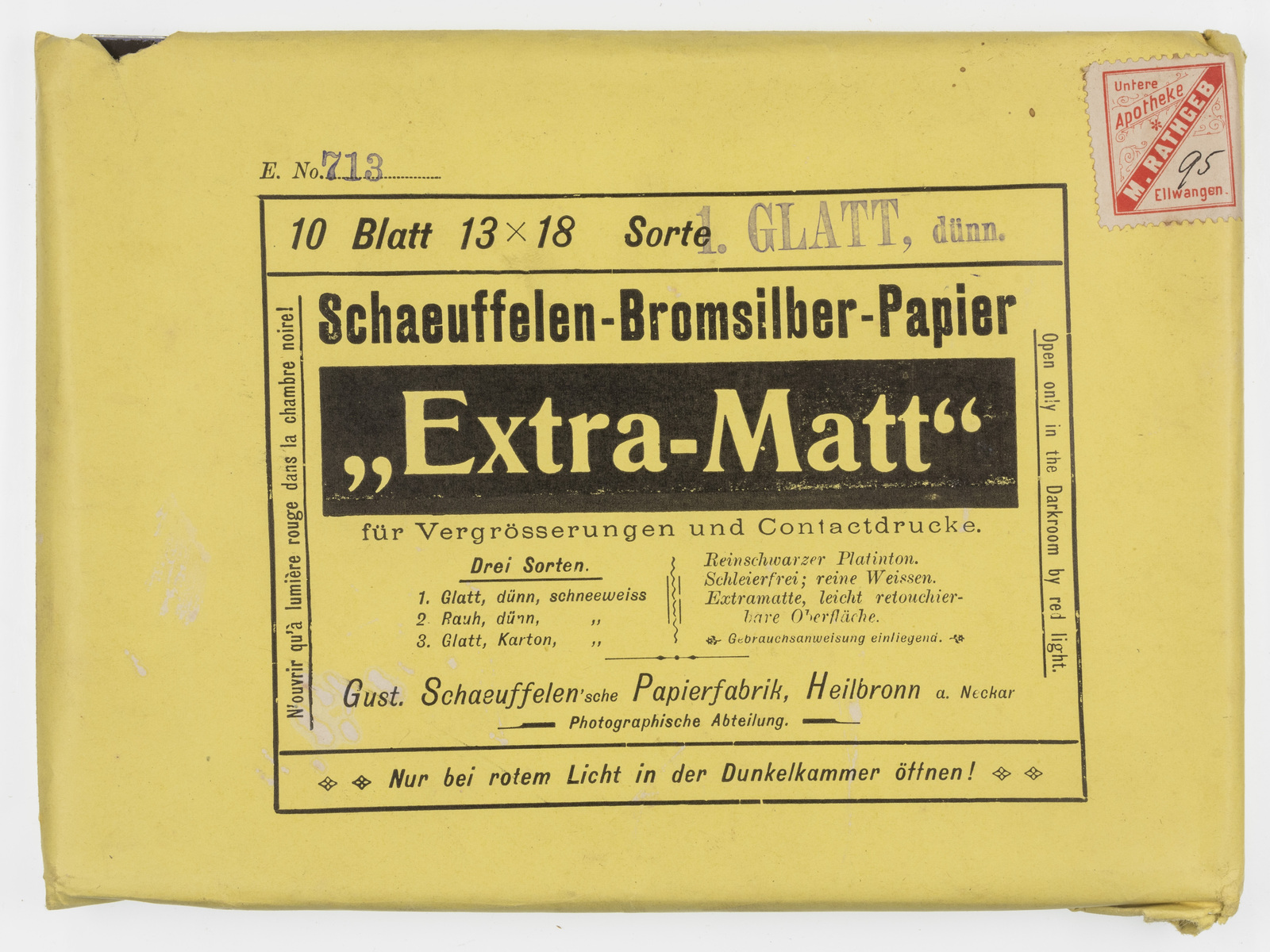



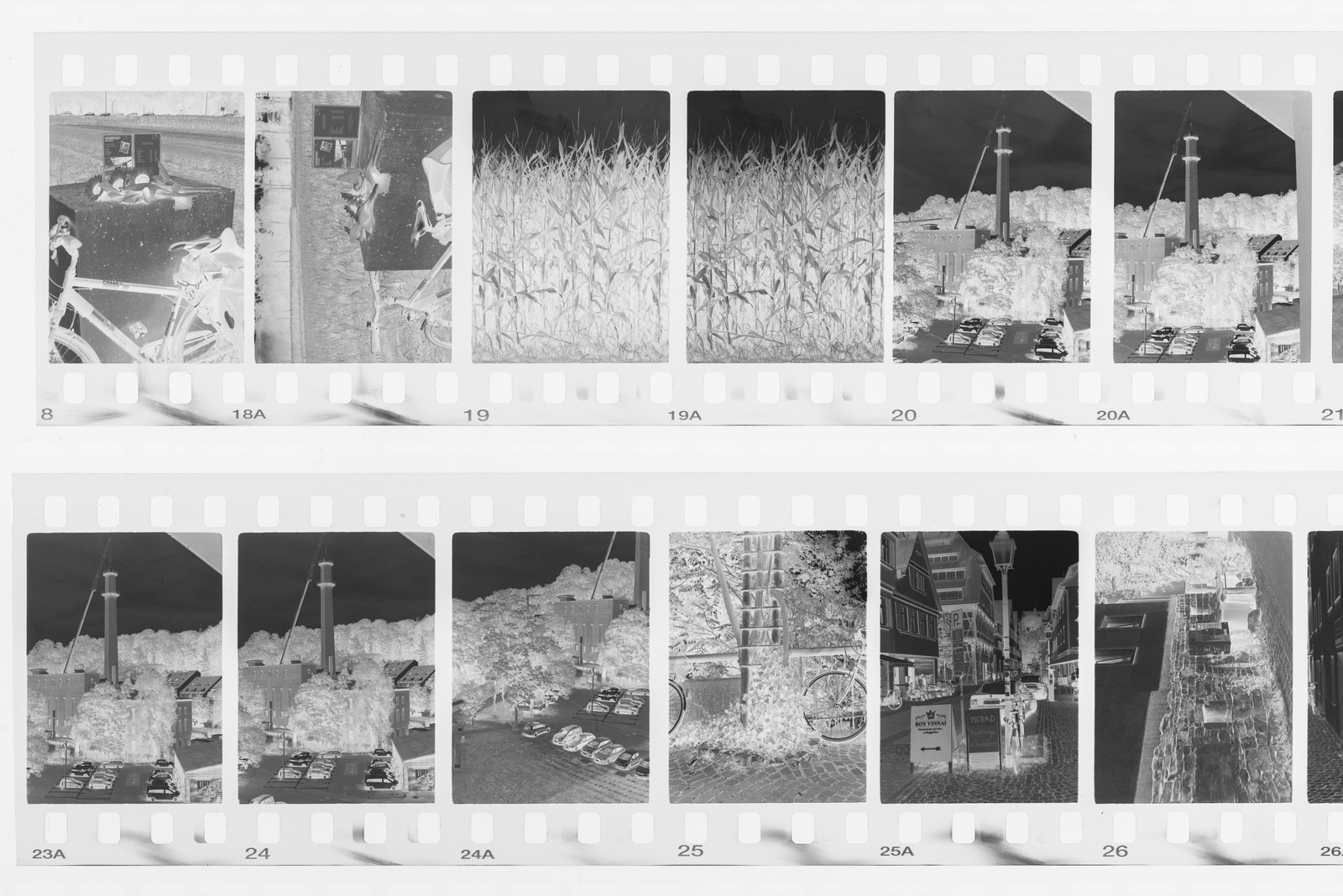


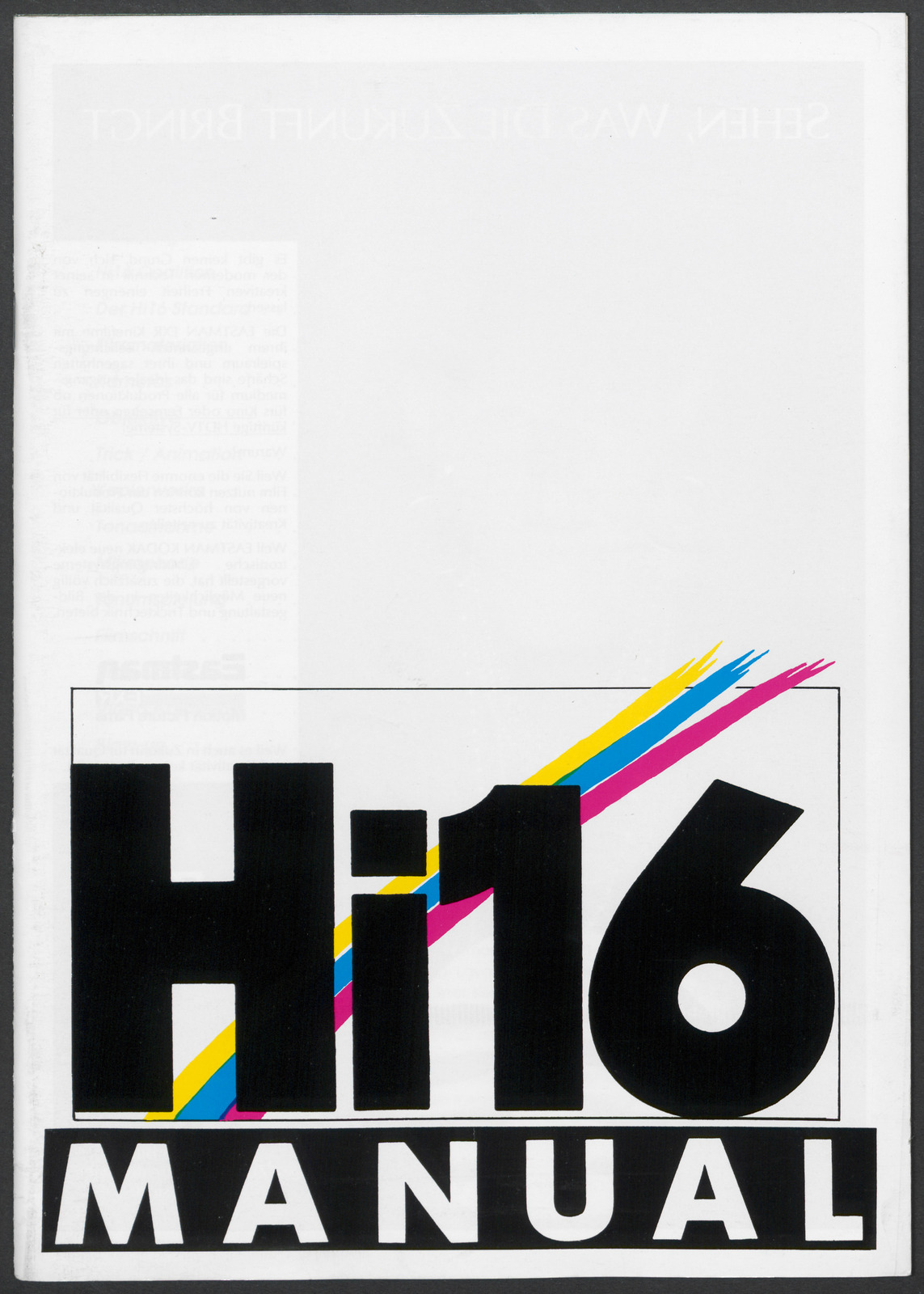
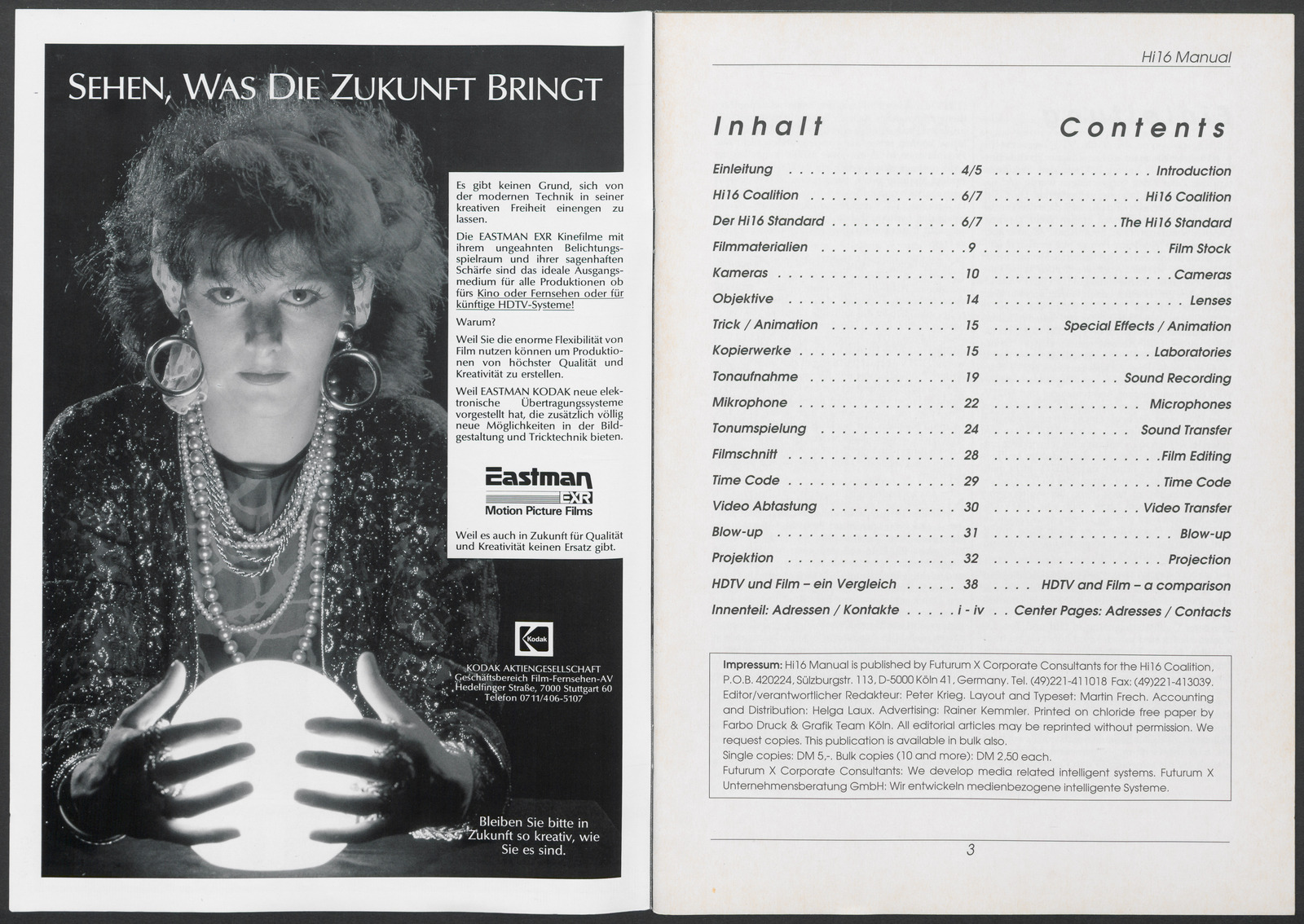
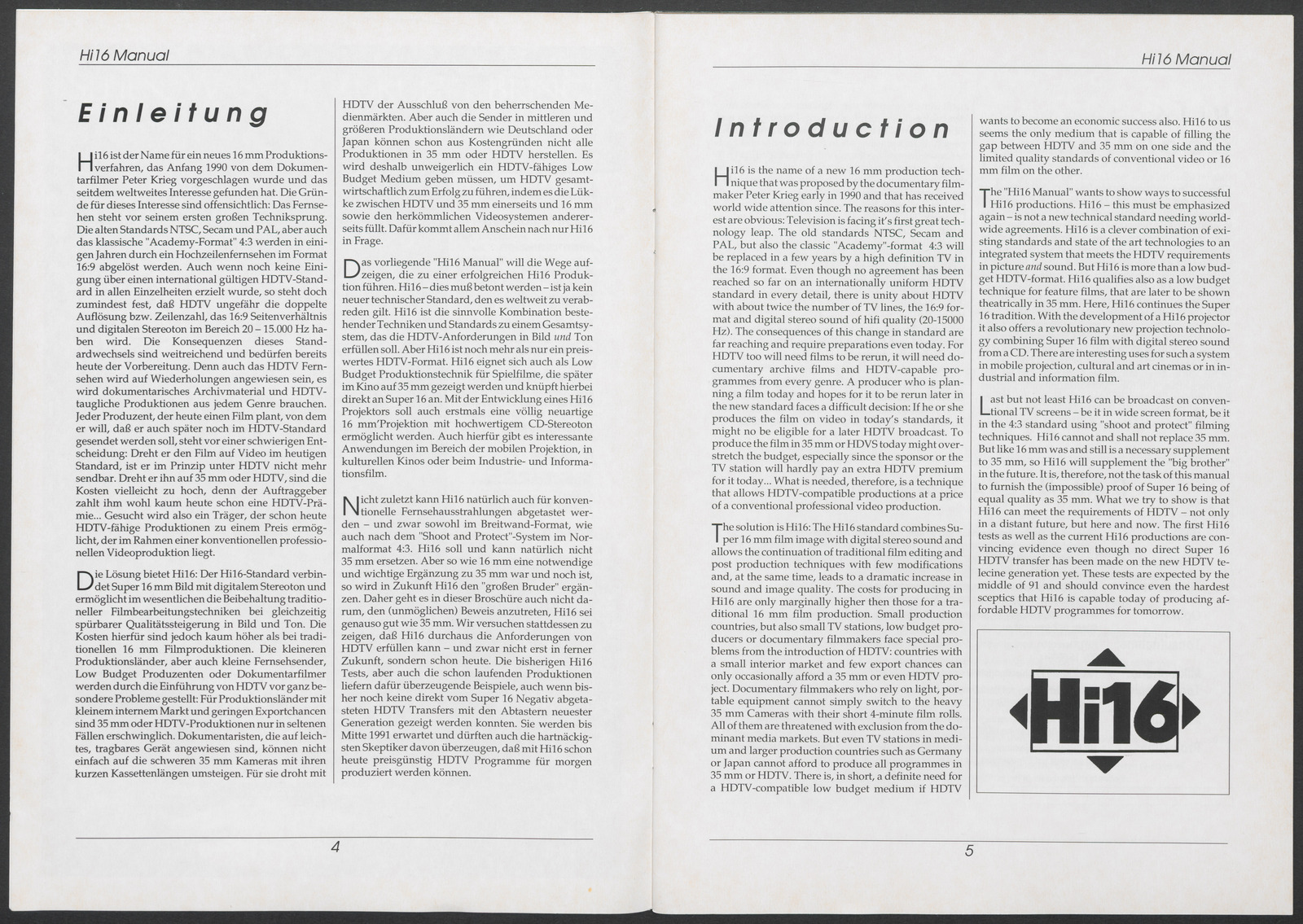
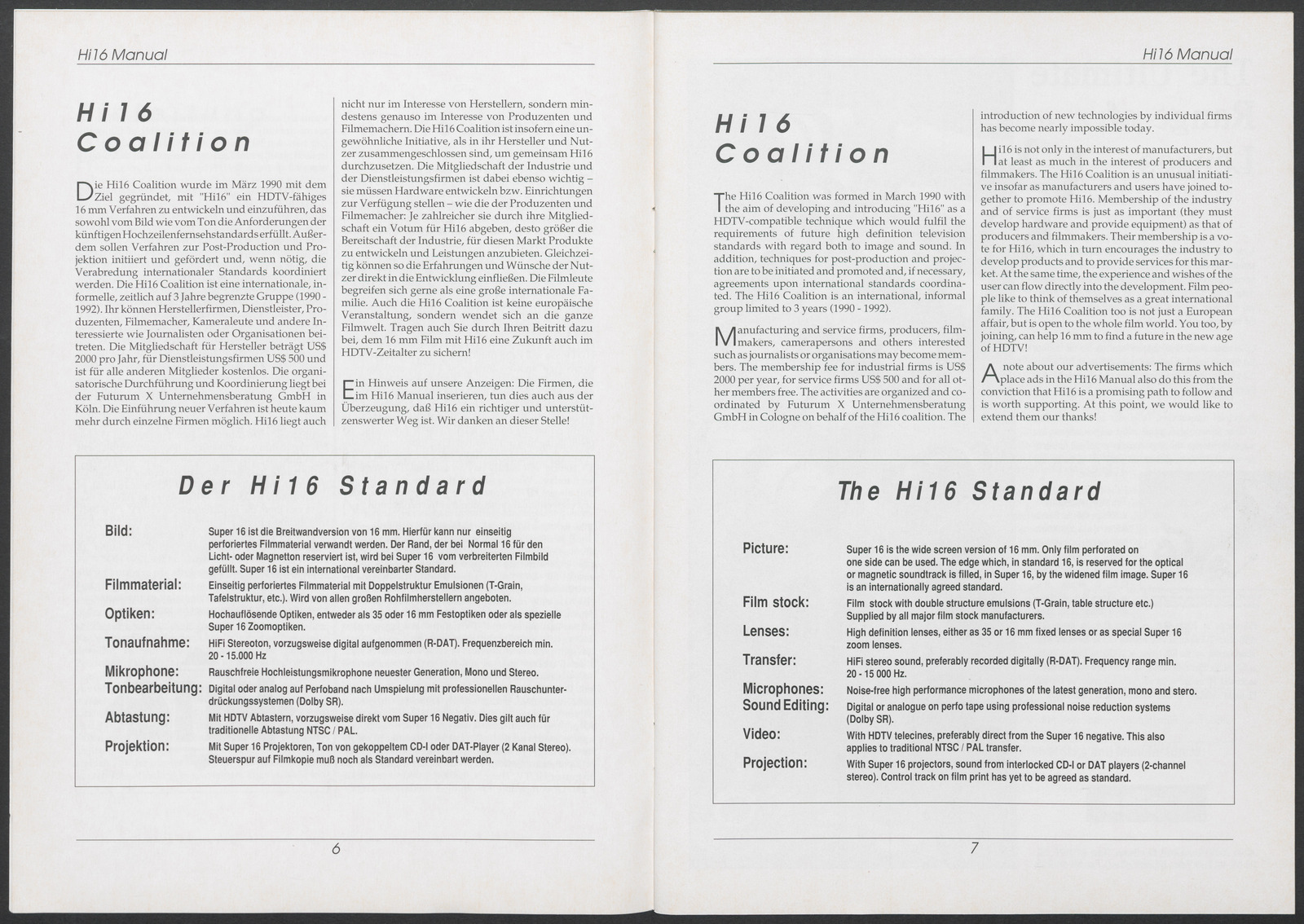
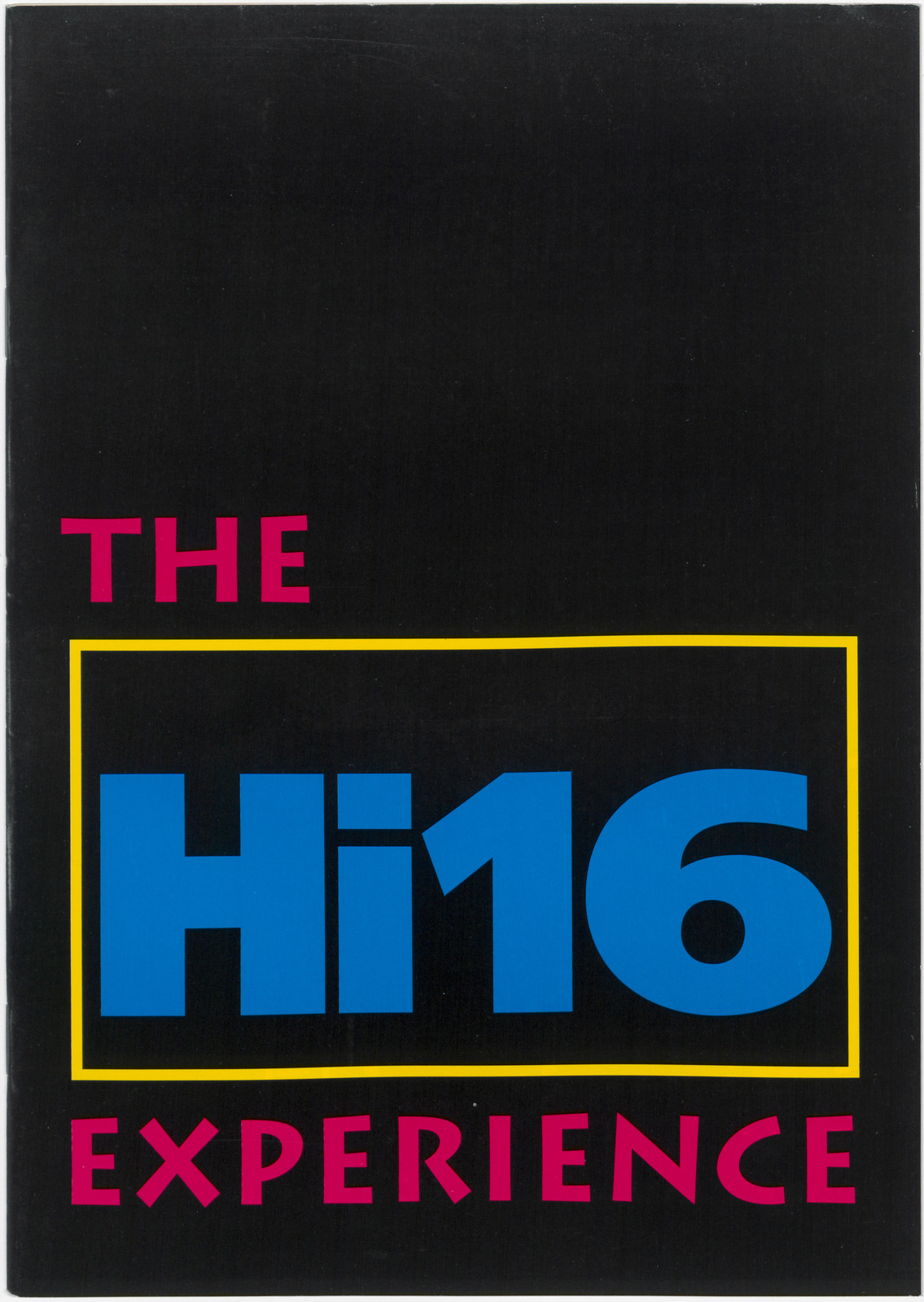
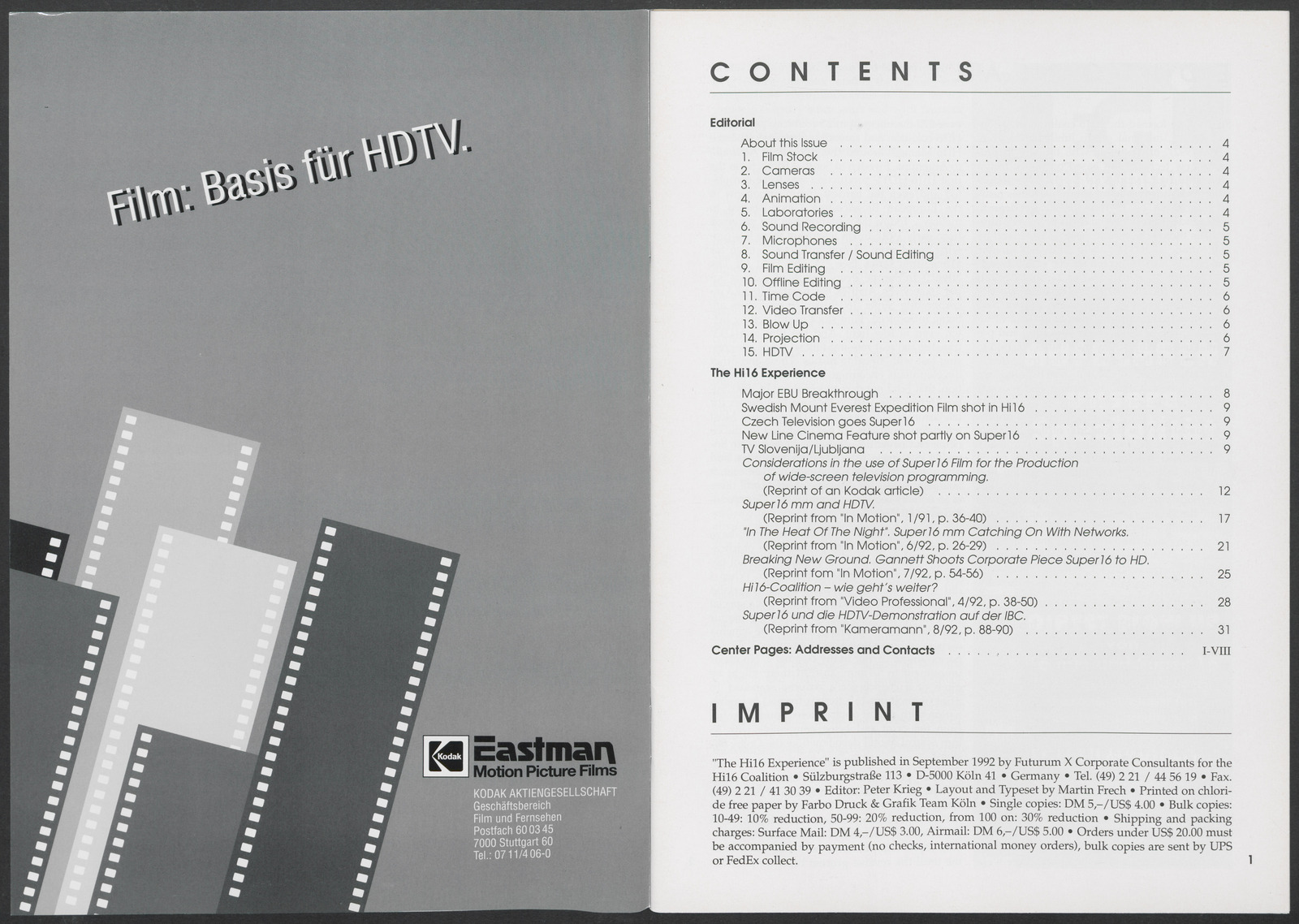
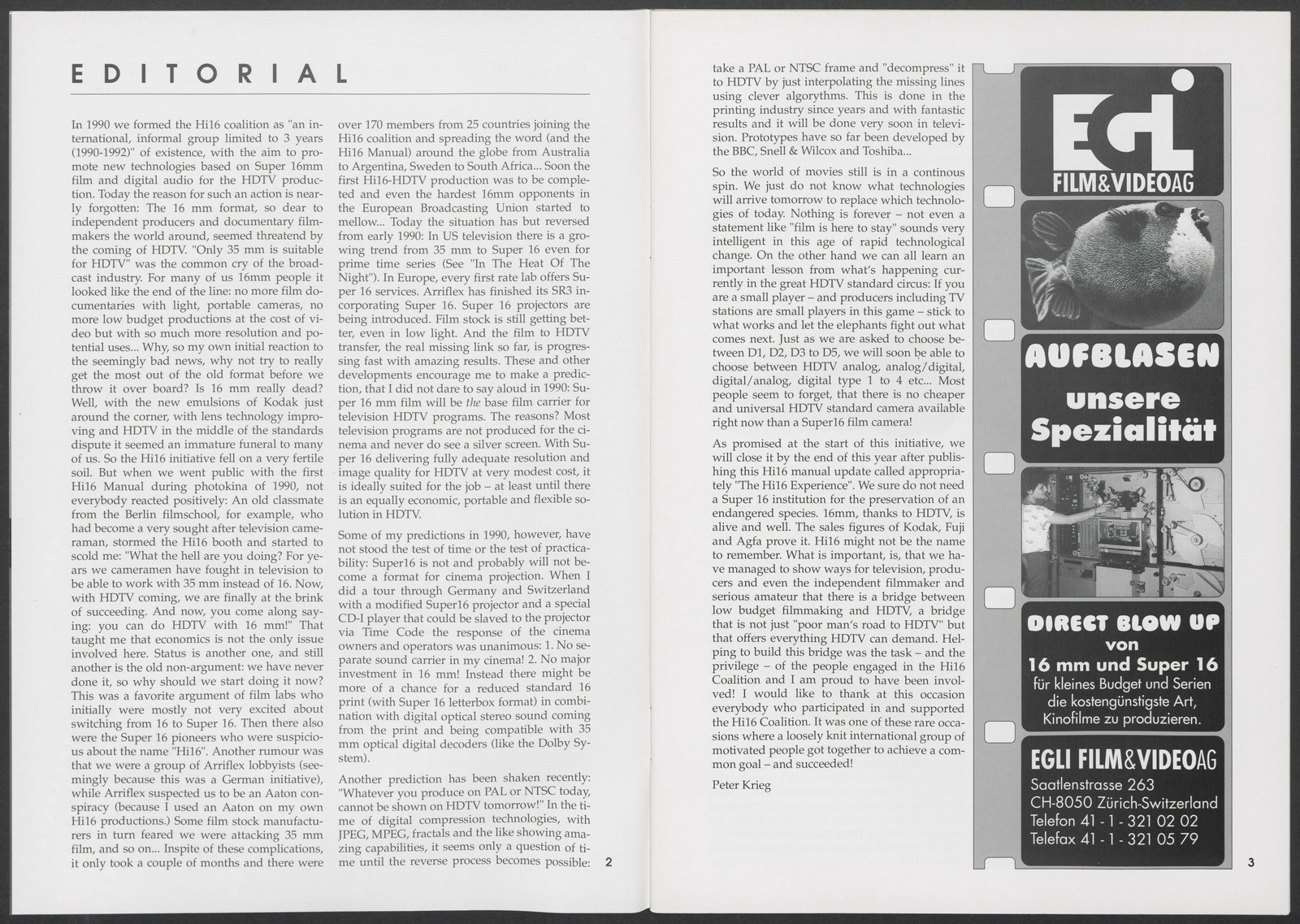





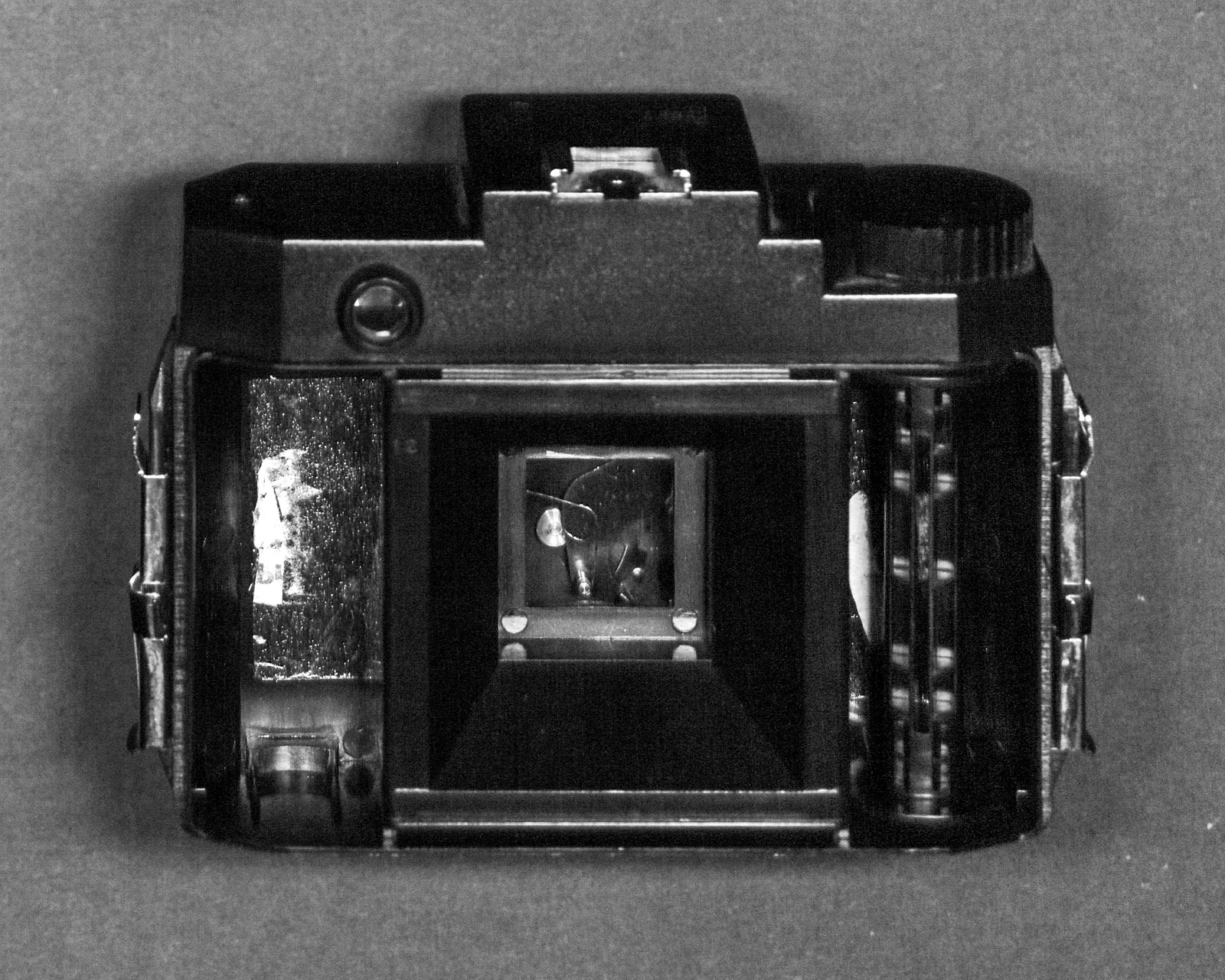

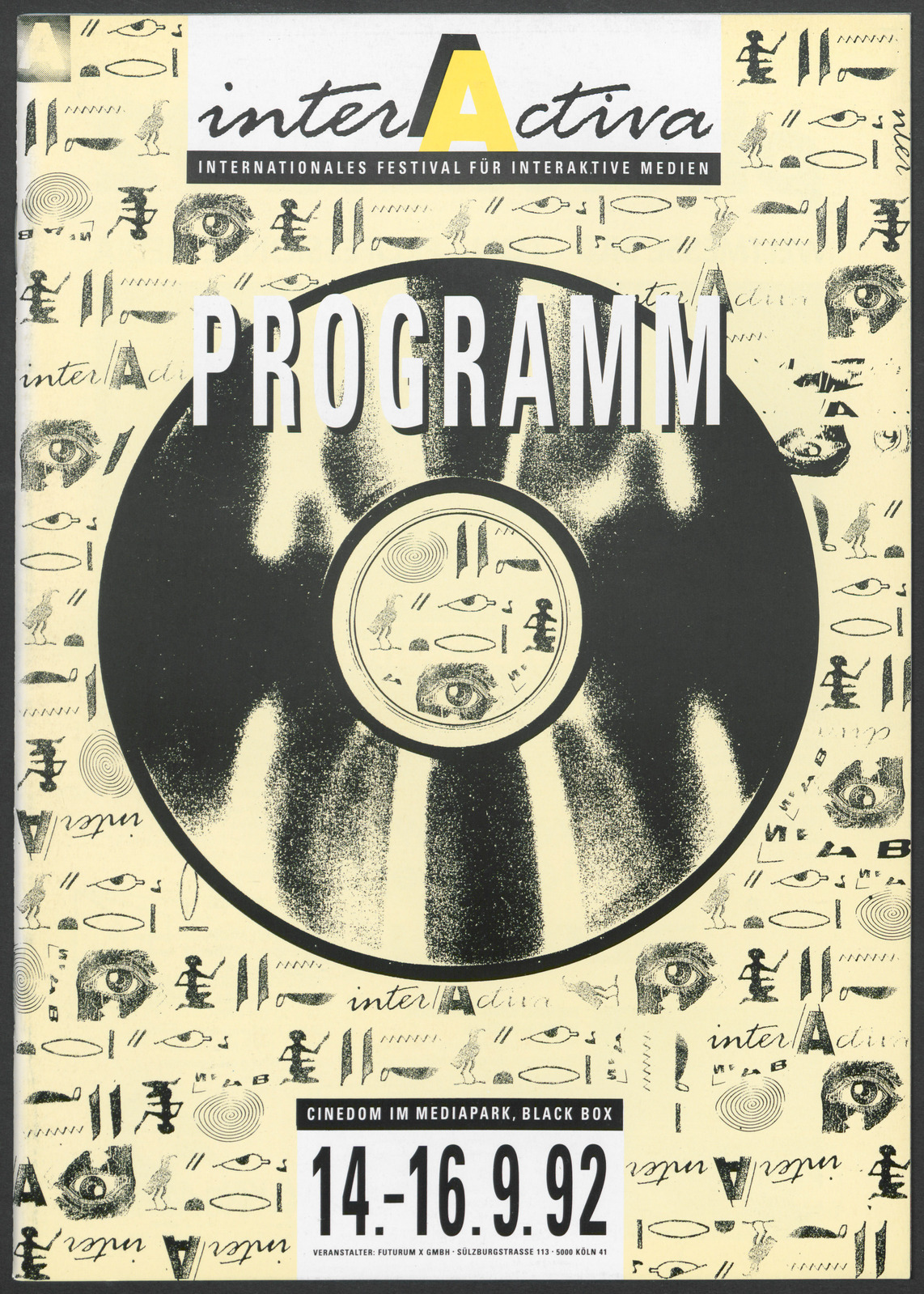
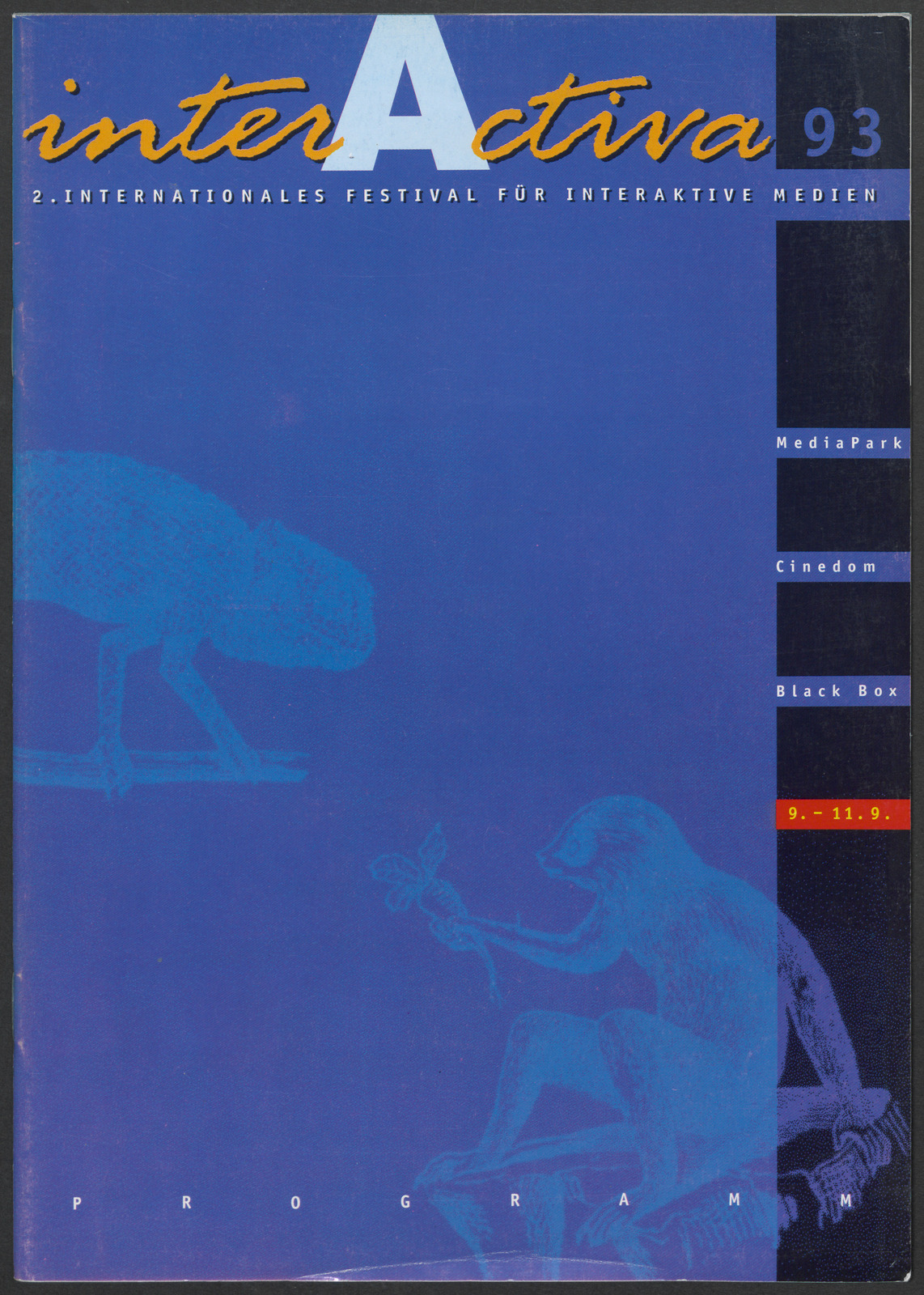
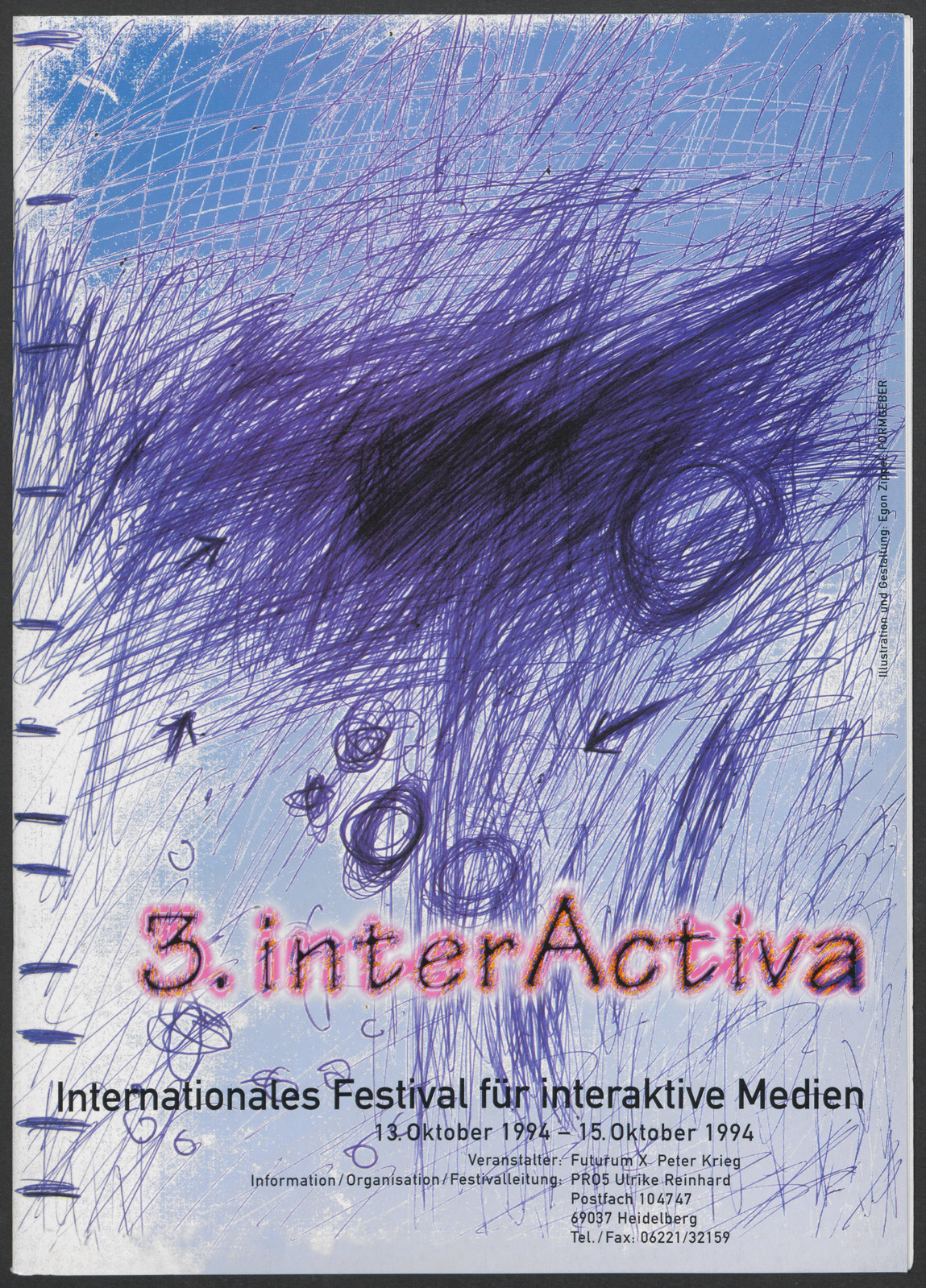
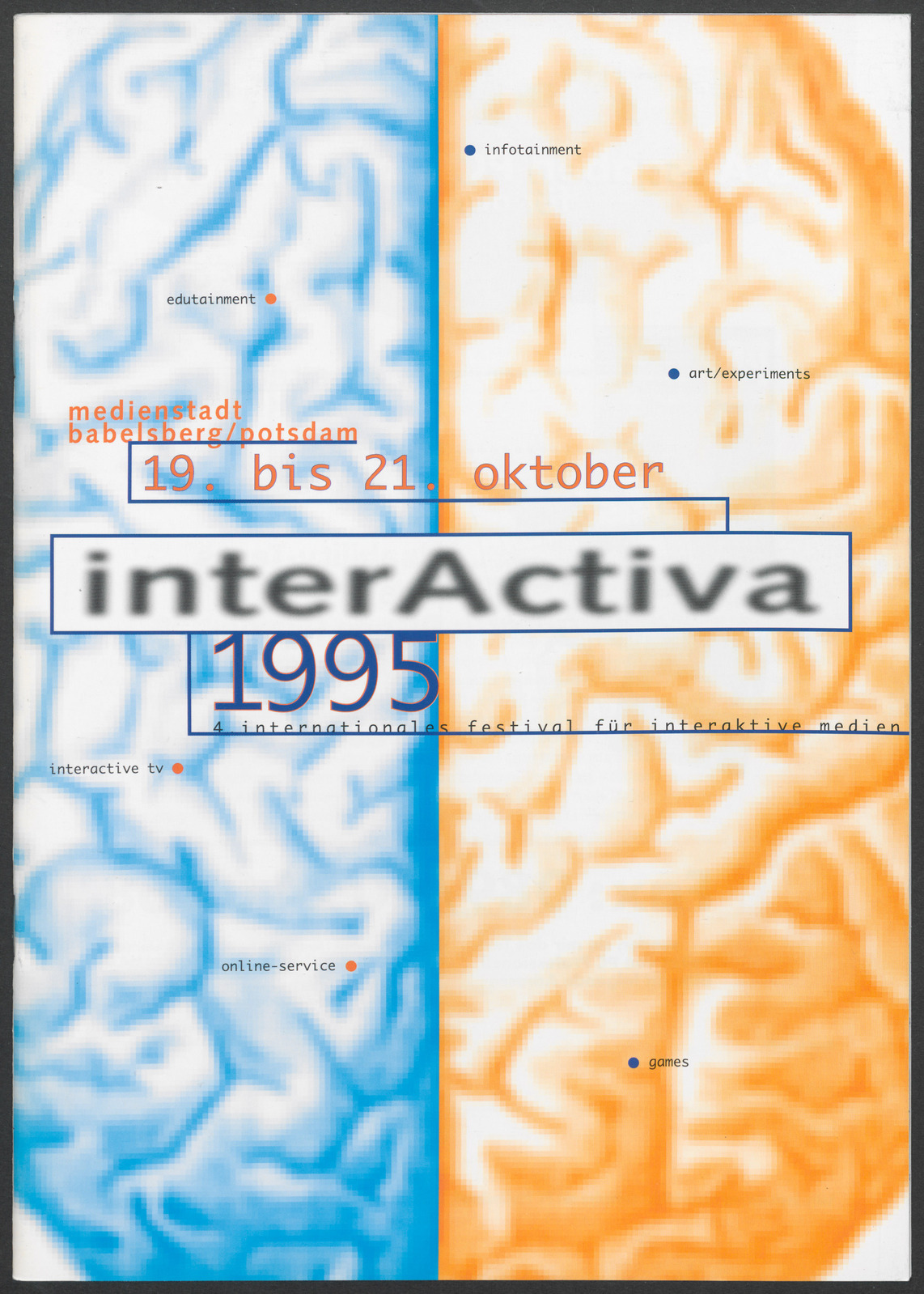
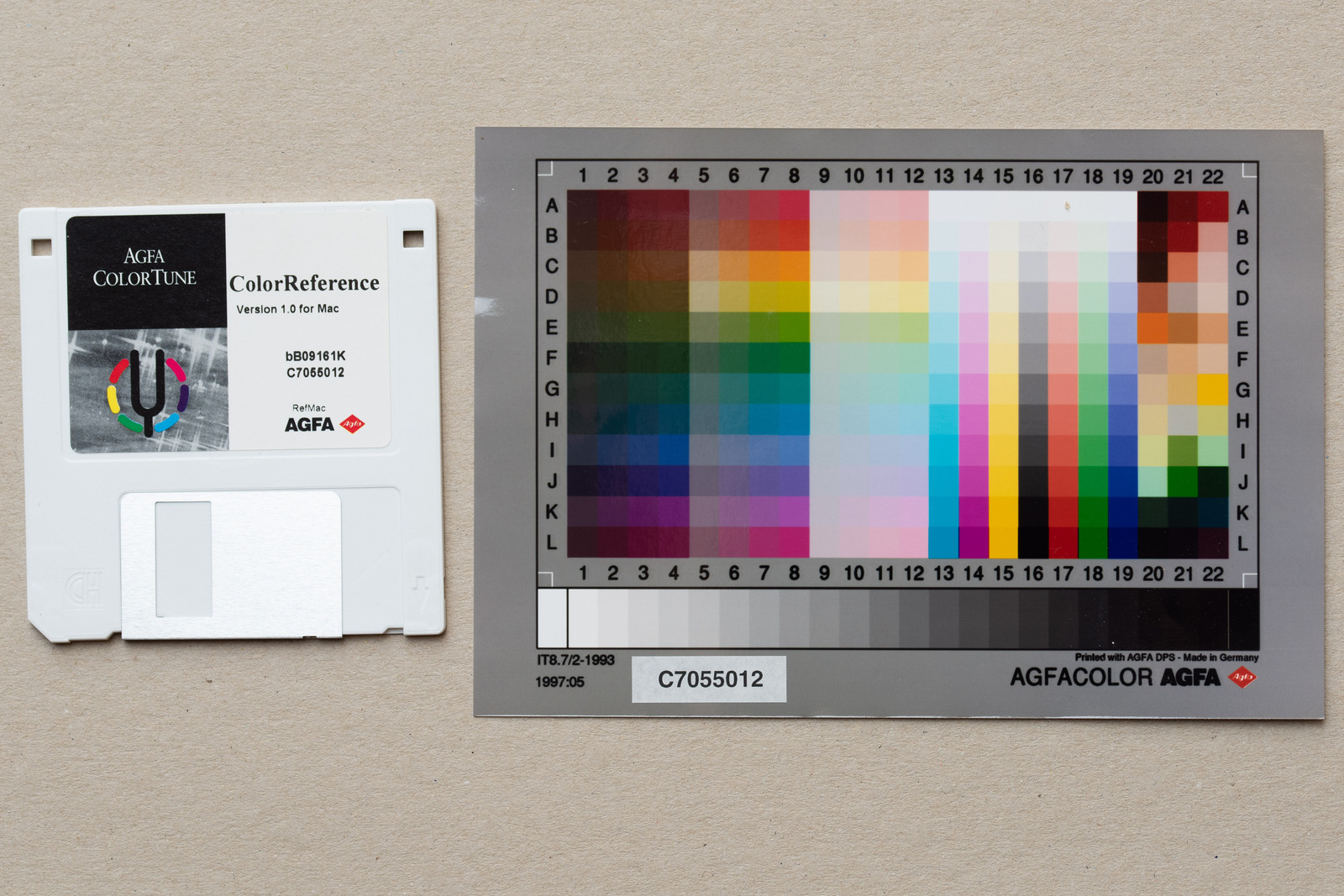



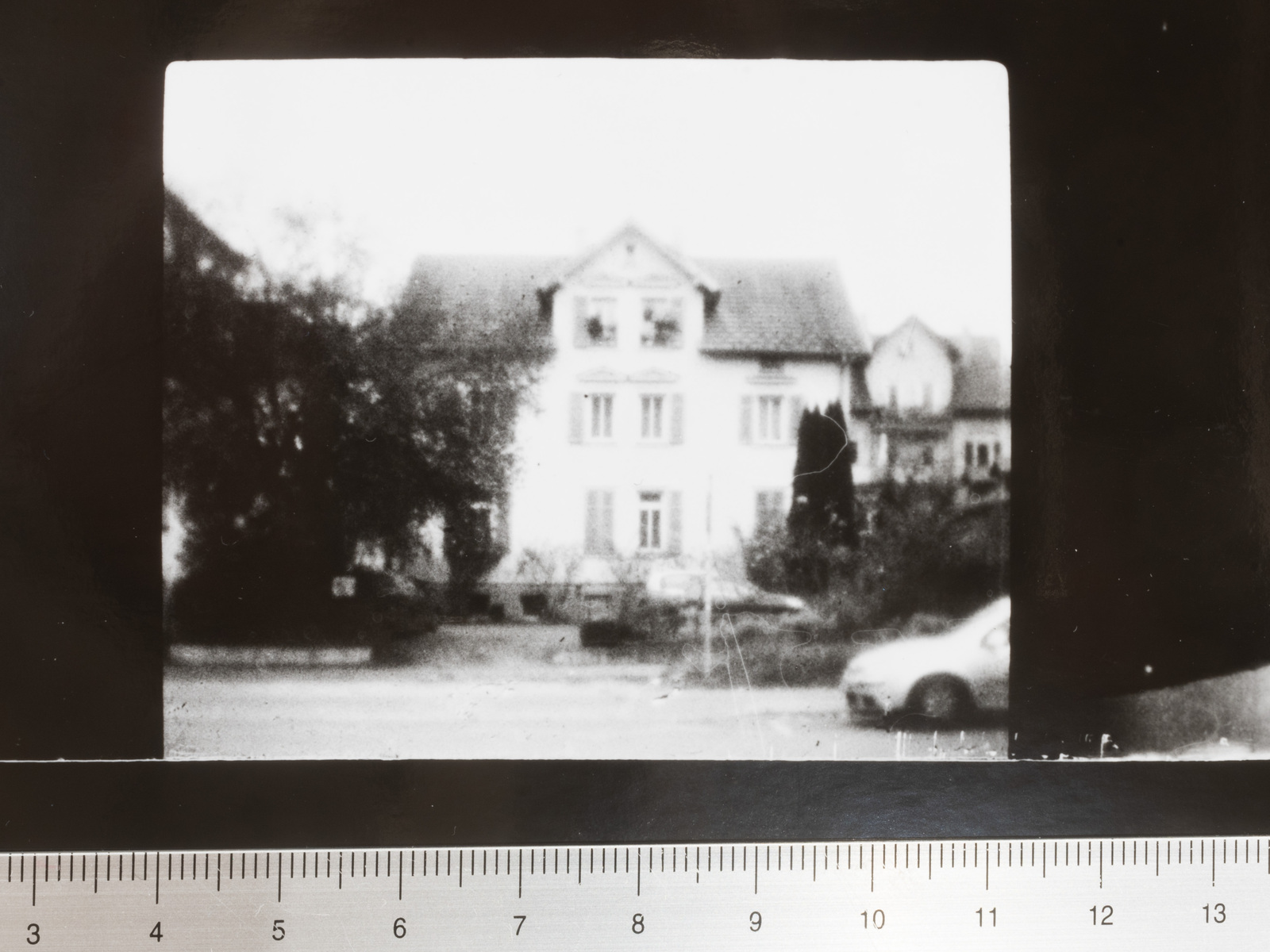





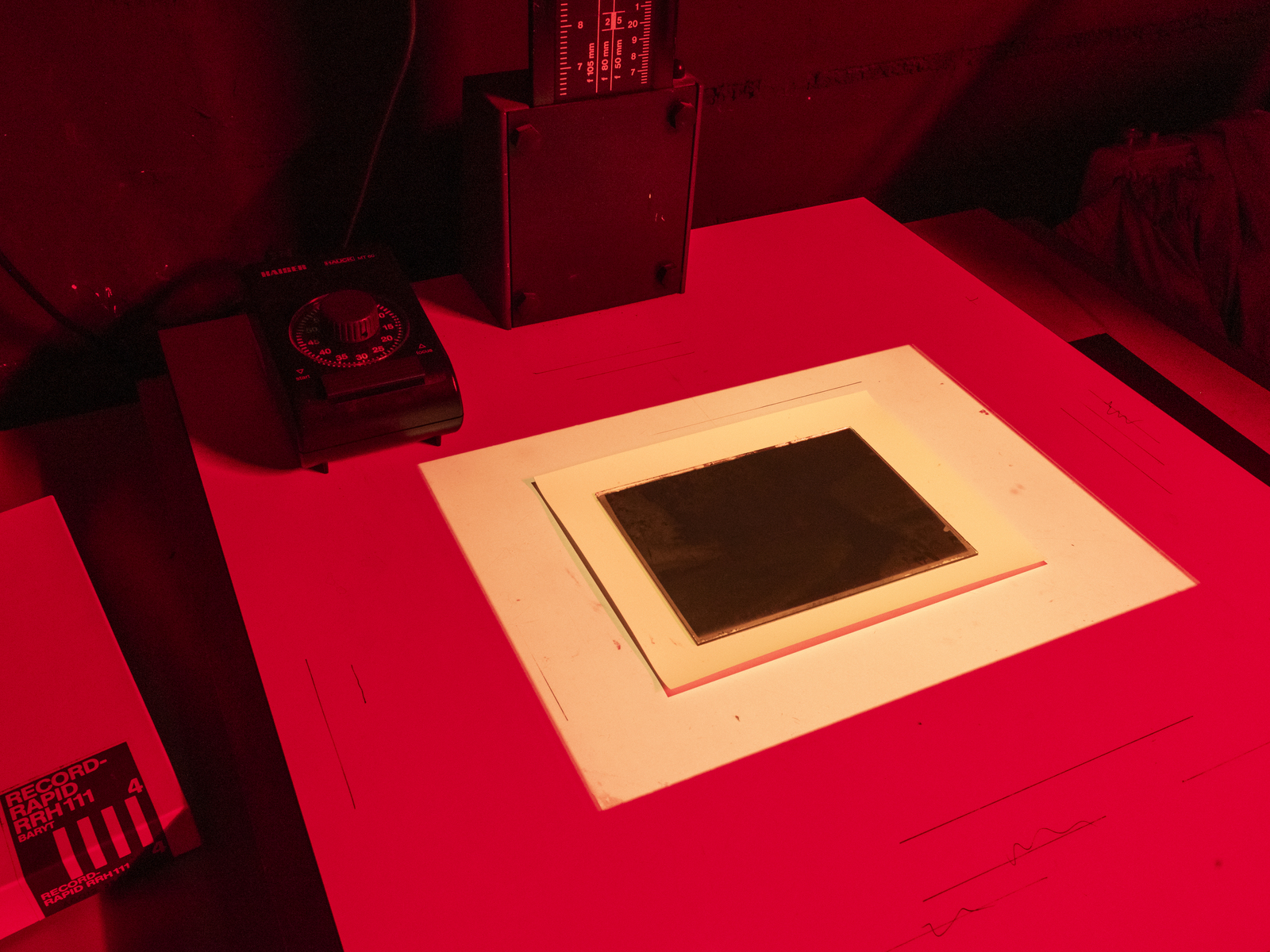



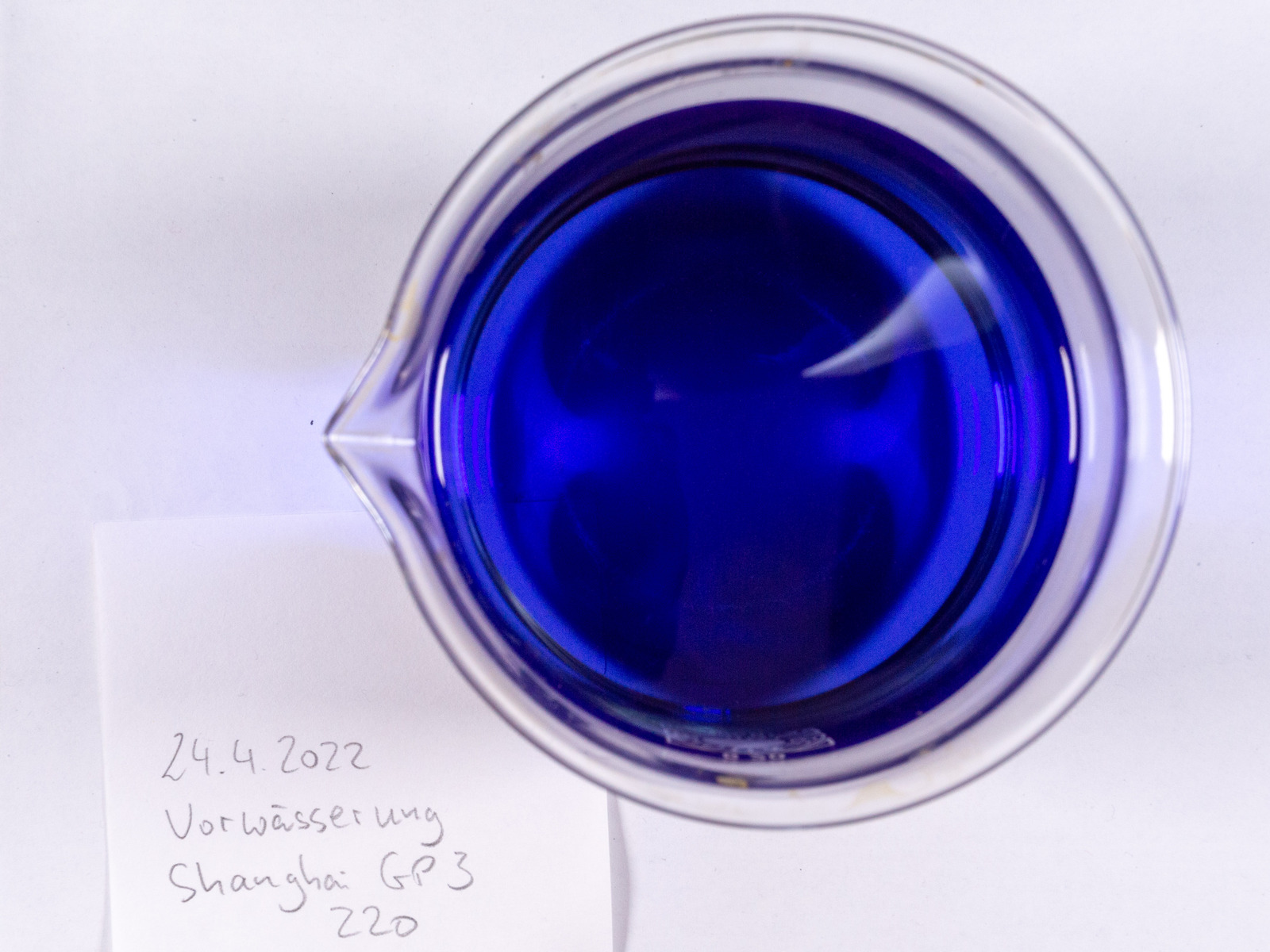
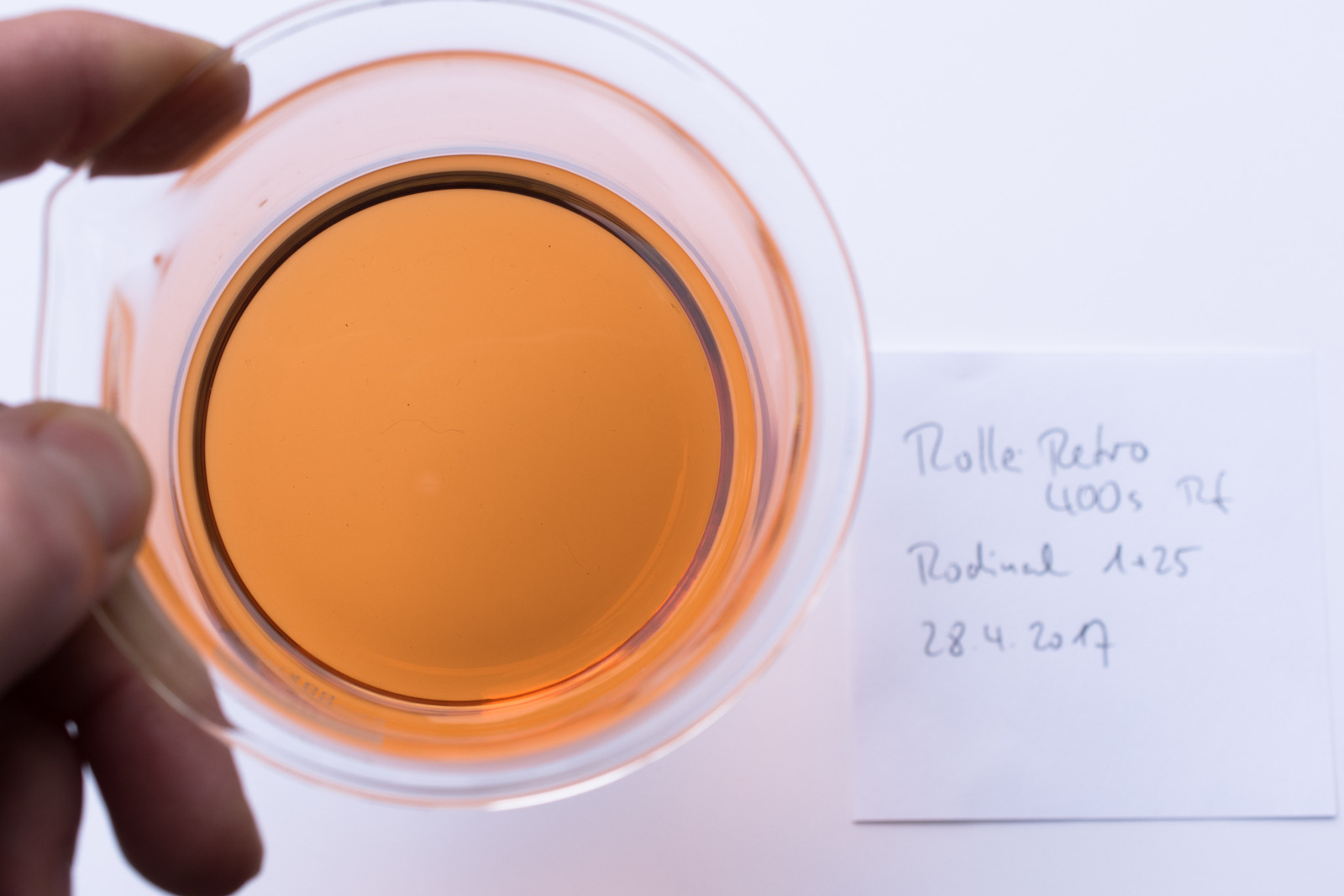
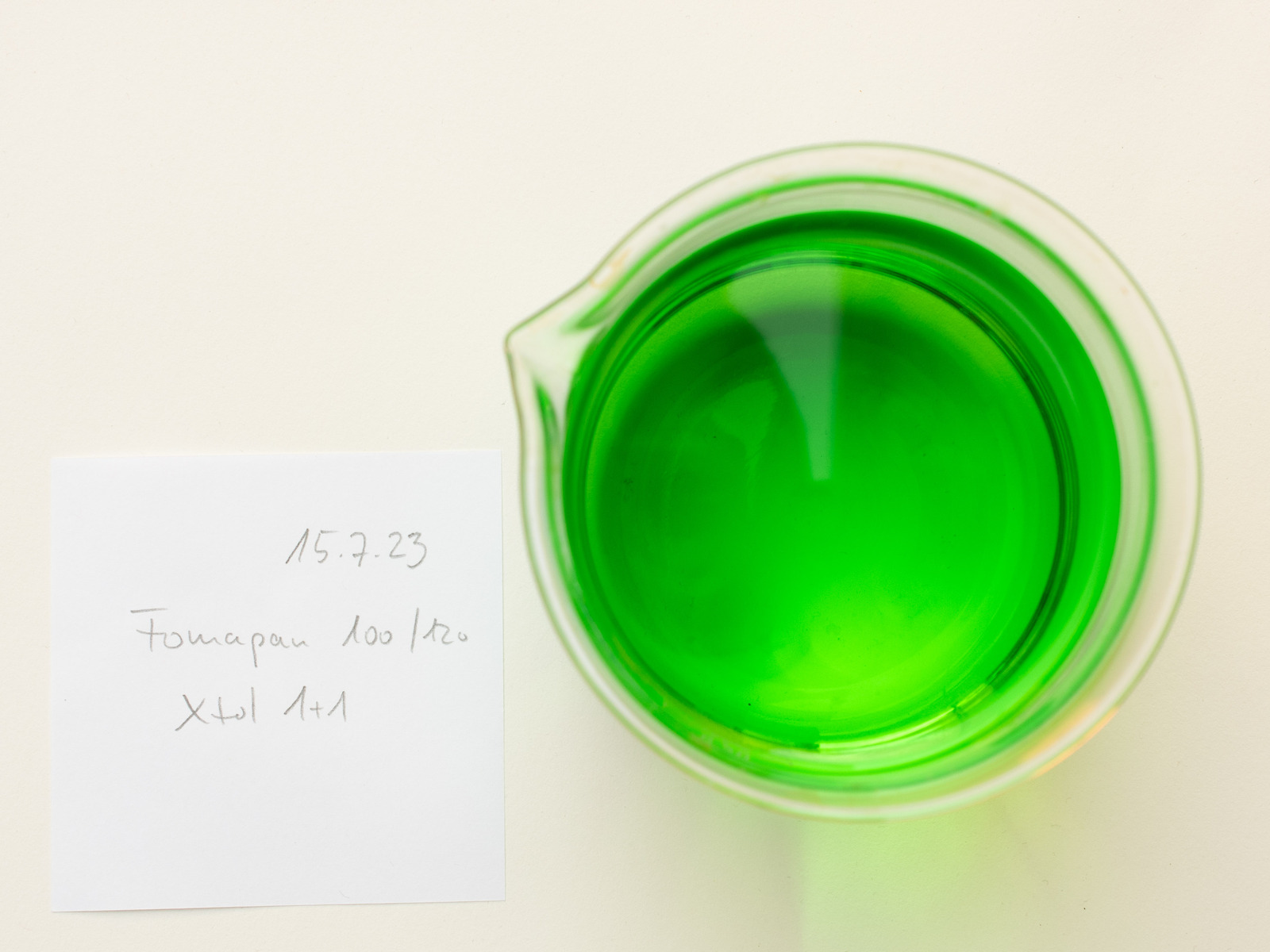
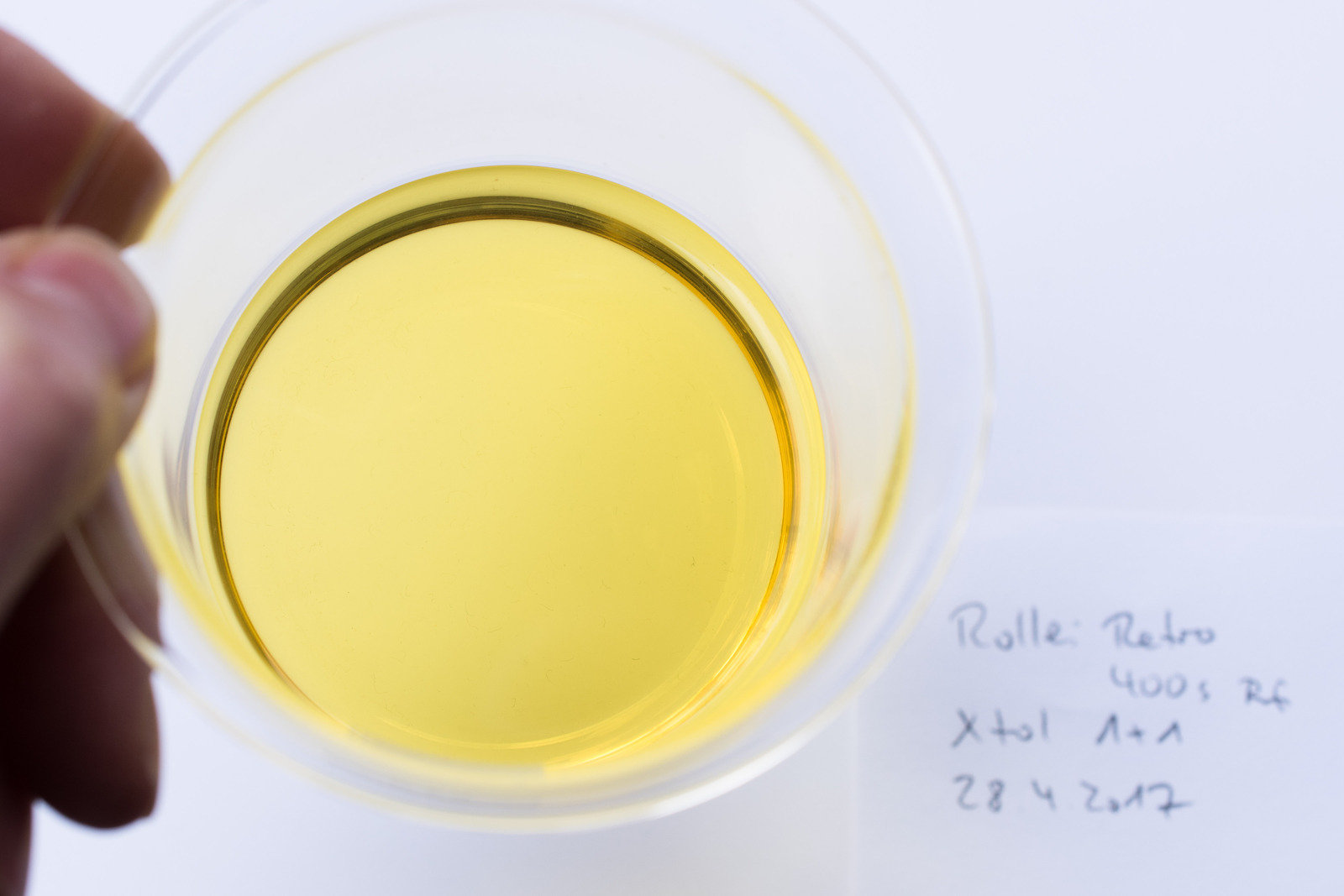
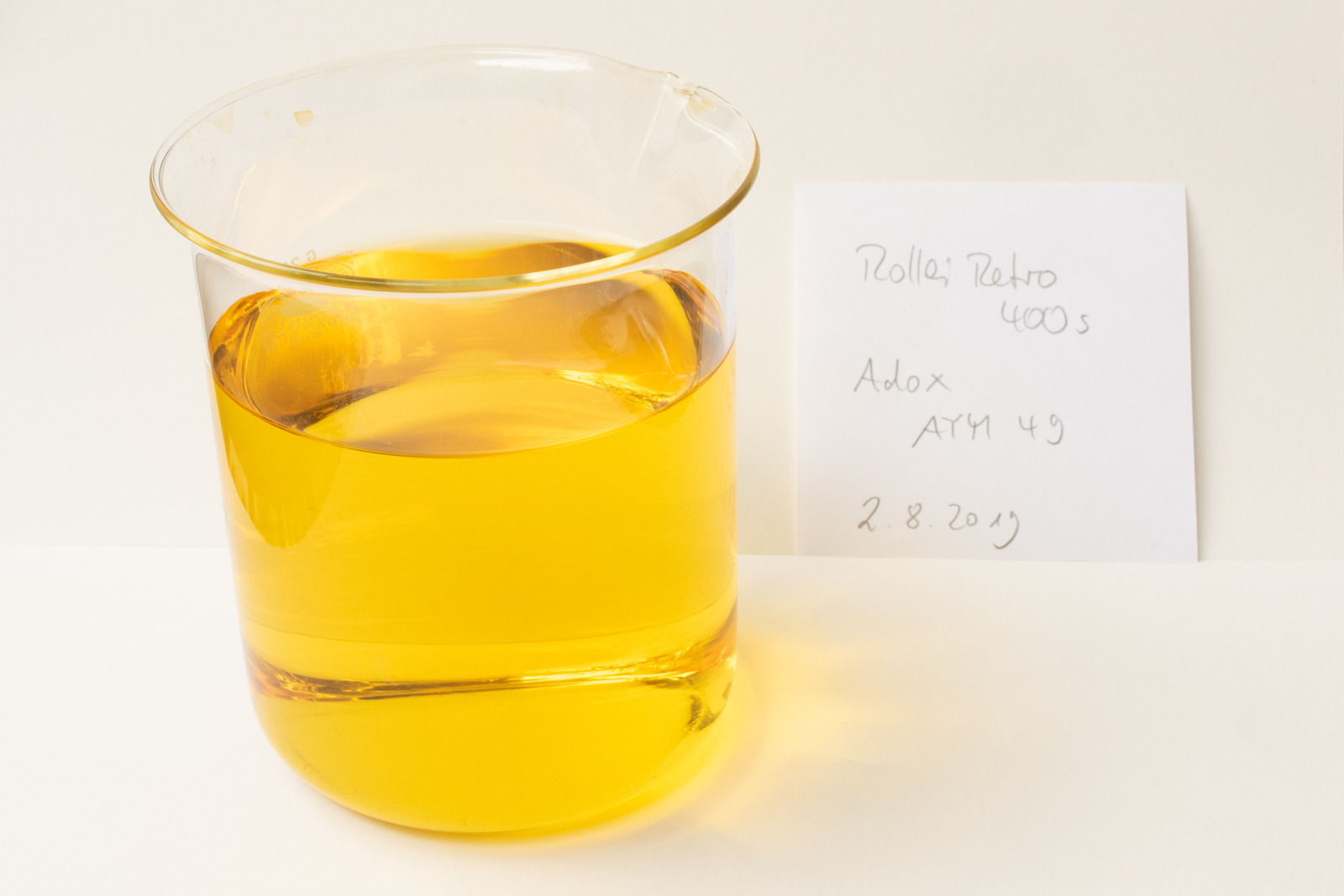
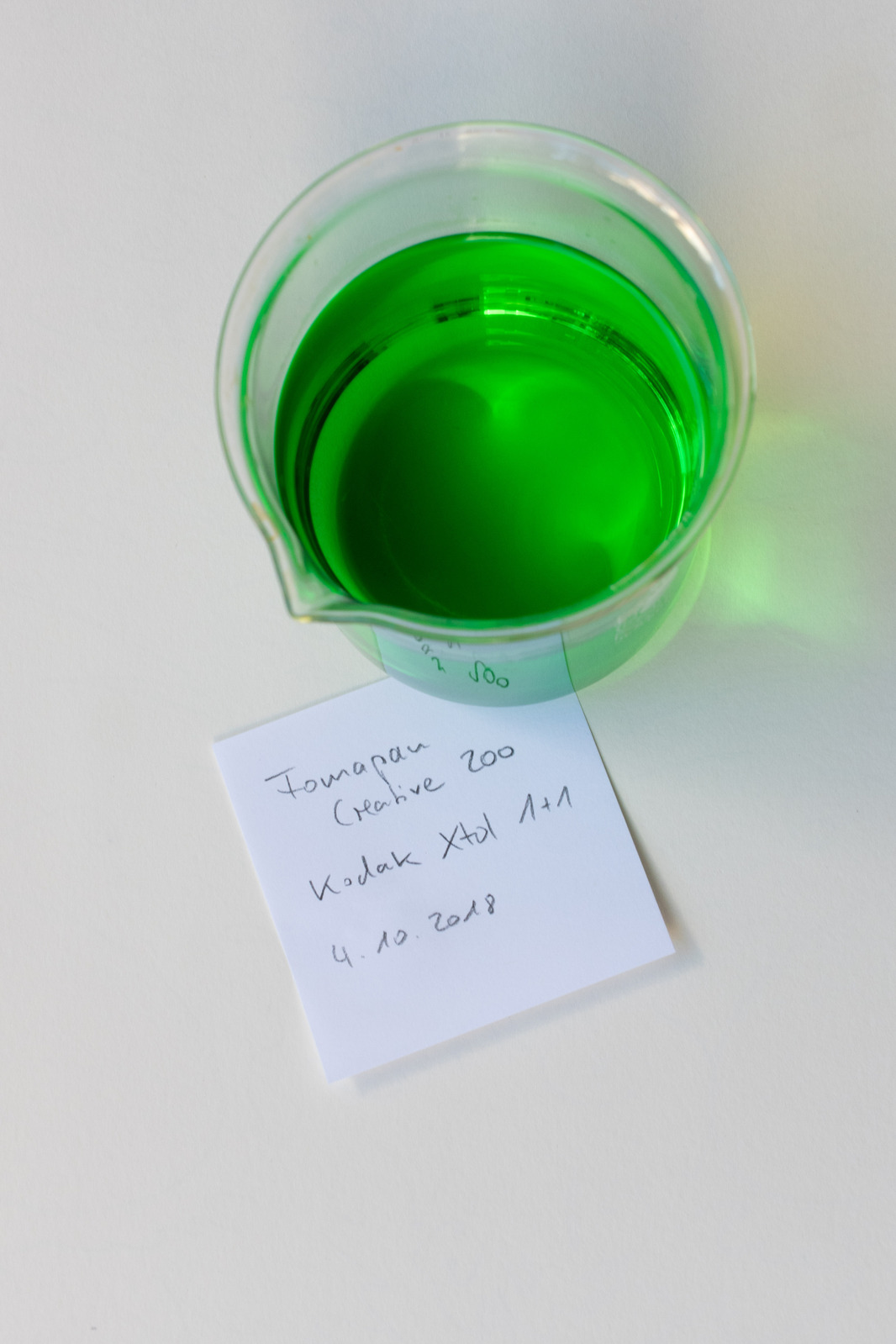


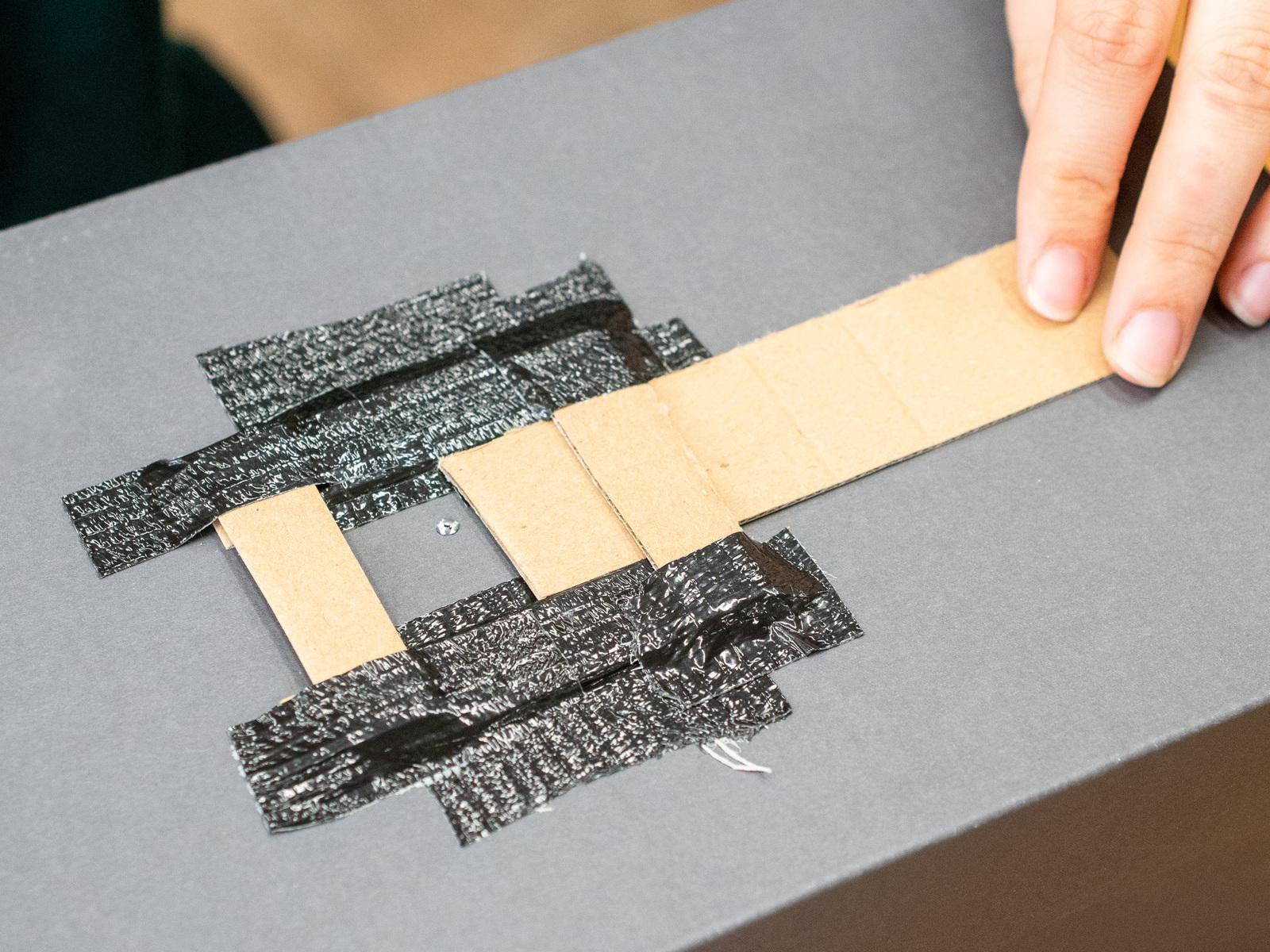



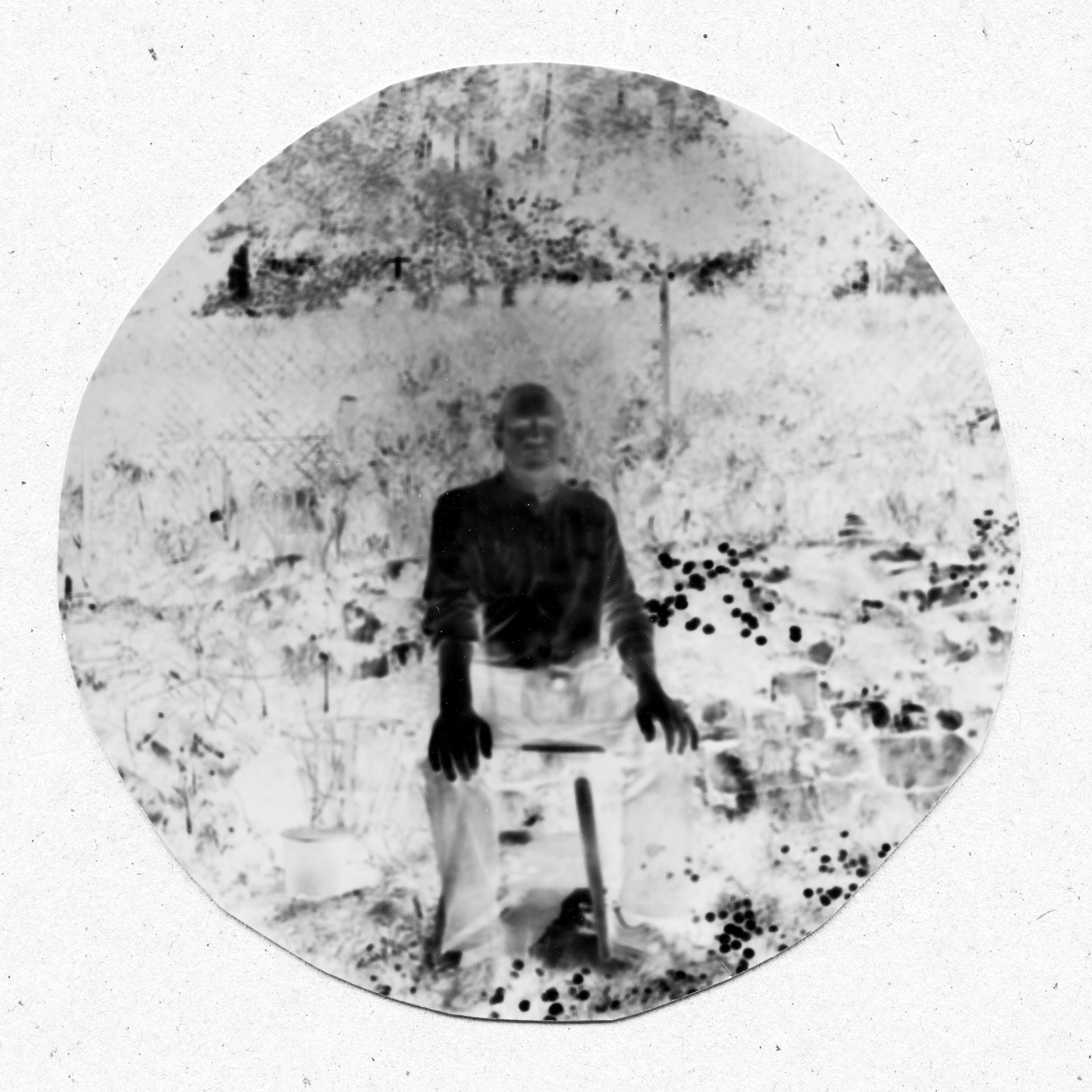



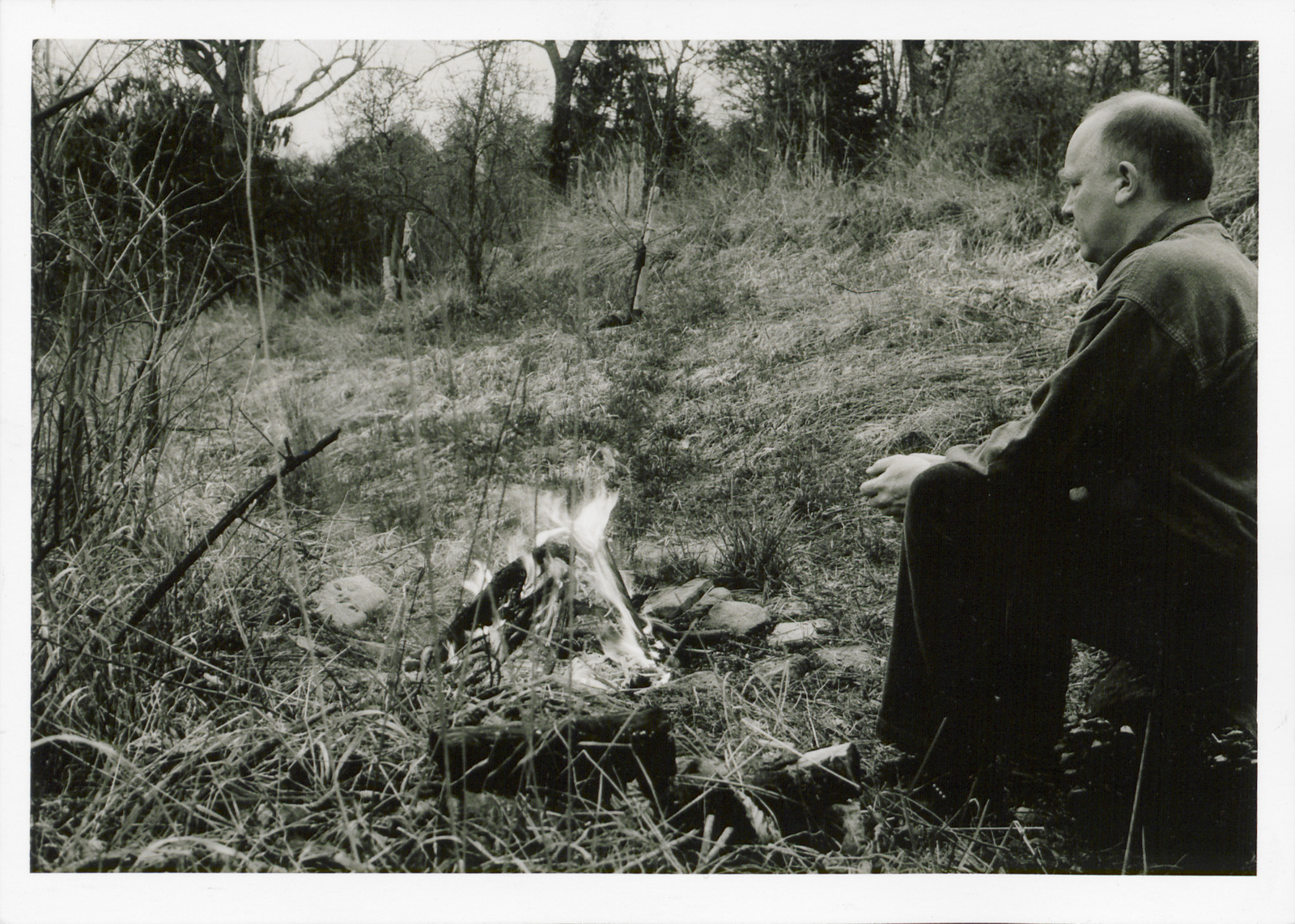
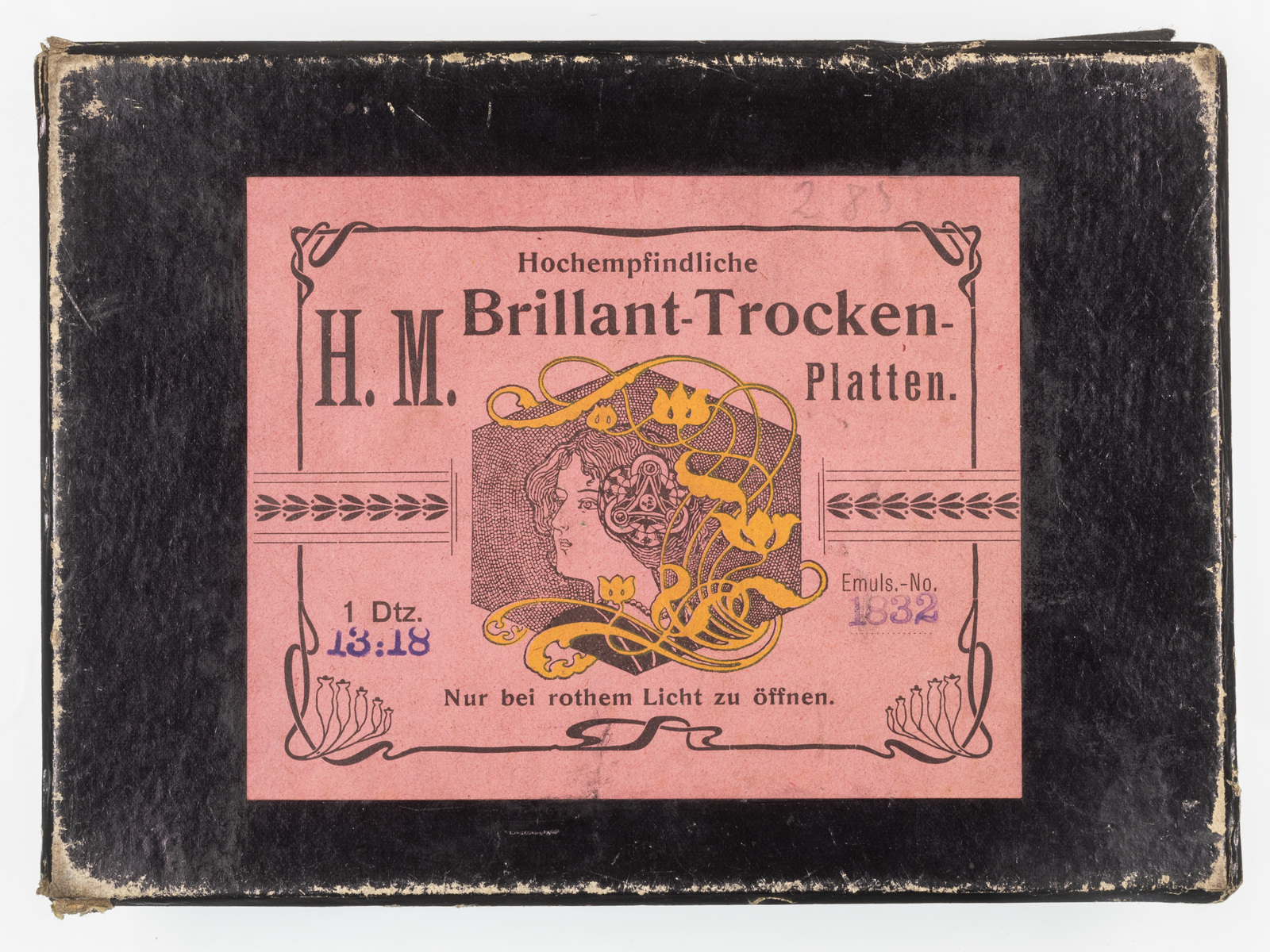

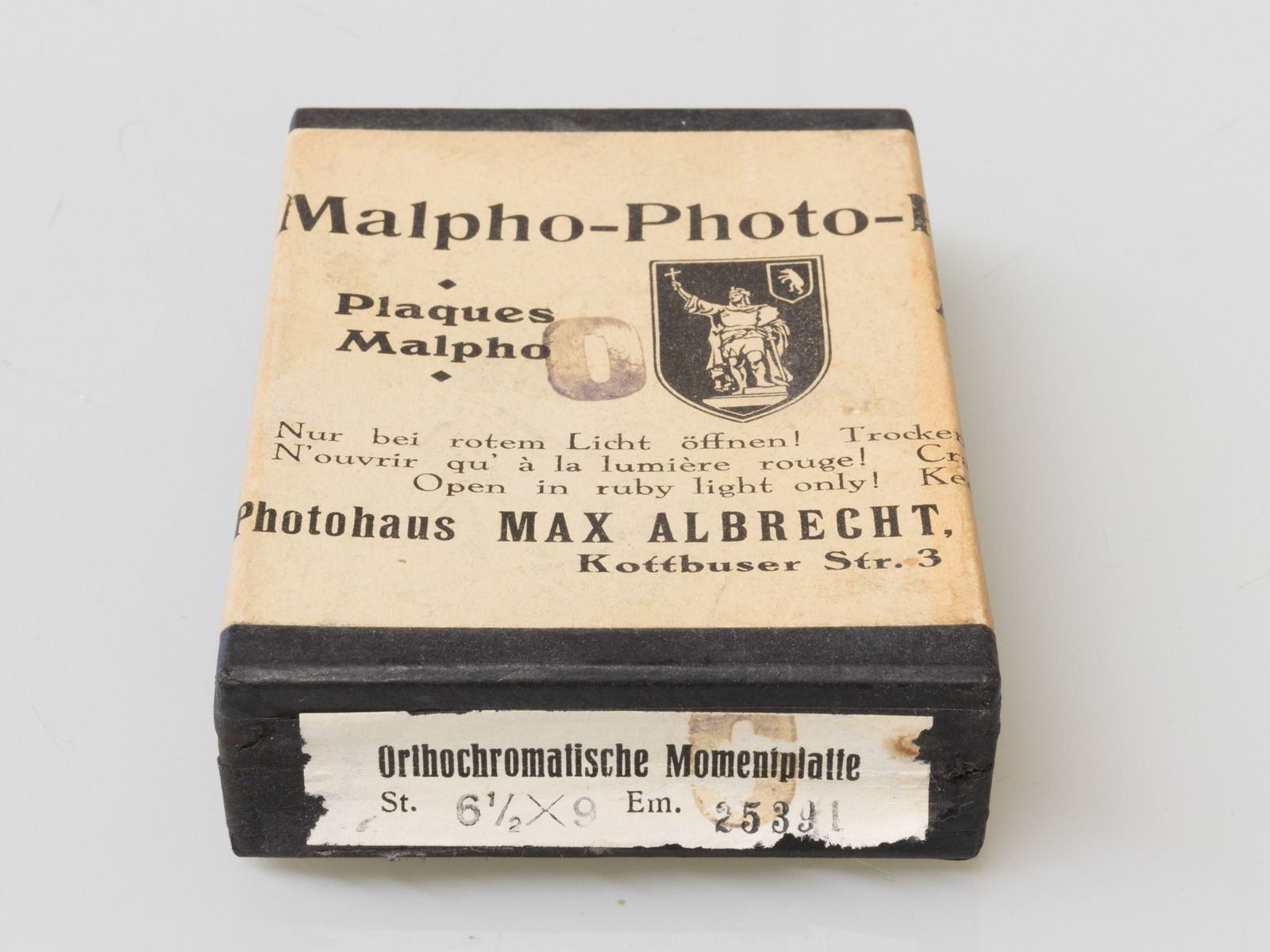
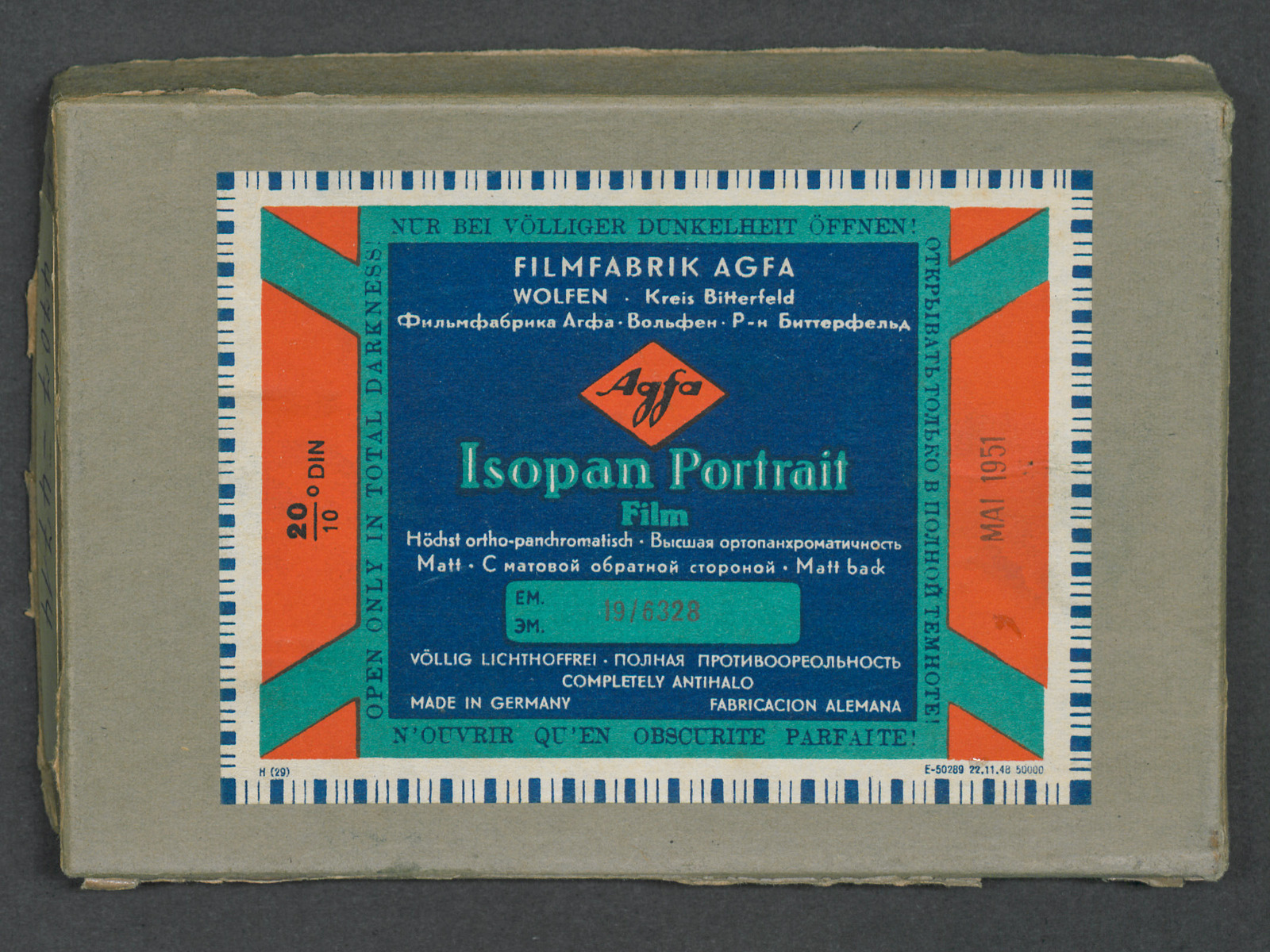
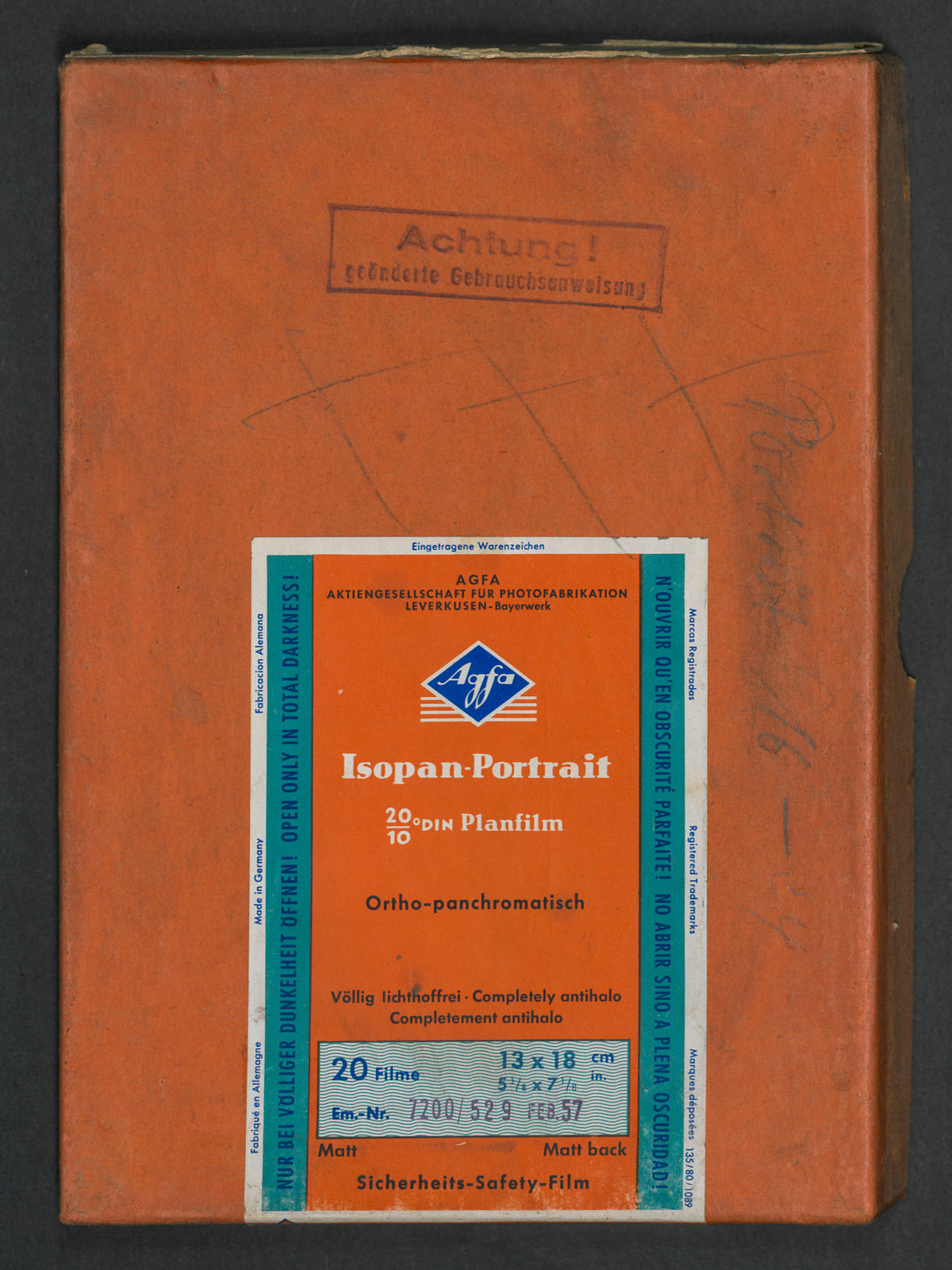

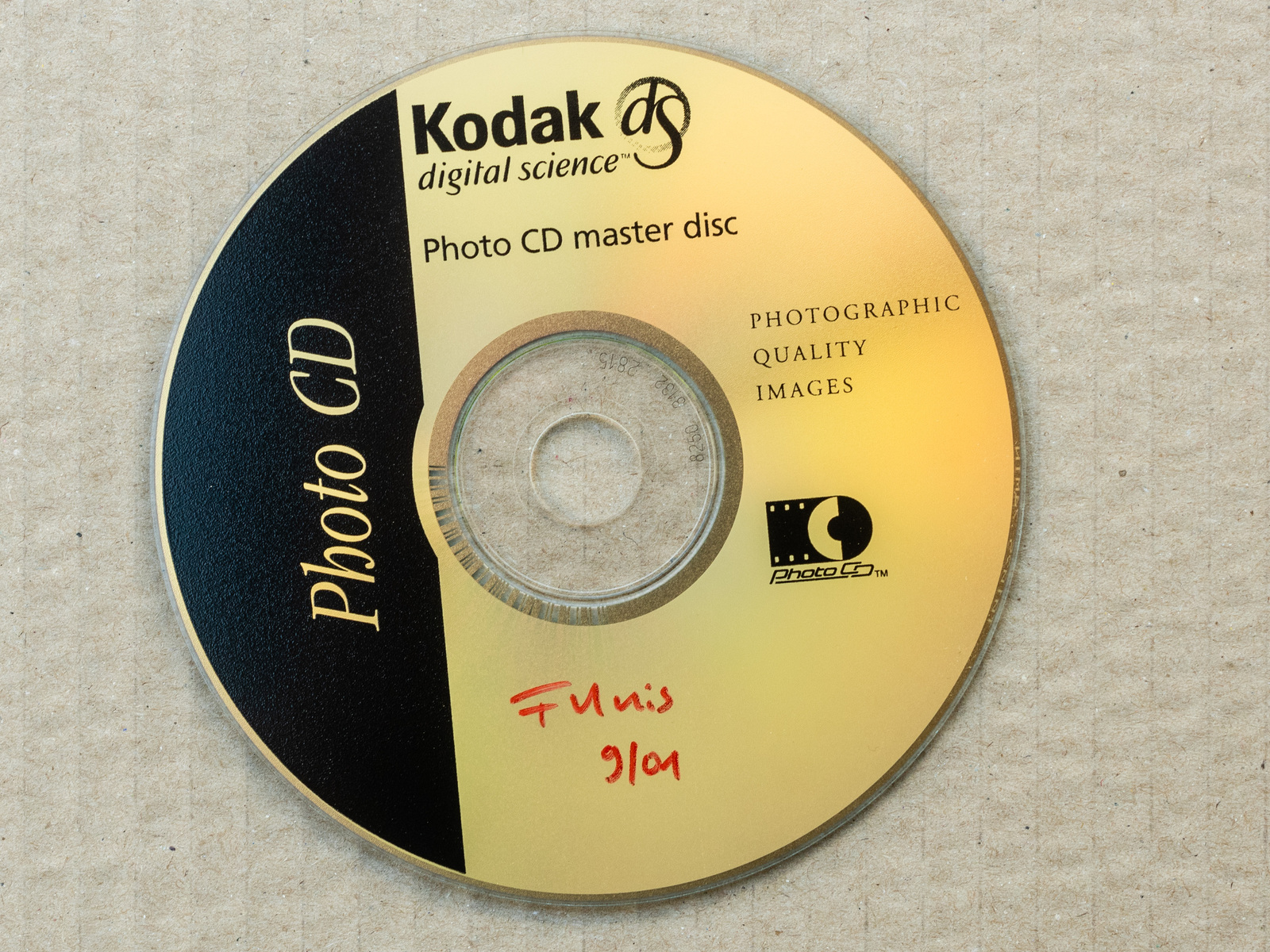
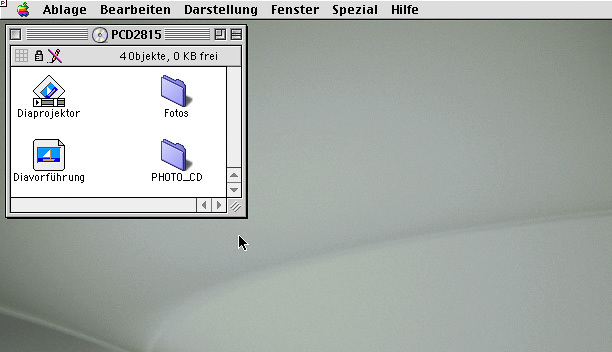
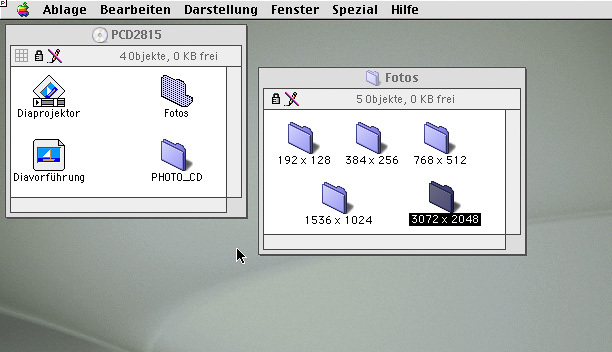
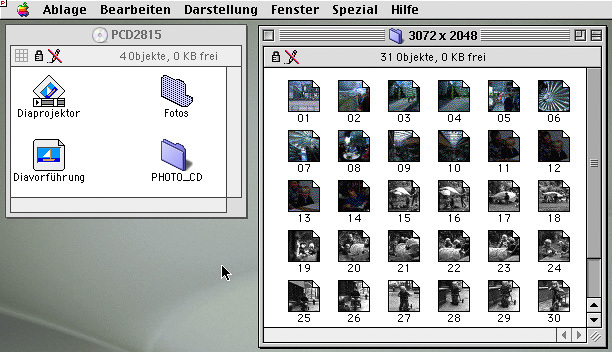
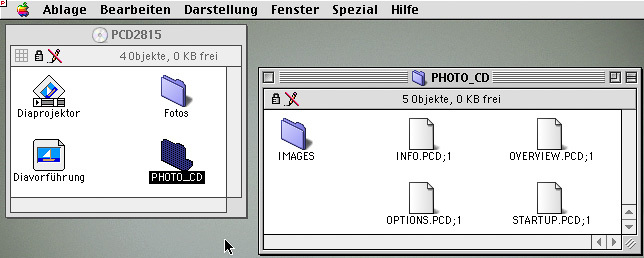
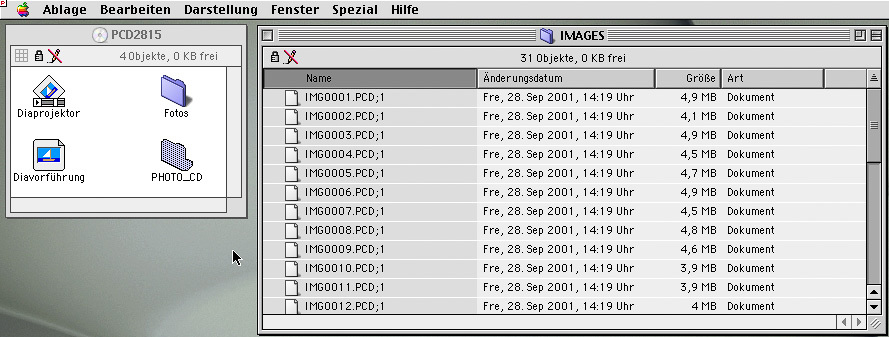
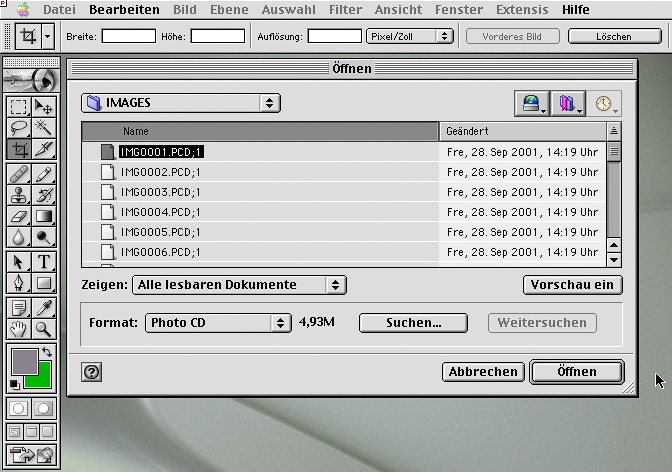
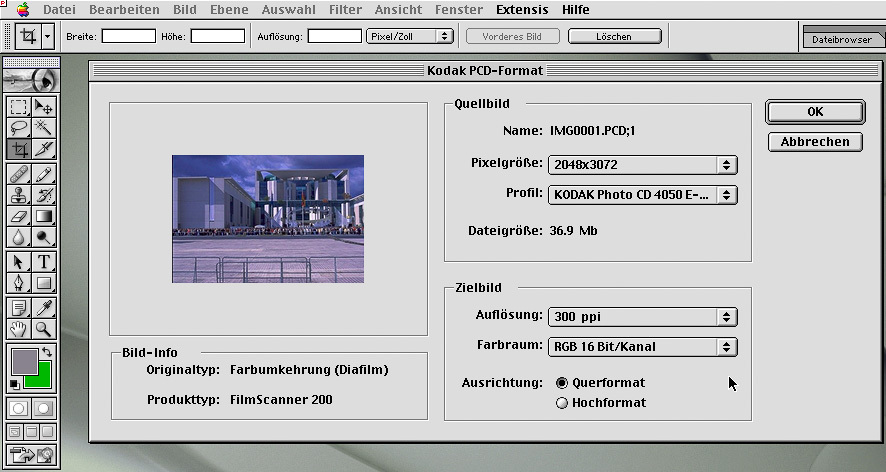
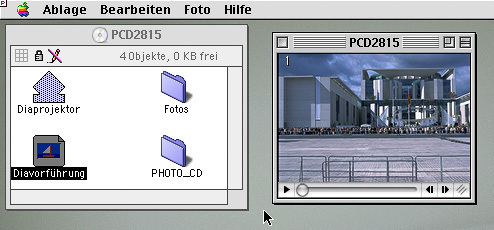
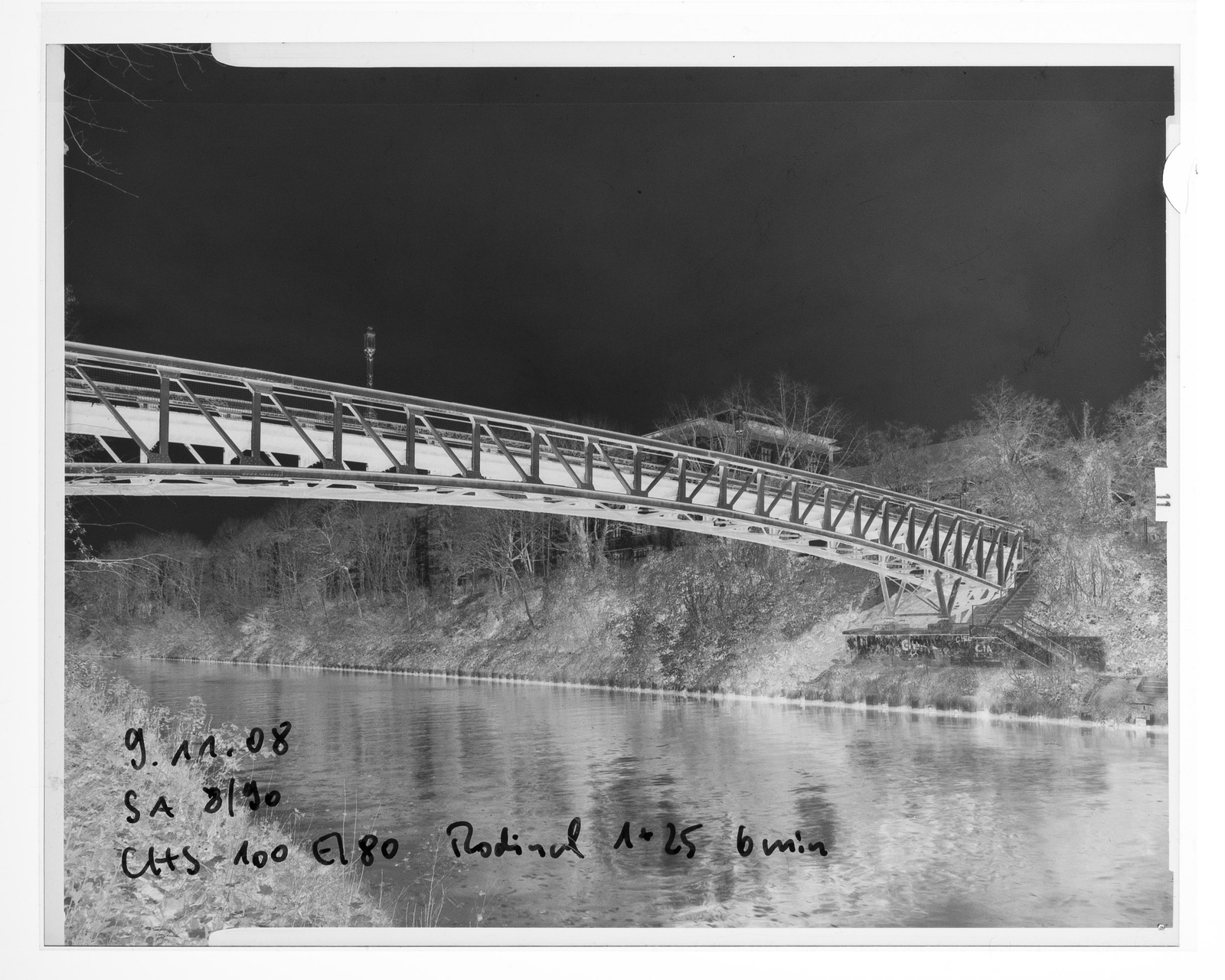


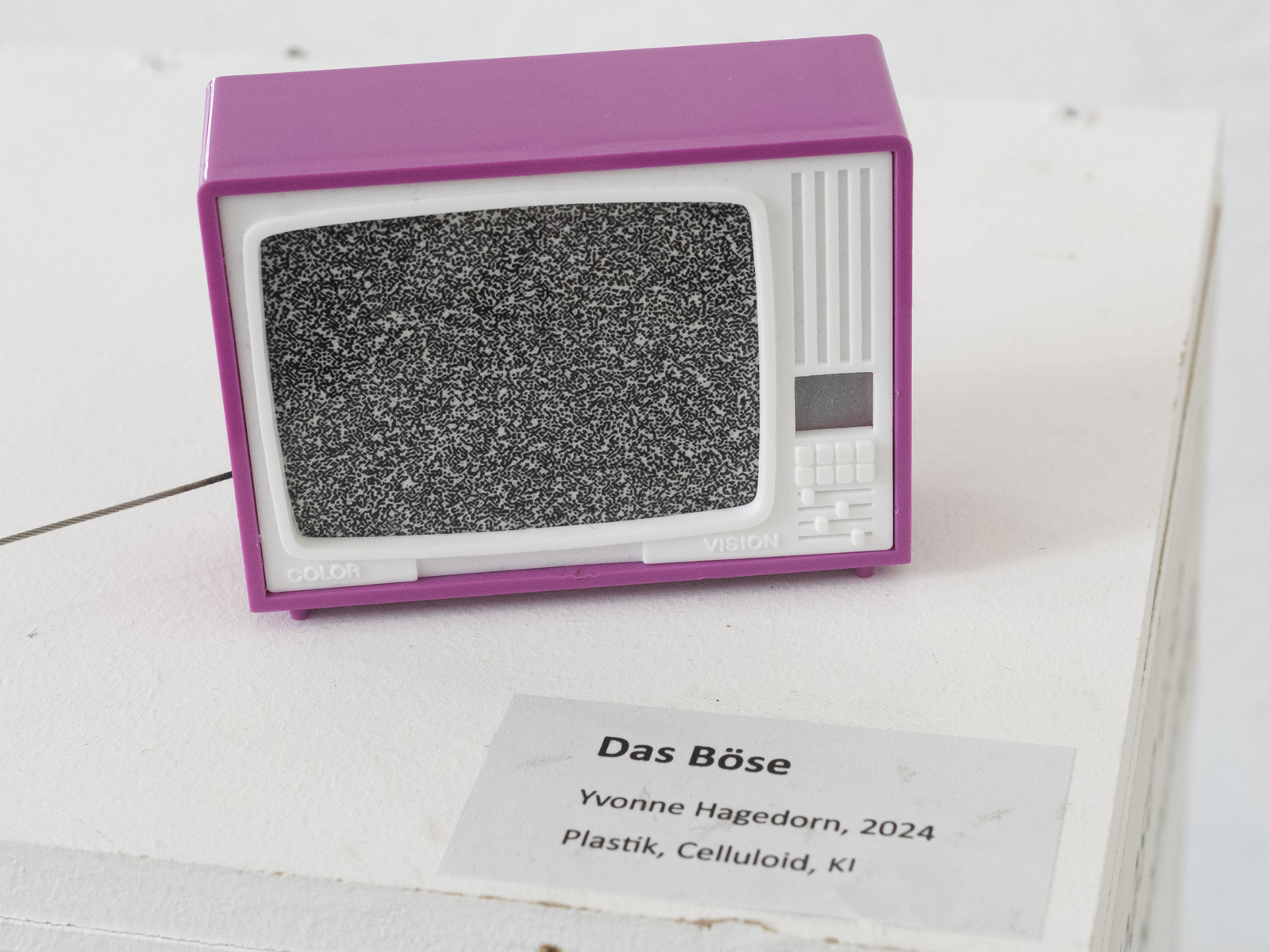


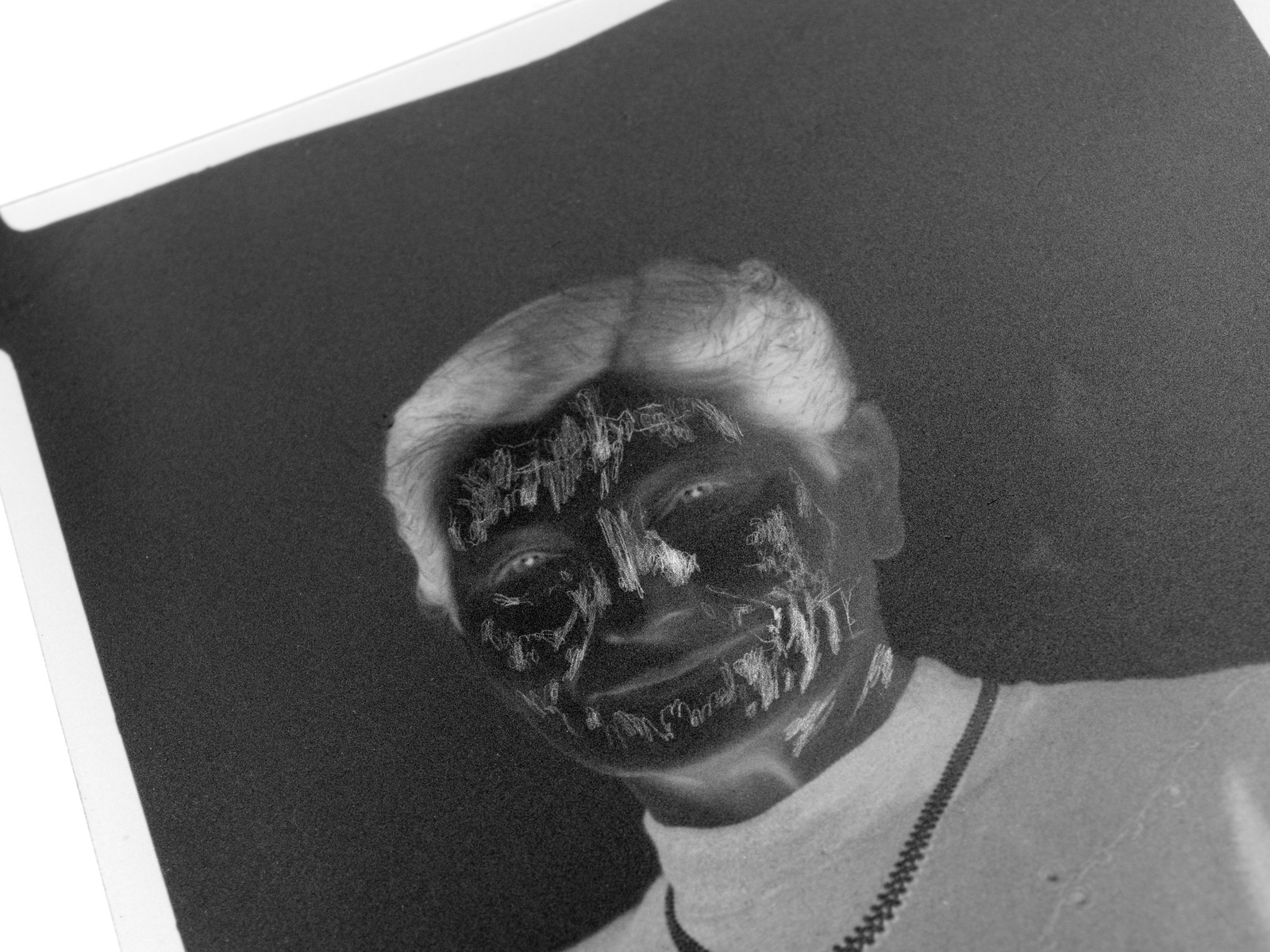
![© Martin Frech: Verpackung für Planfilme Isopan 27 matt im Format 13x18cm von Agfa-Gevaert; Charge 72391743, Aug. [19]70 Orange Pappschachtel (Verpackung) für Planfilme Isopan 27 matt im Format 13x18cm von Agfa-Gevaert; Charge 72391743, Aug. [19]70. Das Etikett ist gut zu erkennen. (Foto: © Martin Frech, 2024)](https://dpfs.api.medienfrech.de/a0714367abcf7c9c.best.jpg)
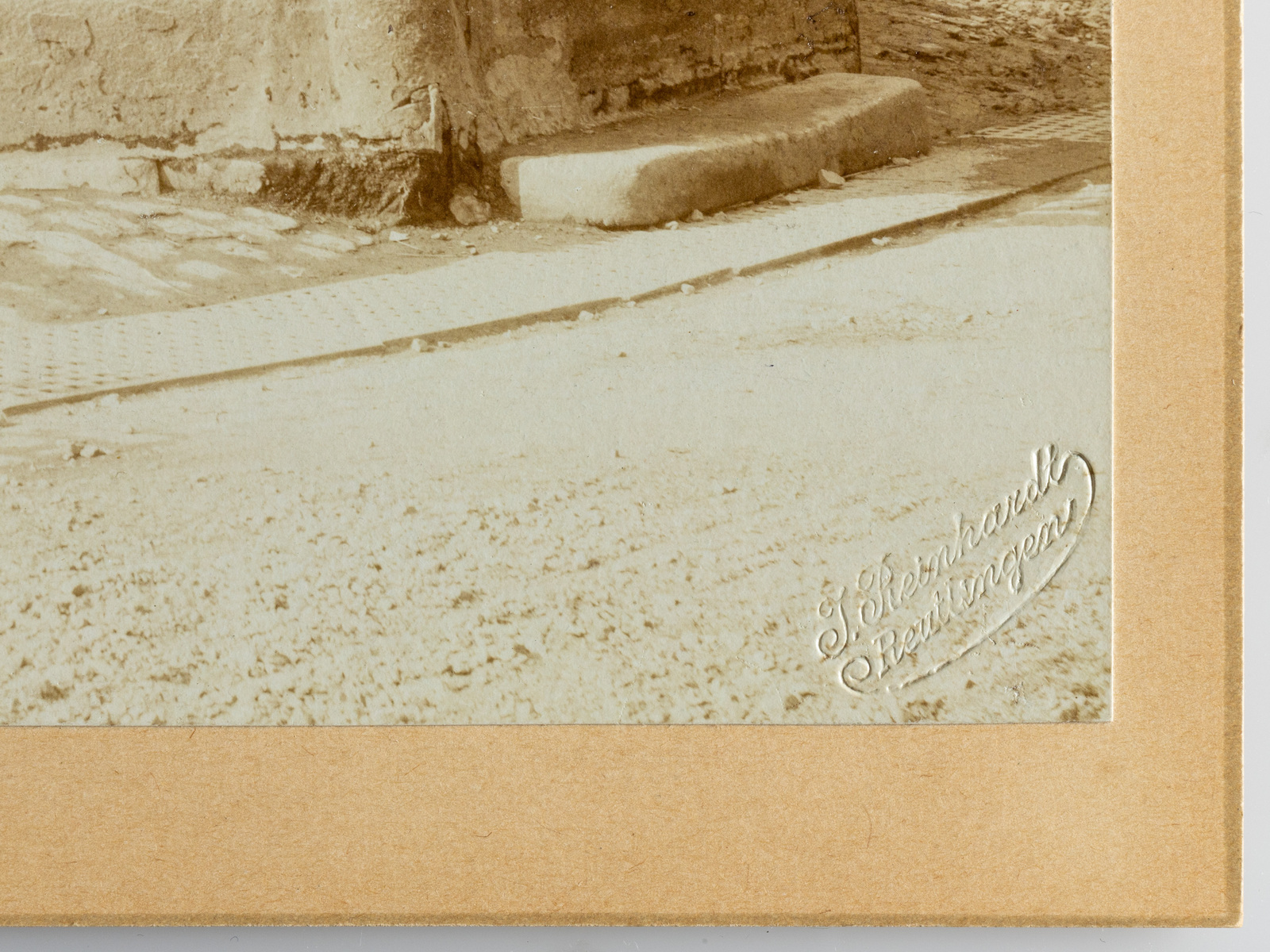
![Prägestempel des Fotografen Alexander Vasilievich Brisgaloff/Hollywood [1896–1971] im Bildbereich (recto, gleichmäßig beleuchtet; Repro: Martin Frech) Prägestempel des Fotografen Alexander Vasilievich Brisgaloff/Hollywood [1896–1971] im Bildbereich (recto, gleichmäßig beleuchtet; Repro: Martin Frech)](https://dpfs.api.medienfrech.de/30d5959c6fe9a972.best.jpg)
![Prägestempel des Fotografen Alexander Vasilievich Brisgaloff/Hollywood [1896–1971] im Bildbereich (recto, einseitig beleuchtet; Repro: Martin Frech) Prägestempel des Fotografen Alexander Vasilievich Brisgaloff/Hollywood [1896–1971] im Bildbereich (recto, einseitig beleuchtet; Repro: Martin Frech)](https://dpfs.api.medienfrech.de/7ca55ea624f5d20f.best.jpg)
![Prägestempel des Fotografen Alexander Vasilievich Brisgaloff/Hollywood [1896–1971] im Bildbereich (verso, gleichmäßig beleuchtet; Repro: Martin Frech) Prägestempel des Fotografen Alexander Vasilievich Brisgaloff/Hollywood [1896–1971] im Bildbereich (verso, gleichmäßig beleuchtet; Repro: Martin Frech)](https://dpfs.api.medienfrech.de/683fcb49f5bab376.best.jpg)